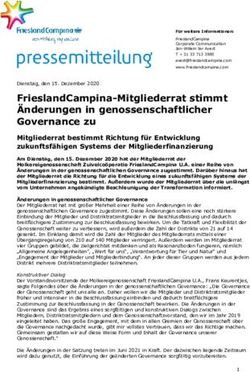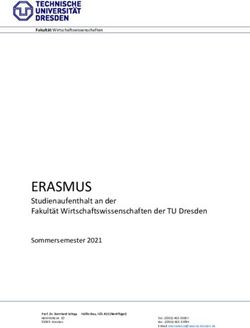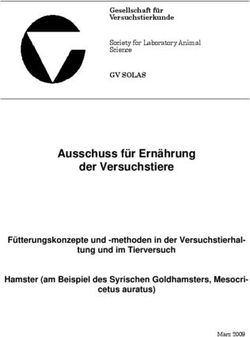Der KlimawanDel in Tirol - CCCA Data Server
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Klimawandel in Tirol
In Österreich ist die mittlere Temperatur seit 1880 um +1,3 °C bis +1,4 °C ansteigen. Bis Ende des Jahrhun-
ca. 2 °C angestiegen. Weltweit nahm sie im gleichen derts kann die mittlere Temperatur in Tirol sogar um
Zeitraum nur um die Hälfte zu (fast 1 °C). Ein weite- bis zu +4,2 °C zunehmen, wenn Treibhausgase auch
rer unverhältnismäßiger Anstieg der Temperatur ist künftig ungebremst freigesetzt werden. Nur durch
vorherzusehen.1 Doch was bedeutet diese Klimaver- einen massiven Rückgang der Treibhausgasemissio-
änderung konkret für Tirol? Im Rahmen des Projekts nen kann die Temperaturzunahme bis zum Jahr 2100
„ÖKS15“ wurden Klimaszenarien für die Bundes- auf +2,3 °C begrenzt werden. Die Erwärmung wird
länder erstellt, welche Aussagen über die regionale im Winter geringfügig stärker ausfallen als im Som-
Entwicklung des Klimas in der Zukunft erlauben. mer2.
Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem (z. B.
durch die Freisetzung von Treibhausgasen oder Än- Niederschlag
derungen der Landnutzung) wird dabei berücksichtigt. Zukünftige Niederschlagtrends sind weniger ein-
deutig, da Niederschläge zeitlich und räumlich sehr
Temperatur variabel sind. Dennoch wird der Jahresniederschlag
Die Jahresmitteltemperatur in Tirol lag im Zeit- in Tirol in den kommenden Jahrzehnten mit großer
raum von 1971 bis 2000 bei 2,9 °C. Bis 2050 wird Wahrscheinlichkeit leicht zunehmen, insbesondere
die durchschnittliche Jahrestemperatur um weitere im Winter2.
alpS: Hochwasser im Sommer 2005 in Innsbruck.
Medieninhaber und Herausgeber:
BUNDESMINISTERIUM FÜR LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT, UMWELT UND WASSERWIRTSCHAFT | Stubenring 1, 1010 Wien | bmfluw.gv.at
sowie die Länder: BURGENLAND, KÄRNTEN, NIEDERÖSTERREICH, OBERÖSTERREICH, SALZBURG, STEIERMARK, TIROL, VORARLBERG und WIEN
Text u. Redaktion: Daniela Hohenwaller-Ries, Kathrin Schwab, Hanna Krimm und Tobias Huber (alpS); Martina Offenzeller und Andrea Prutsch (Umweltbundesamt GmbH)
Grafik: awdesign.at | © alpS/Umweltbundesamt
1|4Der Klimawandel in Tirol
Klimaszenarien für das Bundesland Tirol
Um die zukünftigen Entwicklungen von Temperatur
und Niederschlag vorherzusagen, werden unterschied-
liche Emissionsszenarien für Treibhausgase als Basis
herangezogen. Im Projekt „ÖKS15“ wurden folgende
Szenarien verwendet:
Das Business-as-usual-Szenario basiert auf der
Annahme, dass Treibhausgase weiterhin ungebremst
ausgestoßen werden. Hingegen wird im Klima-
schutz-Szenario davon ausgegangen, dass in Zu-
kunft auf globaler Ebene wirksame Klimaschutzmaß-
nahmen umgesetzt und die Emission von Treibhaus-
gasen bis 2080 auf ca. die Hälfte des heutigen Ni-
veaus reduziert werden können. Es gilt zu beachten,
dass zum Erreichen des im Pariser Klimaabkommen
festgelegten Ziels, die weltweite Temperaturzunah-
me auf 2 °C zu beschränken, weitreichendere Maß-
nahmen notwendig sind, als im Klimaschutz-Szena-
rio angenommen.
Die Verwendung regionaler Klimamodelle sowie sta-
tistischer Interpolationen erlauben Klimaprojektionen
mit sehr hoher räumlicher Auflösung (1 x 1 km).2 Die Stubaier Alpen im Winter.
In der Zukunft:
Entwicklung der Lufttemperatur und des Niederschlags in Tirol
14
Simulierte Entwicklung
der mittleren Lufttemperatur 12
Business-as-usual 10
Temperatur in °C (absolut)
Klimaschutz-Szenario
8
Bandbreite der Klimasimulationen
Business-as-usual
6
Bandbreite der Klimasimulationen
Klimaschutz-Szenario
4
Sommer: Winter:
Juni, Juli und August Dezember, Jänner und Februar 2
2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100
Referenzperiode: Nahe Zukunft: 2021-2050 Ferne Zukunft: 2071-2100
1971-2000 Klimaschutz- Business- Klimaschutz- Business-
Szenario as-usual Szenario as-usual
Jahresmittel Temperatur- Jahresmittel Jahresmittel Jahresmittel Jahresmittel
Temperatur
abweichung
(°C)
2,9 (°C) +1,3 +1,4 +2,3 +4,2
Sommer Winter Niederschlags- Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer Winter
Nieder-
änderungen
schlag (mm)
500 234 (%) +0,0 +9,7 +2,8 +13,1 +3,3 +7,8 -0,2 +18,6
2|4Der Klimawandel in Tirol
Kernaussagen aus ÖKS15 für Tirol:
o Mittlere Jahrestemperaturen steigen bis 2050 von 2,9 °C auf mindestens 4,2 °C. Bis 2100 erhö-
hen sich die Mittelwerte der Temperaturen auf 5,2 °C (Klimaschutz-Szenario) bzw. 7,1 °C (Business-
as-usual-Szenario).
o Es ist mit einer leichten Zunahme des jährlichen Niederschlags und insbesondere der Winternie-
derschläge in naher und ferner Zukunft zu rechnen.
o Bisher verzeichnete Tirol durchschnittlich 0,5 Hitzetage im Jahr. In naher Zukunft werden es jährlich
1,7 Tage sein, in ferner Zukunft sogar rund 3 bzw. 8 Tage in Abhängigkeit von unserer zukünftigen
Lebens- und Wirt-schaftsweise.
o Die Vegetationsperiode wird deutlich länger. Bisher dauerte sie in Tirol durchschnittlich ca. 148 Tage. Bis
2050 wird sie um ca. 17 (Klimaschutz-Szenario) bzw. um ca. 21 Tage (Business-as-usual-Szenario) länger.
Mit Ende des Jahrhunderts wird sich die Vegetationsperiode sogar um ca. 34 bzw. um ca. 65 Tage im Jahr
verlängern.
o Das Jahresmittel der Frosttage in Tirol betrug bisher rund 199 Tage. Bis 2050 reduziert sich die Zahl
auf max. 175 Tage. Ende des Jahrhunderts gibt es nur noch 153 (Klimaschutz-Szenario) bzw. 118
Frosttage im Jahr (Business-as-usual-Szenario).
Relevante Klimafolgen für das Bundesland Tirol
Die Folgen des Klimawandels sind in Tirol bereits Effekte des Klimawandels werden zusätzlich von
heute deutlich zu spüren. Das Wissen über künftige gesellschaftspolitischen Entwicklungen (z. B. Bevöl-
Klimatrends ist essentiell, um negative Auswirkungen kerungsentwicklung, Veränderungen der Landnut-
auf den Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum zu mini- zung) verstärkt.
mieren sowie sich bietende Chancen zu nutzen.
Die wichtigsten Auswirkungen des Klimawandels auf einen Blick
o Abnahme der Bodenstabilität
o Auftauen von Permafrostböden
o Zunahme von gravitativen Massenbewegungen
o Beeinträchtigung der Bodenfruchtbarkeit und Bodenfunktionen
BODEN
o Verschiebung alpiner Lebensräume
o Gefährdung der Artenvielfalt (z. B. kälteangepasste, heimische Arten)
o Anstieg der Baumgrenze
o Ausbreitung von neuen und heimischen Schädlingen
o Beeinträchtigung der Schutzfunktion von Wäldern
FLORA & FAUNA
o Rückgang der Gletscher
o Zunahme der Gewässertemperaturen
o Veränderung des Abflussregimes von Fließgewässern
o Verstärkung der Geschiebefracht
o Anstieg der Schneefallgrenze
WASSER o Abnahme von Schneeniederschlag und Schneedeckendauer
Auswirkungen auf verschiedene Sektoren sind in den entsprechenden Factsheets zu finden.
3|4Der Klimawandel in Tirol
Regionsspezifische Beispiele
o Für das Bundesland Tirol wurden 3.145 Blockgletscher identifiziert, die eine Fläche von ca.
167 km2 haben.3 Diese Blockgletscher bilden die häufigste Form des alpinen Permafrosts.
Das Auftauen von Permafrostböden erhöht die Gefahr von Steinschlägen, Felsstürzen oder
Murgängen.4
o Höhere und extremere Temperaturen, intensivere Gefrier- und Auftauprozesse, Trockenheit und
Starkniederschläge können die Bodenfunktionen, wie Bodenfruchtbarkeit oder Schutz vor Bo-
BODEN denerosion, beeinträchtigen.1 Neben klimatischen Veränderungen sind auch Faktoren wie Land-
nutzung und Bewirtschaftung von Bedeutung. Besonders alpine Böden reagieren sensibel.5
o 41 % der Tiroler Landesfläche ist mit Wald bedeckt. Davon fällt rund ein Drittel in die Kategorie
Schutzwald. Waldbewirtschaftung zum Schutz vor Naturgefahren hat in Tirol aufgrund der
Topographie einen besonders hohen Stellenwert. Durch die steigenden Temperaturen kommt es
zum Massenauftreten von Borkenkäfern. Dadurch entstehen hohe forstwirtschaftlichen Schäden
(10 % der Holznutzungsmenge Tirols) und die Schutzfunktion von Tiroler Wäldern wird beein-
trächtigt.1, 6 Auch Extremwetterereignisse können sich sehr ungünstig auswirken, wie z. B. 2016
in den Bezirken Kitzbühel, Landeck, Reutte und Schwaz, wo 200.000 m³ Schadholz anfielen.7
o Tirols alpine Lebensräume haben eine hohe Artenvielfalt. Durch den Klimawandel steigt die
Waldgrenze, wodurch an bestimmte Höhenlagen angepasste Arten zunehmend gefährdet und
verdrängt werden (z. B. am Schrankogel). Im Zeitraum 1950-2000 wurde im Paznauntal bereits
ein mittlerer Anstieg der Waldgrenze um 20 Höhenmeter beobachtet.1
o Die Einwanderung neuer Arten wie z. B. das „Beifußblättrige Traubenkraut“ (Ambrosie) oder
der „Riesen-Bärenklau“ gefährdet die Biodiversität. Diese Arten werden durch veränderte
FLORA & FAUNA
Standortbedingungen begünstigt. Die Verbreitung umfasst zerstreute Vorkommen über das
Inntal sowie die größeren Seitentäler, das Ehrwalder Becken, das Lechtal, den Raum St. Johann/
Kitzbühel und Osttirol. Vor allem dynamische Ökosysteme, wie Augebiete oder Schlagflächen
Tirols, sind betroffen.8
Die Wasserqualität von Seen wird durch die fortschreitende Erwärmung beeinträchtigt. Groß-
algen können aus südlicheren Regionen einwandern und heimische Arten verdrängen. Kälte-
liebende heimische Fischarten müssen in höhere Lagen wandern oder können sogar aussterben.
Am Gossenköllesee in den Stubaier Alpen konnte bereits eine Veränderung der Algenpopulation
durch steigende Temperaturen festgestellt werden.1, 4
o Die Auswirkungen des Klimawandels in den Alpen werden am deutlichsten im massiven Ab-
schmelzen der Tiroler Gletscher sichtbar. So nahm beispielsweise die Gletscherfläche in den
südlichen Ötztaler Alpen von ca. 144 km2 (Jahr 1969) auf 116 km2 (2006) ab.1
o Steigende Temperaturen führen zur Abnahme des Schneeniederschlags, zur Verkürzung der
Schneedeckendauer und zum Anstieg der Schneefallgrenze. Dies stellt bereits jetzt eine Her-
ausforderung für den Tiroler Wintertourismus dar und betrifft in Tirol z. B. das Außerfern bzw.
das Tiroler Unterland.9
o In naher Zukunft wird besonders in den Sommermonaten in Einzugsgebieten von Fließgewäs-
sern mit erhöhten Abflüssen aus Gletschern und erhöhter Geschiebefracht zu rechnen sein.1
Eine Zunahme der Geschiebefracht wurde beispielsweise in der Venter Ache, Rofenache und am
Tiroler Inn beobachtet.4
WASSER
Da Schneeniederschläge in Zukunft zurückgehen, wird weniger Wasser in Form von Schnee
zwischengespeichert. Ohne verzögerte Wasserabgabe kommt es zur Veränderung des Abfluss-
regimes von Fließgewässern. Weniger Schnee und der Anstieg der Schneefallgrenze können
daher zu Problemen in der Land- und Energiewirtschaft führen sowie Hochwässer begünstigen.
Am Tiroler Lech wird sich durch das veränderte Abflussregime der Hochwasserzeitraum deutlich
ausdehnen.4
1. APCC (2014): Österreichischer Sachstandsbericht Klimawandel 2014 (AAR14). Austrian Panel on Climate Change (APCC). Verlag der Öster-reichischen Akademie der Wissenschaft, Wien.
2. ÖKS15 (2016): Klimaszenarien für das Bundesland Tirol bis 2100. ÖKS15 Klimafactsheet. Version 09/2016.
3. Krainer, K., Ribis, M. (2011): Blockgletscherinventar Tirol. Mitteilungsblatt des hydrographischen Dienstes in Österreich, Nr. 87, S. 67 – 88. Wien.
4. Amt der Tiroler Landesregierung (2015): Sachstandsbericht Klimawandel in Tirol. Innsbruck.
5. www.alpine-space.eu/projects/links4soils/en/case-studies/forest
6. Amt der Tiroler Landesregierung (2011): Tiroler Waldstrategie 2020. Innsbruck.
7. www.tirol.gv.at/umwelt/wald/zustand/waldschaeden
8. www.uibk.ac.at/botany/neophyten-tirol/
9. Steiger, R. & Abegg, B. (2013): The Sensitivity of Austrian Ski Areas to Climate Change. In: Tourism Planning & Development 10, S. 480–493.
4|4Sie können auch lesen