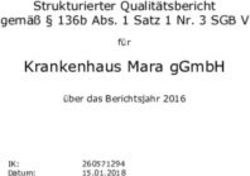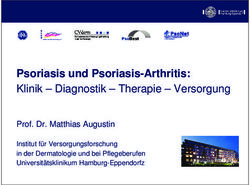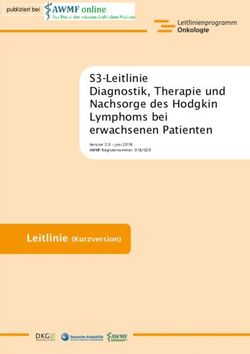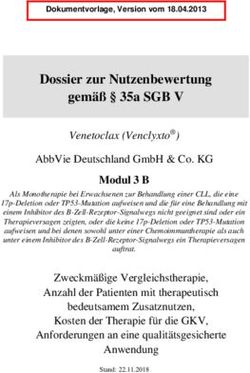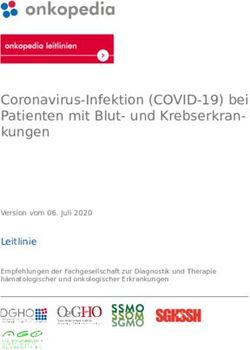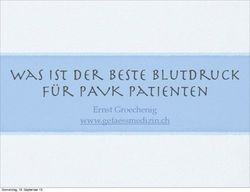2019 Diagnostik und Therapie neurologischer Erkrankungen - State of the art - Elsevier-Shop
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
neurologiewelt.de
Uwe Klaus Zettl Jörn Peter Sieb (Hrsg.)
Diagnostik und Therapie
neurologischer Erkrankungen
State of the Art
2019Inhaltsverzeichnis
1 Störungen der 3.1.3 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Basalganglienfunktion: 3.1.4 Akutdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Bewegungsstörungen 3.1.5 Akuttherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Christiana Franke 3.1.6 Ursachenabklärung . . . . . . . . . . . . 61
und Alexander Storch . . . . . . . . . . . 1 3.1.7 Sekundärprävention . . . . . . . . . . . . 62
1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3.2 Intrazerebrale Blutung
1.2 Parkinson-Syndrome Karim Hajjar, Martin Köhrmann
(akinetisch-rigide Syndrome) . . . . . 3 und Christoph Kleinschnitz . . . . . . . 65
1.2.1 Idiopathisches Parkinson-Syndrom . . 5 3.2.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.2.2 Atypische Parkinson-Syndrome . . . . 13 3.2.2 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
1.3 Tremor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.2.3 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
1.3.1 Essenzieller Tremor . . . . . . . . . . . . . 16 3.2.4 Sekundärprävention . . . . . . . . . . . . 68
1.4 Hyperkinetische 3.3 Subarachnoidalblutung
Bewegungsstörungen . . . . . . . . . . 18 Bessime Bozkurt, Martin Köhrmann
1.4.1 Huntington-Erkrankung . . . . . . . . . . 18 und Christoph Kleinschnitz . . . . . . . 68
1.4.2 Dystonien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3.3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.3.2 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2 Motoneuronerkrankungen 3.3.3 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Johannes Prudlo und 3.3.4 Ätiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Andreas Hermann . . . . . . . . . . . . . . 27 3.3.5 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 3.3.6 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
2.2 Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) . . 28 3.4 Sinus- und Hirnvenenthrombose
2.2.1 ALS als motorisches Syndrom . . . . . 28 Bessime Bozkurt, Martin Köhrmann
2.2.2 ALS als frontotemporales Syndrom . . 34 und Christoph Kleinschnitz . . . . . . . 71
2.2.3 Diagnostik der ALS . . . . . . . . . . . . . 37 3.4.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2.4 Genetik der ALS . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.4.2 Symptome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.2.5 Molekulare Pathophysiologie 3.4.3 Ätiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
der ALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 3.4.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2.6 Molekulare Neuropathologie 3.4.5 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
der ALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2.7 Therapie der ALS . . . . . . . . . . . . . . . 41 4 Vaskulitiden
2.3 5q-assoziierte spinale Peter Berlit und Markus Krämer . . . . 79
Muskelatrophien (SMA) . . . . . . . . . 46 4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2 Klassifikation . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3 Zerebrovaskuläre 4.3 Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . 53 4.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.1 Ischämischer Schlaganfall 4.5 Einzelne Krankheitsbilder . . . . . . . . 83
Karim Hajjar, Martin Köhrmann 4.5.1 Riesenzellarteriitis
und Christoph Kleinschnitz . . . . . . . 55 (Arteriitis cranialis, temporalis) . . . . . 83
3.1.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4.5.2 Takayasu-Syndrom . . . . . . . . . . . . . 84
3.1.2 Epidemiologie . . . . . . . . . . . . . . . . 55
+21881_Zettl.indb XVII 19.09.2018 07:22:47XVIII Inhaltsverzeichnis
4.5.3 Granulomatose mit 5.4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Polyangiitis (GPA) . . . . . . . . . . . . . . 85 5.4.2 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.5.4 Polyarteriitis nodosa und eosinophile 5.4.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Granulomatose mit Polyangiitis 5.4.4 Assoziierte Erkrankungen . . . . . . . . 146
(EGPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 5.4.5 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
4.5.5 Behçet-Syndrom . . . . . . . . . . . . . . . 85 5.5 Angeborene Störungen der
4.5.6 Systemischer Lupus erythematodes neuromuskulären Signalübertragung:
(SLE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 kongenitale Myasthenie-Syndrome
4.5.7 Primäre Angiitis des zentralen Jörn Peter Sieb . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Nervensystems (PACNS) . . . . . . . . . 86 5.5.1 Klinisches Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
4.6 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 5.5.2 Zusatzdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.5.3 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5 Immunmediierte Erkrankungen 5.6 Idiopathische inflammatorische
des Nervensystems Myopathien und seltene Myositiden
(unter Einschluss der kongenitalen Benedikt Schoser
Myasthenie-Syndrome) . . . . . . . 91 und Werner Stenzel . . . . . . . . . . . . . 158
5.1 Multiple Sklerose und 5.6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
verwandte Krankheitsbilder 5.6.2 Idiopathische inflammatorische
Paulus Stefan Rommer Myopathien . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
und Uwe Klaus Zettl . . . . . . . . . . . . 92 5.6.3 Einteilung und Klassifikation
5.1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 der Myositiden . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5.1.2 Multiple Sklerose . . . . . . . . . . . . . . 93 5.6.4 Seltene Myositiden . . . . . . . . . . . . . 167
5.1.3 Neuromyelitis optica
(Devic-Syndrom) . . . . . . . . . . . . . . . 111 6 Neuroonkologie
5.2 Stiff-Person-Sydrom- Niklas Schäfer
Spektrum-Erkrankung und Ulrich Herrlinger . . . . . . . . . . . . 171
Lutz Harms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2.1 Assoziierte Erkrankungen . . . . . . . . 121 6.2 Primäre Hirntumoren . . . . . . . . . . . 172
5.2.2 Pathogenese/Pathophysiologie . . . . 121 6.2.1 Häufigkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 6.2.2 Meningeome . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
5.2.4 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 6.2.3 Hypophysenadenome . . . . . . . . . . . 173
5.3 Peripheres Nervensystem 6.2.4 Nervenscheidentumoren . . . . . . . . . 173
Helmar C. Lehmann . . . . . . . . . . . . . 127 6.2.5 Gliome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
5.3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 6.2.6 Ependymome . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5.3.2 Guillain-Barré-Syndrom (GBS) . . . . . 128 6.2.7 Embryonale Tumoren . . . . . . . . . . . . 178
5.3.3 Chronische inflammatorische 6.2.8 Andere Tumoren . . . . . . . . . . . . . . . 179
demyelinisierende Polyneuropathie 6.2.9 Primäre ZNS-Lymphome (PZNSL) . . . 179
(CIDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 6.3 Sekundäre Hirntumoren . . . . . . . . . 180
5.3.4 Multifokale motorische Neuropathie 6.3.1 Allgemeine Therapieoptionen . . . . . 180
(MMN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 6.3.2 Therapieoptionen differenziert nach
5.3.5 Paraproteinämische Neuropathie . . . 136 Primärtumor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
5.3.6 Nichtsystemische vaskulitische 6.4 Meningeosis neoplastica . . . . . . . . 181
Neuropathie (NSVN) . . . . . . . . . . . . 138 6.5 Supportivtherapie . . . . . . . . . . . . . 181
5.4 Myasthenia gravis
Jörn Peter Sieb . . . . . . . . . . . . . . . . 141
+21881_Zettl.indb XVIII 19.09.2018 07:22:47Inhaltsverzeichnis XIX
7 Paraneoplastische Syndrome 9.2.1 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
und antikörpervermittelte 9.2.2 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Enzephalitiden 9.2.3 Symptomatische Insomnien . . . . . . . 226
Samuel Knauss und Harald Prüß . . . 185 9.3 Schlafbezogene
7.1 Einleitung und Übersicht . . . . . . . . 186 Atmungsstörungen . . . . . . . . . . . . 226
7.2 Paraneoplastische 9.3.1 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
neurologische Syndrome . . . . . . . . 188 9.3.2 Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom . 227
7.2.1 Pathophysiologie . . . . . . . . . . . . . . . 188 9.3.3 Zentrales Schlafapnoe-Syndrom . . . . 227
7.2.2 Klinische Syndrome . . . . . . . . . . . . . 189 9.3.4 Nächtliches
7.3 Antikörpervermittelte Hypoventilationssyndrom . . . . . . . . 228
Enzephalitiden . . . . . . . . . . . . . . . . 193 9.4 Narkolepsie und
7.3.1 Pathophysiologie . . . . . . . . . . . . . . . 194 Hypersomnie . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
7.3.2 Spezifische antikörpervermittelte 9.4.1 Narkolepsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
Enzephalitiden . . . . . . . . . . . . . . . . 194 9.4.2 Idiopathische Hypersomnie . . . . . . . 230
7.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 9.4.3 Periodische Hypersomnie
7.4.1 Anamnese und klinische (Kleine-Levin-Syndrom) . . . . . . . . . . 230
Untersuchung . . . . . . . . . . . . . . . . 198 9.5 Parasomnien . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.4.2 Apparative Diagnostik . . . . . . . . . . . 199 9.5.1 Non-REM-Parasomnien . . . . . . . . . . 231
7.4.3 Antikörperdiagnostik . . . . . . . . . . . . 200 9.5.2 REM-Parasomnien . . . . . . . . . . . . . . 232
7.4.4 Tumorsuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 9.5.3 Rezidivierende isolierte
7.5 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 Schlafparalysen . . . . . . . . . . . . . . . . 232
7.5.1 Tumortherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 9.5.4 Albträume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
7.5.2 Immunsuppression . . . . . . . . . . . . . 203 9.6 Schlafbezogene
7.5.3 Supportive Therapie . . . . . . . . . . . . . 204 motorische Störungen . . . . . . . . . . 232
9.6.1 Restless-Legs-Syndrom . . . . . . . . . . 233
8 Muskelerkrankungen 9.6.2 Periodische Beinbewegungen
Jörn Peter Sieb . . . . . . . . . . . . . . . . 207 im Schlaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
8.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
8.2 Toxische Myopathien . . . . . . . . . . . 208 10 Diagnostik und Therapie
8.2.1 Critical-Illness-Myopathie (CIM) . . . . 209 von Demenzerkrankungen . . . . . 239
8.2.2 Chronische Steroidmyopathie . . . . . 210 Ingo Kilimann und Stefan Teipel . . . . 239
8.2.3 Cholesterinsenker . . . . . . . . . . . . . . 210 10.1 Epidemiologie . . . . . . . . . . . . . . . . 239
8.3 Muskeldystrophien . . . . . . . . . . . . . 211 10.2 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
8.3.1 Dystrophinopathien 10.2.1 Syndrom und
(Muskeldystrophie Duchenne Schweregradeinteilung . . . . . . . . . . 240
und Becker) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 10.2.2 Ursachen von
8.3.2 Fazioskapulohumerale Demenzerkrankungen . . . . . . . . . . . 241
Muskeldystrophie (FSHD) . . . . . . . . . 213 10.2.3 Diagnostik von
8.3.3 Gliedergürteldystrophien . . . . . . . . . 214 Kognitionsstörungen . . . . . . . . . . . . 243
8.4 Kongenitale Myopathien . . . . . . . . 217 10.2.4 Neuropsychologische Diagnostik . . . 244
8.5 Myotone Dystrophien . . . . . . . . . . 219 10.2.5 Weiterführende technische
Diagnostikverfahren . . . . . . . . . . . . 247
9 Schlafstörungen 10.3 Therapie
Peter Young und Anna Heidbreder . . 223 Katja Werheid . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
9.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 10.3.1 Nichtpharmakologische
9.2 Insomnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 Interventionen . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
+21881_Zettl.indb XIX 19.09.2018 07:22:47XX Inhaltsverzeichnis
10.3.2 Antidementive Pharmakotherapie . . 253 12.4 Autonomes Nervensystem
10.3.3 Krankheitsmodifizierende Therapie . 255 und Schlaganfall . . . . . . . . . . . . . . 283
10.3.4 Therapie von neuropsychiatrischen 12.5 Autonome Störungen und Schlaf . . 283
Symptomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 12.6 Neues zu therapeutischen und
10.3.5 Dyadische Betrachtung . . . . . . . . . . 259 diagnostischen Möglichkeiten . . . . 284
10.4 Prophylaxe und Prävention . . . . . . 260 12.6.1 Midodrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
12.6.2 Droxidopa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
11 Polyneuropathien 12.6.3 Donepezil-PET . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Christian Bischoff und 12.6.4 Hautbiopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Wilhelm Schulte-Mattler . . . . . . . . . 267 12.6.5 Fragebogen zur orthostatischen
11.1 Leitsymptome . . . . . . . . . . . . . . . . 267 Hypotonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
11.2 Häufigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
11.3 Ursachen und Einteilung . . . . . . . . 268 13 Schmerz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
11.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Walter Zieglgänsberger
11.4.1 Klinische Befunde . . . . . . . . . . . . . . 270 und Herta Flor . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
11.4.2 Elektrophysiologische 13.1 Nozizeption und Schmerz . . . . . . . 290
Untersuchungen . . . . . . . . . . . . . . . 270 13.2 Funktionelle und strukturelle
11.4.3 Labordiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . 271 Veränderungen –
11.4.4 Genetische Untersuchungen . . . . . . 271 neuronale Plastizität . . . . . . . . . . . 290
11.4.5 Liquoruntersuchung . . . . . . . . . . . . 272 13.2.1 Akuter Schmerz . . . . . . . . . . . . . . . 291
11.4.6 Biopsie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 13.2.2 Nozizeptiver Schmerz . . . . . . . . . . . 291
11.5 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 13.2.3 Neuropathischer Schmerz . . . . . . . . 291
11.5.1 Diabetische Neuropathie . . . . . . . . . 273 13.2.4 Mixed Pain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
11.5.2 Entzündliche Neuropathien . . . . . . . 273 13.2.5 Akuter versus chronischer Schmerz . . 293
11.5.3 Neuropathien bei bestimmten 13.2.6 Chronischer Schmerz und Stress . . . 294
hereditären Erkrankungen . . . . . . . . 274 13.3 Physiologie der Nozizeption . . . . . . 295
11.5.4 Symptomatische Therapie . . . . . . . . 274 13.3.1 Afferente Fasern . . . . . . . . . . . . . . . 295
13.3.2 Nozizeptoren . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
12 Autonomes Nervensystem 13.3.3 Spannungsgesteuerte
Carl-Albrecht Haensch Natriumkanäle . . . . . . . . . . . . . . . . 296
und Anke Lührs . . . . . . . . . . . . . . . . 277 13.3.4 Veränderungen
12.1 Vegetative Diagnostik . . . . . . . . . . 278 im peripheren Gewebe . . . . . . . . . . 296
12.2 Posturales orthostatisches 13.3.5 Neurotransmitter . . . . . . . . . . . . . . 299
Tachykardiesyndrom . . . . . . . . . . . 279 13.3.6 Spinofugal projizierende Neurone . . 300
12.2.1 Magenentleerungsstörungen 13.3.7 WDR-Neurone . . . . . . . . . . . . . . . . 300
bei POTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 13.3.8 Rezeptive Felder . . . . . . . . . . . . . . . 301
12.2.2 Schlaf bei POTS . . . . . . . . . . . . . . . . 280 13.3.9 Deszendierende Bahnsysteme . . . . . 302
12.2.3 Genetik und Immunologie . . . . . . . . 280 13.3.10 „Gating“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302
12.3 Parkinson-Syndrome . . . . . . . . . . . 280 13.3.11 Antichronifizierungssysteme . . . . . . 303
12.3.1 Orthostatische Hypotonie . . . . . . . . 281 13.3.12 Dendriten und Spines . . . . . . . . . . . 303
12.3.2 Olfaktorische Störungen 13.3.13 Gliazellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304
bei Parkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 13.4 Konsequenzen für
12.3.3 Darmmotilitätsstörungen Klinik und Praxis . . . . . . . . . . . . . . 304
bei Parkinson . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 13.4.1 Operante Konditionierung
12.3.4 Liegendhypertonie . . . . . . . . . . . . . . 282 und belohnungsrelevante
12.3.5 Multisystematrophie (MSA) . . . . . . . 282 neuronale Schaltkreise . . . . . . . . . . 304
+21881_Zettl.indb XX 19.09.2018 07:22:47Inhaltsverzeichnis XXI
13.4.2 Schmerzgedächtnis . . . . . . . . . . . . . 305 14.5.3 Externe Ventrikeldrainage
13.4.3 Re-Learning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 bei bakterieller Meningitis . . . . . . . . 326
13.4.4 Angstgeprägte Erwartungshaltung . . 309 14.5.4 Kortikosteroide bei
13.4.5 Placebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 bakterieller Meningitis . . . . . . . . . . . 327
13.4.6 Schlaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 14.6 Intensivmanagement des
13.4.7 Transkranielle Stimulation . . . . . . . . 310 Status epilepticus . . . . . . . . . . . . . . 327
13.4.8 Perioperative Schmerztherapie . . . . 310 14.6.1 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
13.4.9 Cannabinoide – Endocannabinoide 311 14.6.2 Posthypoxischer Status myoclonicus . 328
14.7 Neuromuskuläre Erkrankungen . . . 328
14 Neurologische 14.7.1 Guillain-Barré-Syndrom (GBS) . . . . . 328
Intensivmedizin 14.7.2 Myasthene Krise . . . . . . . . . . . . . . . 329
Elmar Höfner, Jörg Berrouschot 14.8 Hirntoddiagnostik . . . . . . . . . . . . . 329
und Jörg Weber . . . . . . . . . . . . . . . . 317
14.1 Neurointensivmedizin – 15 Epilepsien
warum und wie? . . . . . . . . . . . . . . 319 Andreas Schulze-Bonhage . . . . . . . . 335
14.1.1 Patientenmanagement 15.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336
und Basismaßnahmen . . . . . . . . . . . 319 15.2 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
14.1.2 Neuromonitoring und 15.3 Inzidenz und Prävalenz . . . . . . . . . 338
konservative Therapie des 15.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
erhöhten intrakraniellen Drucks . . . . 320 15.4.1 Anamnese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
14.2 Intensivmanagement 15.4.2 Apparative Diagnostik . . . . . . . . . . . 339
des ischämischen Schlaganfalls . . . 321 15.4.3 Weitere Untersuchungen . . . . . . . . . 341
14.2.1 Oxygenierung, 15.5 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Ventilation, Atemwege . . . . . . . . . . 321 15.5.1 Pharmakotherapie . . . . . . . . . . . . . . 342
14.2.2 Dekompressive Hemikraniektomie . . 322 15.5.2 Anfallsprophylaxe . . . . . . . . . . . . . . 343
14.2.3 Intensivmedizinische 15.5.3 Therapie des Status epilepticus . . . . 345
Maßnahmen bei raumfordernden 15.5.4 Epilepsiechirurgie . . . . . . . . . . . . . . 346
Kleinhirninfarkten . . . . . . . . . . . . . . 322 15.5.5 Stimulationsbehandlung . . . . . . . . . 346
14.2.4 Temperaturmanagement 15.5.6 Diätetische Behandlung . . . . . . . . . . 347
bei ischämischen Infarkten . . . . . . . 323 15.5.7 Immunologische Behandlung . . . . . . 347
14.3 Intensivmanagement der spontanen 15.6 Komorbiditäten . . . . . . . . . . . . . . . 347
intrazerebralen Blutung . . . . . . . . . 323 15.7 Sozialmedizinische Aspekte . . . . . . 347
14.3.1 Blutdruckmanagement . . . . . . . . . . 323
14.3.2 Blutungen unter Antikoagulation . . . 323 16 Neuroinfektiologie . . . . . . . . . . . 351
14.3.3 Neurochirurgische Versorgung . . . . . 324 Uta Meyding-Lamadé und
14.4 Intensivmanagement der spontanen Eva-Maria Craemer . . . . . . . . . . . . . 351
Subarachnoidalblutung . . . . . . . . . 324 16.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
14.4.1 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 16.1.1 Bakterielle Meningitis . . . . . . . . . . . 352
14.4.2 Akutbehandlung . . . . . . . . . . . . . . . 324 16.1.2 Virale Meningitis/
14.5 Entzündliche ZNS-Erkrankungen . . 325 Meningoenzephalitis . . . . . . . . . . . . 353
14.5.1 Epidemiologische Aspekte mit 16.2 Bakterielle Erkrankungen . . . . . . . . 353
Bedeutung für 16.2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
die Neurointensivmedizin . . . . . . . . 325 16.2.2 Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
14.5.2 Induzierte Hypothermie bei 16.2.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
schwerer bakterieller Meningitis . . . 326 16.2.4 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
16.3 Hirnabszess . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
+21881_Zettl.indb XXI 19.09.2018 07:22:48XXII Inhaltsverzeichnis
16.3.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 17.3.3 Charcot-Marie-Tooth-Neuropathie . . 381
16.3.2 Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 17.3.4 Mitochondriale Erkrankungen . . . . . 381
16.3.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 17.4 Therapeutische Relevanz
16.3.4 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 der Neurogenetik . . . . . . . . . . . . . . 382
16.4 Neuroborreliose . . . . . . . . . . . . . . . 358 17.4.1 Früher und gezielter
16.4.1 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 Therapiebeginn . . . . . . . . . . . . . . . . 382
16.4.2 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 17.4.2 Ansätze kausaler Therapie
16.4.3 Prognose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 bei genetischen Erkrankungen
16.5 Tuberkulose/tuberkulöse – aktuelle Entwicklungen
Meningitis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 und Beispiele . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
16.5.1 Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360 17.4.3 Ausblick: ethische
16.5.2 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 und rechtliche Herausforderungen . . 386
16.5.3 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
16.5.4 Komplikationen . . . . . . . . . . . . . . . 362 18 Funktionelle Störungen
16.6 Virale Erkrankungen des ZNS . . . . 362 (Psychosomatik) . . . . . . . . . . . . . 389
16.6.1 Klinik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 Karina Limburg, Anna Furmaniak
16.6.2 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 und Peter Henningsen . . . . . . . . . . 389
16.6.3 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 18.1 Psychosomatik und
16.7 Ausgewählte virale Neurologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
Infektionen des ZNS . . . . . . . . . . . . 364 18.1.1 Welche Formen von „Psychosomatik
16.7.1 Herpes-simplex- in der Neurologie“ gibt es und
Virus-Enzephalitis (HSVE) . . . . . . . . 364 wie häufig sind sie? . . . . . . . . . . . . 390
16.7.2 Frühsommer- 18.1.2 Ätiologie psychosomatischer
Meningoenzephalitis (FSME) . . . . . . 366 Störungsbilder in der Neurologie . . . 392
16.7.3 Enterovirusenzephalitis . . . . . . . . . . 368 18.2 Störung mit funktionellen
16.7.4 Akute Masernenzephalitis . . . . . . . . 368 neurologischen Symptomen/
16.7.5 Subakute sklerosierende dissoziative Störungen . . . . . . . . . 393
Panenzephalitis (SSPE) . . . . . . . . . . 368 18.2.1 Terminologie und Klassifikation . . . . 393
16.6.6 Emerging Viruses . . . . . . . . . . . . . . . 369 18.2.2 Erscheinungsformen und
klinisch-neurologische Diagnose . . . 393
17 Neurogenetik 18.2.3 Psychoneurobiologische Modelle
Christiane Neuhofer, Thomas Gasser von dissoziativen Störungen . . . . . . 395
und Thomas Klopstock . . . . . . . . . . 373 18.2.4 Therapiestudien und Prognose
17.1 Grundlagen der Genetik . . . . . . . . 374 bei dissoziativen Störungen . . . . . . . 395
17.1.1 Das menschliche Genom . . . . . . . . . 374 18.3 Somatoforme/andere funktionelle
17.1.2 Gendefekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 Störungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
17.1.3 Vererbung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 18.3.1 Was ist gemeint? . . . . . . . . . . . . . . 396
17.1.4 Genotyp-Phänotyp-Korrelation . . . . 376 18.3.2 Wichtige Essentials zu somatoformen/
17.2 Molekulargenetische Diagnostik . . 378 funktionellen Störungen . . . . . . . . . 397
17.2.1 Gendiagnostik-Gesetz . . . . . . . . . . . 378 18.3.3 Neurologisch wichtige somatoforme/
17.2.2 Genetische Beratung . . . . . . . . . . . . 378 funktionelle Syndrome . . . . . . . . . . . 398
17.2.3 Methoden und Durchführung 18.3.4 Neue therapeutische Ansätze für die
der genetischen Diagnostik . . . . . . . 379 Behandlung funktioneller/
17.3 Spezielle Neurogenetik . . . . . . . . . 380 somatoformer Störungen . . . . . . . . . 399
17.3.1 Bewegungsstörungen . . . . . . . . . . . 380
17.3.2 Motoneuronerkrankungen . . . . . . . . 381
+21881_Zettl.indb XXII 19.09.2018 07:22:48Inhaltsverzeichnis XXIII
18.4 Psychische/psychosomatische 21 Neurogeriatrie
Komorbidität bei neurologischen Richard Dodel . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . 399 21.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
18.5 Diagnostik und Therapie 21.2 Geriatrisches Assessment . . . . . . . . 437
psychosomatischer Störungen 21.2.1 Interdisziplinäre Behandlung im
in der Neurologie . . . . . . . . . . . . . . 400 geriatrischen Team . . . . . . . . . . . . . 438
21.2.2 Grundlagen der Arzneimitteltherapie
19 Grundzüge bei älteren Patienten . . . . . . . . . . . . 438
der Neurorehabilitation . . . . . . . 405 21.2.3 Pharmakologisch relevante
Peter Flachenecker . . . . . . . . . . . . . 405 Altersveränderungen . . . . . . . . . . . . 439
19.1 Definitionen und Grundlagen . . . . . 406 21.2.4 Intellektueller Abbau . . . . . . . . . . . . 440
19.1.1 Gesetzliche Grundlagen . . . . . . . . . 406 21.2.5 Immobilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
19.1.2 Kostenträger und Zugangswege . . . 407 21.2.6 Sarkopenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
19.1.3 Phasenmodell der 21.2.7 Frailty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Neurorehabilitation . . . . . . . . . . . . . 408 21.2.8 Instabilität . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
19.1.4 ICF und ICF Core Sets . . . . . . . . . . . 408
19.2 Neuronale Plastizität . . . . . . . . . . . 409 22 Diagnostische Verfahren . . . . . . 451
19.3 Berufsgruppen und Methoden . . . . 410 22.1 Neuropsychologische Diagnostik
19.3.1 Ärzte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 am Beispiel der Multiplen Sklerose
19.3.2 Pflege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 Iris-Katharina Penner . . . . . . . . . . . . 452
19.3.3 Physiotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . 411 22.1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
19.3.4 Ergotherapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 22.1.2 Neuropsychologie der MS . . . . . . . . 452
19.3.5 Neuropsychologie und Psychologie . 412 22.1.3 Wissenswertes zu kognitiven
19.3.6 Logopädie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 Teilleistungsstörungen bei MS . . . . . 453
19.3.7 Sozialdienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412 22.1.4 Kognitives Kerndefizit . . . . . . . . . . . 453
19.4 Indikationsspezifische 22.1.5 Auswirkungen kognitiver
Rehabilitation . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Teilleistungsstörungen . . . . . . . . . . . 453
19.4.1 Rehabilitation des Schlaganfalls . . . 413 22.1.6 Ursachen für kognitive
19.4.2 Rehabilitation der Multiplen Teilleistungsstörungen bei MS . . . . . 454
Sklerose (MS) . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 22.1.7 Diagnostik kognitiver
Teilleistungsstörungen . . . . . . . . . . . 454
20 Leukodystrophien 22.1.8 Therapie der kognitiven Defizite . . . . 457
Wolfgang Köhler . . . . . . . . . . . . . . . 419 22.2 Sonografie
20.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419 Uwe Walter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
20.2 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 22.2.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462
20.3 Klinisches Bild . . . . . . . . . . . . . . . . 423 22.2.2 Akutdiagnostik des Schlaganfalls . . . 463
20.4 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 22.2.3 Stenosegraduierung
20.4.1 Radiologische Diagnostik . . . . . . . . 425 hirnversorgender Arterien . . . . . . . . 466
20.4.2 Biochemische und 22.2.4 Diagnose des zerebralen
molekulargenetische Diagnostik . . . 429 Zirkulationsstillstands . . . . . . . . . . . 467
20.5 Differenzialdiagnostik . . . . . . . . . . 429 22.2.5 Transkranielle B-Bild-Sonografie . . . 468
20.6 Behandlung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 22.2.6 Sonografie der N.-opticus-Scheide . . 468
20.6.1 Symptomatische Therapien . . . . . . . 430 22.2.7 Sonografie der Nerven und
20.6.2 Metabolische Therapien . . . . . . . . . . 430 Muskeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
20.6.3 Zellbasierte Therapien . . . . . . . . . . . 431 22.3 Liquoranalytik
Hayrettin Tumani und Manfred Uhr . . 470
+21881_Zettl.indb XXIII 19.09.2018 07:22:48XXIV Inhaltsverzeichnis
22.3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 471 23.3.1 Verstehen Patienten evidenzbasierte
22.3.2 Indikation für Liquoranalytik und Informationen und sind
Gewinnung des Liquors . . . . . . . . . . 471 diese hilfreich? . . . . . . . . . . . . . . . . 487
22.3.3 Fragestellung in der Liquoranalytik, 23.3.2 Können evidenzbasierte
Analytikstufen, Parameter, Methoden Patienteninformationen
und Befunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 (EBPI) schaden? . . . . . . . . . . . . . . . 488
22.3.4 Bakterielle Infektionen . . . . . . . . . . 476 23.4 SDM in der Neurologie . . . . . . . . . . 488
22.3.5 Neuroborreliose . . . . . . . . . . . . . . . 476 23.4.1 Welche Entscheidungen in der
22.3.6 Virale Infektionen . . . . . . . . . . . . . . 477 Neurologie sind prädestiniert
22.3.7 Liquorbefund bei MS . . . . . . . . . . . . 478 für SDM? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
22.3.8 Neurochemische 23.4.2 Wollen Patienten in
Demenzdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . 479 der Neurologie SDM? . . . . . . . . . . . 491
22.3.9 Differenzialdiagnosen und Fazit . . . . 479 23.4.3 Wollen Ärzte SDM? . . . . . . . . . . . . . 493
23.4.4 Was wissen Patienten in
23 Arzt-Patienten-Beziehung der Neurologie? . . . . . . . . . . . . . . . 493
in der Neurologie 23.5 SDM in der Praxis . . . . . . . . . . . . . 495
Christoph Heesen, Anne Rahn 23.5.1 Lässt sich SDM lernen? . . . . . . . . . . 495
und Insa Schiffmann . . . . . . . . . . . . 483 23.5.2 Nebenwirkungen von SDM . . . . . . . 495
23.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484 23.5.3 Macht SDM gesünder? . . . . . . . . . . 496
23.2 Die Arzt-Patienten-Beziehung 23.6 Was fehlt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
im Wandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484
23.3 Das Konzept Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
des Shared Decision Making . . . . . 485
Anhang Farbtafel . . . . . . . . . . . . 509
+21881_Zettl.indb XXIV 19.09.2018 07:22:48KAPITEL Immunmediierte Erkrankungen
des Nervensystems
5 (unter Einschluss der kongenitalen
Myasthenie-Syndrome)
5.1 Multiple Sklerose und verwandte Krankheitsbilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
5.1.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.1.2 Multiple Sklerose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
5.1.3 Neuromyelitis optica (Devic-Syndrom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.2.1 Assoziierte Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.2 Pathogenese/Pathophysiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
5.2.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
5.2.4 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5.3 Peripheres Nervensystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
5.3.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.3.2 Guillain-Barré-Syndrom (GBS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.3.3 Chronische inflammatorische demyelinisierende Polyneuropathie (CIDP) . . . . . . . . . . . . . . . 131
5.3.4 Multifokale motorische Neuropathie (MMN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.3.5 Paraproteinämische Neuropathie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
5.3.6 Nichtsystemische vaskulitische Neuropathie (NSVN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
5.4 Myasthenia gravis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.4.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
5.4.2 Einteilung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.4.3 Diagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
5.4.4 Assoziierte Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
5.4.5 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
5.5 Angeborene Störungen der neuromuskulären
Signalübertragung: kongenitale Myasthenie-Syndrome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.5.1 Klinisches Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
5.5.2 Zusatzdiagnostik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.5.3 Therapie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.6 Idiopathische inflammatorische Myopathien
und seltene Myositiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5.6.1 Einführung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.6.2 Idiopathische inflammatorische Myopathien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
5.6.3 Einteilung und Klassifikation der Myositiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
5.6.4 Seltene Myositiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
+21881_Zettl.indb 91 19.09.2018 07:22:56118 5 Immunmediierte Erkrankungen des Nervensystems
Weinshenker BG. The natural history of multiple sclerosis: exchange in secondary progressive MS. Neurology 2006;
update 1998. Semin Neurol 1998; 18 (3): 301–307. 67 (8): 1515–1516.
Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL et al. International Zettl UK, Hecker M, Aktas O, Wagner T, Rommer PS. Inter-
consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica feron β-1a and β-1b for patients with multiple sclerosis:
spectrum disorders. Neurology 2015; 85 (2): 177–189. updates to current knowledge. Expert Rev Clin Immunol
Wingerchuk DM, Lennon VA, Pittock SJ, Lucchinetti CF, 2018; 14 (2): 137–153.
Weinshenker BG. Revised diagnostic criteria for neuro- Zettl UK, Tumani H. Multiple sclerosis & cerebrospinal fluid.
myelitis optica. Neurology 2006; 66 (10): 1485–1489. Oxford: Blackwell Publishing Ltd; 2005.
Winkelmann A, Löbermann M, Reisinger EC, Zettl UK. Mul- Ziemssen T, Ashtamker N, Rubinchick S, Knappertz V, Comi
tiple Sklerose und Infektionskrankheiten. Akt Neurol G. Long-term safety and tolerability of glatiramer acetate
2011; 38 (07): 339–350 20 mg/ml in the treatment of relapsing forms of multiple
Zettl UK, Hartung HP, Pahnke A, Brueck W, Benecke R, sclerosis. Expert Opin Drug Saf 2017; 16 (2): 247–255.
Pahnke J. Lesion pathology predicts response to plasma
5.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung
Lutz Harms
Wichtige Neuigkeiten auf einen Blick
• Es gibt zunehmend Belege für die pathophysio- • Es gibt Hinweise für die Heterogenität der Er-
5 logische Rolle der anti-GAD- sowie anderer Au- krankung und auf Zusammenhänge zwischen
toantikörper. Antikörpertzyp und Phänotyp der Erkrankung.
• Neue Autoantikörper gegen prä- und postsyn- • Berichte über neue therapeutische Optionen be-
aptische Zielantigene inhibitorischer Synapsen treffen:
wurden identifiziert. – Rituximab
• Die genaue Pathophysiologie des Stiff-Person- – Autologe Stammzelltherapie
Syndroms ist weiterhin nicht völlig geklärt.
Das Stiff-Person-Syndrom (SPS) ist eine sehr seltene Leitsymptome
immunvermittelte Erkrankung, die das ZNS und das SPSSE
Endokrinium betrifft. Die Erstbeschreibung des • Kernsymptome:
Krankheitsbildes erfolgte 1956 durch Moersch und – Fortschreitende rigide Steigerung des Mus-
Woltmann. Die Reduzierung der Symptome mittels keltonus
Diazepam wurde 1963 erwähnt (Howard 1963). – Einschießende schmerzhafte Muskelverstei-
1988 konnte ein Zusammenhang mit anti-GAD-An- fungen, getriggert durch externe (akustisch,
tikörpern (GAD = Glutamat-Dekarboxylase) aufge- taktil, visuell) oder emotionale Stimuli
deckt und somit die Immunpathogenese nahegelegt • Fakultative Symptome:
werden (Solimena et al. 1988). Damit war der Weg – Gangstörungen, Sturzneigung, Skelettdefor-
für Immuntherapien bereitet. Die Entdeckung wei- mierungen (Füße, Hyperlordose)
terer Antikörper folgte. – Adrenerge autonome Dysregulation
Um der Komplexität der Erkrankung gerecht zu – Psychische Symptome wie Depression, Angst-
werden und angesichts der Manifestation verschiede- störungen und Phobien (z. B. Agoraphobie)
ner Varianten, spricht man auch von der Stiff-Person- • PERM: zusätzlich Myoklonien, Augenbewe-
Syndrom-Spektrum-Erkrankung (SPSSE; › Tab. 5.6). gungsstörungen, Pyramidenbahnzeichen,
Ataxie, Trismus, Paresen und epileptische An-
fälle möglich, gelegentlich intermittierend
+21881_Zettl.indb 118 19.09.2018 07:22:585.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung 119
Tab. 5.6 SPSSE – Übersicht zum Krankheitsbild Mit „Stiff-Person-Syndrom“ wird eine heterogene
Definition Heterogene Manifestation einer Autoim- Gruppe von Autoimmunerkrankungen bezeichnet,
munerkrankung mit gestörter Inhibition die durch die gemeinsame Kernsymptomatik (s. o.)
auf kortikaler oder spinaler Ebene. Hier- gekennzeichnet ist, sich aber durch Manifestation,
durch typische, aber variable Symptoma- Lokalisation der betroffenen Körperregion, Antikör-
tik mit zunehmender Muskelsteifigkeit perpräsenz und -art, Verlauf und Prognose, assozi-
und schmerzhaften Muskelkrämpfen,
emotional oder durch äußere Reize ge-
ierte Immunerkrankung oder zugrunde liegende
triggert. Häufig endokrinologische und Tumorerkrankung unterscheidet.
psychiatrische Symptome. Neben der klassischen Form des SPS werden nach
Varianten • „Vollbild“ Stiff-Person-Erkrankung der klinischen Manifestation weitere Varianten un-
• „Minusvariante“ Stiff-Limb-Syndrom terschieden: das fokale oder segmentale SPS (Stiff-
• „Plusvariante“ progressive Enzephalo- Limb-Syndrom, SLS), das „Jerking“ SPS und die
myelitis mit Rigidität und Myoklonien progressive Enzephalomyelitis mit Rigidität und
(PERM) Myoklonus (PERM). Die Erkrankung beginnt meis-
Pathophy- • Immunvermittelt/autoimmun: überwie- tens mit intermittierender Steifigkeit. Typisch ist
siologie gend Autoantikörper gegen GAD65, später eine fluktuierende, auch schmerzhafte Rigidi-
seltener gegen Amphiphysin oder GlyR tät der axialen und Extremitätenmuskulatur, ver-
(Glycinrezeptor), sehr selten gegen
weitere Antigene
bunden mit Muskelspasmen oder Myoklonien, oft
• Teilweise paraneoplastisch (ca. 10%), Stimulus-assoziiert (Geräusche, taktile Reize, z. B.
bes. bei Mamma- oder Bronchialkarzi- auch Kältespray und visuelle Reize). Emotionale As- 5
nomen auftretend, dann gehäuft anti- pekte können die Ausprägung beeinflussen. Durch
Amphiphysin-AK oder anti-GlyR-AK die Kontraktion antagonistischer Muskeln kommt
Manifestati- • Mittleres Lebensalter, 30–50 Jahre es zu Bewegungseinschränkungen, verlangsamten
onsalter • Frauen häufiger betroffen Bewegungsabläufen, oft verbunden mit Stürzen und
• Sehr selten in der Kindheit, Säuglings- Hypertrophie der Muskulatur. Die Symptomatik be-
alter möglich (Stiff-Baby-Syndrom) fällt bei der klassischen Form zunächst die axiale
Diagnostik • Klinische Kriterien Muskulatur und dehnt sich über die proximalen Ex-
• Elektrophysiologie tremitäten nach distal aus. Die axiale Muskelan-
• Serologie: Antikörpernachweis (20–
30% negativ)
spannung kann eine ausgeprägte Hyperlordose ver-
ursachen (› Abb. 5.3). Daneben kann es zu Defor-
Prognose variabel, unbestimmter Verlauf, plötzli-
mitäten verschiedener Gelenke kommen.
che Verschlechterungen möglich, auch
lebensbedrohliche Situationen
Therapeuti- • Symptomatisch
sche Optio- • Immunmodulation/- suppression
nen • Physiotherapie
• Orthopädisch
• Verhaltenstherapeutische Ansätze
• Tumortherapie bei paraneoplastischer
Genese
Wichtige EFNS Guidelines for the use of intrave-
Leitlinien nous immunoglobulin in treatment of
neurological diseases. EFNS task force on
the use of intravenous immunoglobulin
in treatment of neurological diseases
(Elovaaraa et al. 2008)
Deutsche Gesellschaft für Neurologie: Stiff-
Man-Syndrom (www.dgn.org/leitlinien/
3476-030-080-stiff-man-syndrom-stiff-
person-syndrom ; Meinck et al. 2017) Abb. 5.3 Hyperlordose
+21881_Zettl.indb 119 19.09.2018 07:22:58120 5 Immunmediierte Erkrankungen des Nervensystems
Tab. 5.7 Symptome bei 138 Patienten mit SPSSE
Symptom Häufigkeit
Gangstörung 87%
Angstattacken 65%
Skelettdeformierungen 63%
gesteigerte Erschreckbarkeit 61%
gesteigerte Eigenreflexe 59%
autonome Krisen 54%
Kopfretraktionsreflex 44%
erloschene Bauchhautreflexe 33%
Fehldiagnose psychogene Störung 78%
Augenbewegungsstörung 20%
Dysarthrie/Dysphagie 15%
positives Babinski-Zeichen 13%
Parese 12%
neuropsychologische Störung 11%
Ataxie 11%
5 Nystagmus 8%
Blasenentleerungsstörung 6%
Epilepsie 6%
Autoimmunretinopathide 1%
Die Vielfalt der Befunde und Symptome geht aus
einer Aufstellung von Meinck (2013) hervor
Abb. 5.4 Myelonaffektion bei paraneoplastischem SPS
(› Tab. 5.7).
Die Inzidenz der SPSSE wird auf 1:1 Mio. geschätzt
(Dalakas et al. 2000). Das mittlere Erkrankungsalter Speziell bei der PERM können assoziierte Symp-
liegt bei 30–50 Jahren (Martinez-Hernandez et al. tome wie Gangataxie, Dysarthrie und Augenbewe-
2016) mit breiter Streuung. Auch Kinder können gungsstörungen auftreten. Die Gesichtsmuskulatur
schon erkranken, sehr selten Neugeborene. Zu ca. kann betroffen sein; eine Kiefersperre durch Beteili-
zwei Dritteln sind Frauen betroffen. Vereinzelt wird gung des M. masseter wurde beschrieben. Störungen
eine familiäre Häufung beschrieben (Burn et al. der Sensibilität gehören nicht zum SPSSE.
2003; Sander et al. 1980; Xiao et al 2015). Selten werden bei der SPSSE Störungen der Mikti-
In ca. 10% der Fälle findet sich eine paraneoplas- on (z. B. Harnverhalt) oder anorektale Spasmen und
tische Genese. Dieser Form liegen zumeist Mam- Konstipation beobachtet (Dumitrascu et al. 2016).
ma- oder Bronchialkarzinome zugrunde, oft ein- Häufig finden sich psychiatrische Symptome wie
hergehend mit anti-Amphiphysin-Antikörpern, Angst, Depression, Alkoholmissbrauch und ver-
gelegentlich auch mit anti-GlyrR-Antikörpern. Im schiedene Phobien (Hennigsen et al. 2003; Tinsley et
Gegensatz zur klassischen Variante sind dann be- al. 1997).
sonders die oberen Extremitäten betroffen, gele- Prognostisch besteht eine breite Varianz. Wäh-
gentlich findet sich eine im MRT darstellbare Af- rend viele Patienten unter adäquater Therapie lange
fektion des zervikalen Myelons (› Abb. 5.4, Zeit arbeitsfähig bleiben, erleiden andere eine
› Abb. 5.5; Antoine et al. 1999; Faissner et al. schnell zunehmende Behinderung.
2016; Schmierer et al. 1998).
+21881_Zettl.indb 120 19.09.2018 07:22:585.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung 121
Tab. 5.8 Mit SPSSE assoziierte Erkrankungen (Burns
et al. 2005; Dalakas et al. 2000)
Typ-1-Diabetes
Hashimoto-Thyreoiditis
Perniziöse Anämie
Basedow-Erkrankung
Zöliakie
Vitiligo
mittelten Syndromen assoziiert, so mit zerebellärer
Ataxie, Epilepsie, Augenbewegungsstörungen oder
limbischer Enzephalitis.
Daneben kommen als Ausdruck der immunologi-
schen Dysfunktion weitere Antikörper wie antinuk-
leäre AK, anti-Thyreoid-AK, Anti-RNP, anti-Glia-
din-AK oder anti-Belegzellen-AK ohne Bezug zur
Erkrankung vor (Dalakas et al. 2000).
5
5.2.2 Pathogenese/Pathophysiologie
Abb. 5.5 Paraneoplastisch bedingtes SLS mit eingeschränktem
Dem Krankheitsbild liegt eine Übererregbarkeit des
Bewegungsradius bei Steifigkeit des Armes neuromuskulären Systems zugrunde. Hierfür finden
sich Hinweise auf kortikaler und spinaler Ebene
ACHTUNG (Kim et al. 2012), vermutlich durch Störung inhibi-
Gefährdende Komplikationen torischer Neurone mit der Enthemmung nervaler
Schwere, auch lebensbedrohliche Komplikationen des Erregung.
SPS (cave: Medikamentenentzug bzw. -unterbrechung, Die Ursache der SPSSE ist nicht völlig geklärt; eine
speziell Benzodiazepine oder intrathekales Baclofen): immunvermittelte Genese ist aber hinreichend belegt,
• Dysautonome Krisen
• Muskelspasmen mit Ateminsuffizienz
so durch die Übertragbarkeit der Symptome durch
• Ösophageale Obstruktion (cricopharyngeale Muskel- IgG von Patienten auf Labortiere (Geis et al. 2011;
spasmen) Hansen et al. 2013). Bei ca. 60% der Patienten mit
• Verletzungen durch Stürze SPSSE finden sich im Serum und Liquor Antikörper
(Jachiet et al. 2016; Mitsumoto et al. 1991; Quereshi et gegen das intraneurale Enzym Glutamat-Dekarboxy-
al. 2012) lase (GAD; Dalakas et al. 2001). GAD ist an der Pro-
duktion des am stärksten inhibitorisch wirkenden
GABA in Hirn und Rückenmark beteiligt. Es kataly-
5.2.1 Assoziierte Erkrankungen siert die Decarboxylierung von L-Glutamat zu GABA.
Von den beiden Isoformen GAD65 und GAD67 ist
Da die SPSSE häufig (in bis zu 70%) mit anderen au- nur Erstere in die Synthese des inhibitorischen GABA
toimmunologischen Erkrankungen assoziiert ist, soll- einbezogen, vor allem wenn eine schnelle Synthese
te gezielt nach diesen gesucht werden (› Tab. 5.8). benötigt wird (Roth und Draguhn 2012).
Etwa ein Drittel der SPS-Patienten mit anti-GAD- Eine aktuelle Frage ist, inwieweit SPSSE und asso-
Antikörpern entwickelt einen Typ-1-Diabetes. An- ziierte Syndrome einen gemeinsamen pathogeneti-
dererseits erkranken Patienten mit einem Typ-1-Di- schen Mechanismus teilen (Alexopoulos und Dala-
abetes aber nur selten an SPSSE. Anti-GAD-Antikör- kas 2013). Ebenso ist die Rolle von T-Zellen bei der
per wiederum sind auch mit weiteren immunver- Erkrankung Gegenstand der Forschung.
+21881_Zettl.indb 121 19.09.2018 07:22:59122 5 Immunmediierte Erkrankungen des Nervensystems
präsynaptisches
Neuron
Endozytose
Glutamat
GAD
GABA
Glycin
Amphiphysin
Glycin- GABA(A)-
rezeptor Rezeptor
Zytoskelett
Gephyrin GABARAP
5
Cl– Cl–
Abb. 5.6 Prä- und postsynapti-
postsynaptisches
Neuron sche Antigene sowie Autoantikör-
per an inhibitorischen Synapsen
Es verdichten sich die Hinweise, dass weitere, erst paraneoplastische Ursache aufweisen. Diese Patien-
in jüngerer Zeit charakterisierte, mit der SPSSE as- ten respondieren in der Regel gut auf Steroide und
soziierte Proteine der prä- oder postsynaptischen Plasmapherese sowie ggf. die Tumortherapie.
inhibitorischen Synapsen als Target einer immun- In einer größeren retrospektiven Analyse wurden
vermittelten Reaktion dienen (› Abb. 5.6). neben den mit 43% am häufigsten vorhandenen An-
Neben den klassischen Antikörpern gegen GAD tikörpern gegen GAD65 bei 19,8% gegen GlyR und
und Amphiphysin finden sich AK gegen GlyR, GlyT1 bei nur 4,1% gegen andere inkl. Amphiphysin ge-
und GlyT2 (Glycin-Transporter 1 und 2), DPPX (Di- richtete Antikörper gefunden, 33,1% der Patienten
peptidyl-Peptidase-Like Protein-6), GABAAR waren Antikörper-negativ (Martinez-Hernandez et
(Gamma-Aminobuttersäure-Typ-A-Rezeptor) und al. 2016). Kombinationen fanden sich in nur weni-
Gephyrin. gen Fällen. In 3 von 26 Patienten (11,5%) ließen sich
Diskutiert wird gegenwärtig, inwieweit die Prä- die anti-GAD65-Antikörper ausschließlich im Li-
senz spezieller Autoantikörper den Phänotyp der quor nachweisen, bei 6 von 14 Patienten (42,8%) die
SPSE prägt, ob hier gar einzelne Entitäten abzugren- anti-GlyR-Antikörper nur im Serum. In 2,4% ließen
zen oder differente therapeutische Ansätze abzulei- sich in neuronalen Zellkulturen unbekannte Anti-
ten sind. körper gegen Zelloberflächenantigene detektieren.
Bekannt ist, dass 80% der Patienten mit einem Während die anti-GAD65-Antikörper-positiven
Nachweis von Antikörpern gegen Amphiphysin eine und die -negativen Patienten häufiger ein klassi-
+21881_Zettl.indb 122 19.09.2018 07:22:595.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung 123
sches SPS entwickelten, erkrankten die anti-GlyR- Tab. 5.9 Diagnostische Kriterien der SPSSE (nach Da-
Antikörper-positiven Patienten häufiger an einem lakas et al. 2009)
SPS-plus-Syndrom. Bei den anti-GAD65-AK-positi- Hauptkriterien
ven Patienten war häufiger das weibliche Geschlecht 1. Steifigkeit der axialen und Extremitätenmuskulatur,
betroffen und es traten öfter zusätzlich systemische durch Beteiligung der abdominalen und thorakolum-
autoimmune oder endokrinologische Störungen auf. balen paraspinalen Muskeln fixierte Deformität (Hy-
Bei anti-GlyR-AK-positiven Patienten sind in der Li- perlordose)
teratur vermehrt Symptome aus dem Spektrum der 2. Aufgelagerte schmerzhafte Spasmen, hervorgerufen
PERM wie Hyperekplexie, Myoklonien, Hirnstamm- durch unerwartete Geräusche, emotionalen Stress
symptome, Pyramidenbahnzeichen und autonome oder taktile Reize
Dysfunktionen beschrieben worden (Hutchinson et 3. EMG: Bestätigung kontinuierlicher Aktivität motori-
al. 2008; Mas et al. 2011; McKeon et al. 2013). scher Einheiten in agonistischen und antagonistischen
Muskeln
Carvajal-González et al. (2014) konnten den Zu-
sammenhang zwischen anti-GlyR-AK-Positivität 5. Abwesenheit anderer neurologischer Erkrankungen
oder kognitiver Störungen, welche die Steifigkeit er-
und PERM bestätigen. 33 von 45 Patienten wurden
klären könnten
als PERM klassifiziert, zwei als SPS. Bei fünf der Pa-
Nebenkriterien
tienten lag eine limbische Enzephalitis bzw. eine epi-
leptische Enzephalopathie vor. Die meisten Patien- 1. Positiver anti-GAD65-Antikörpernachweis (oder anti-
Amphiphysin-Antikörper) im Serum mittels Immunzy-
ten zeigten ein deutliches Ansprechen auf eine Im-
tochemie, Western Blot oder Radioimmunoassay 5
muntherapie, Rückfälle kamen vor. Eine paraneo-
6. Klinisches Ansprechen auf Benzodiazepine
plastische Genese lag in einigen Fällen vor. Bei 3 von
45 anti-GlyR-Antikörper-positiven Patienten konn-
te ein Thymom nachgewiesen werden, in einem Fall Neuromyotonie oder auch Tetanus oder Strychnin-
ein Lymphom (Carvajal-González et al. 2014). Vergiftungen.
Die Diagnose fußt auf den klinischen Kriterien
ACHTUNG (› Tab. 5.9; Dalakas et al. 2009), die anhand der ak-
Trotz immunologischer Fortschritte gibt es weiterhin „se- tuellen Erkenntnisse angepasst werden sollten, der
ronegative“ SPSE-Patienten, bei denen der Nachweis Elektrophysiologie (Gershanik et al. 2009) und der
von verursachenden Antikörpern nicht gelingt. Autoantikörperbestimmung. Der Nachweis von Au-
Eine paraneoplastische Genese ist auch bei seronegati- toantikörpern unterstützt bei typischer Klinik die
ven Formen möglich.
Unabhängig vom Antikörperstatus sollte bei kürzeren
Diagnose, ist aber nicht beweisend, noch schließt
Krankheitsverläufen (< 5 Jahren) nach einem Tumor ge- deren Fehlen die Diagnose aus. 20–30% der Fälle
fahndet werden. bleiben ohne den Nachweis von Autoantikörpern.
Bei anti-Amphiphysin-Antikörpern sollte halbjährlich Bei Verdacht auf eine paraneoplastische Genese
nach einem Malignom gesucht werden, speziell nach ist eine konsequente Tumorsuche erforderlich, ggf.
Mamma- und Bronchialkarzinomen. mit der Positronenemissionstomografie. Die zereb-
rale und spinale MRT-Bildgebung kann aus diffe-
renzialdiagnostischen Gründen oder zum Nachweis
5.2.3 Diagnostik einer Affektion des Myelons sinnvoll sein
(› Abb. 5.4).
Gerade zu Beginn der Erkrankung kommt es nicht Die Liquoruntersuchung liefert uneinheitliche
selten zur Fehldiagnose eines dissoziativen Syn- Befunde; oft liegt eine milde Pleozytose vor, bei anti-
droms. Dies kann durch die z. T. „bizarr“ anmuten- Glycin-AK-Positivität wahrscheinlich häufiger als
de intermittierende Gangstörung verbunden mit bei den anderen Gruppen. Sehr oft besteht eine auto-
psychischen Auffälligkeiten bedingt sein. Die eigent- chthone IgG-Bildung bzw. zeigen sich oligoklonale
liche Differenzialdiagnose umfasst diverse Bewe- Banden. Bei Vorliegen von anti-GAD-Antikörpern
gungsstörungen, besonders den Formenkreis der im Serum findet sich in der Regel auch eine intrathe-
Dystonien, spastische Syndrome, Myelopathien, die kale Produktion dieser Antikörper. Andere Autoan-
+21881_Zettl.indb 123 19.09.2018 07:22:59124 5 Immunmediierte Erkrankungen des Nervensystems
tikörper wie etwa gegen die Glycin-Rezeptor-alpha- Symptomatische Therapie
1-Untereinheit lassen sich in einem Teil der Fälle
ebenfalls im Liquor nachweisen. Die umfangreichsten Erfahrungen liegen für die
Oligoklonale Banden kamen bei den Antikörper- GABA-agonistisch wirkenden Benzodiazepine (z. B.
negativen Patienten nicht vor, bei GAD65-Positivität Diazepam) und Baclofen vor, die im Sinne einer
in 47,8% (11/23) und in 29,4% (5/17) bei anti-GlyR- „First-Line“-Therapie angewendet werden. Das An-
positiven Patienten (Martinez-Hernandez et al. sprechen auf Benzodiazepine wird auch als diagnos-
2016). tische Bestätigung angesehen. Die meisten Optionen
symptomatischer Therapien gehen aus Fallberichten
MERKE hervor und umfassen zentral und peripher wirksa-
In ca. 20–30% der SPSSE bleibt der AK-Status negativ. me Ansätze (› Tab. 5.10).
Die Höhe des häufigsten GAD-Antikörpertiters korreliert Grundsätzlich sollte einschleichend und abhängig
weder mit der Krankheitsaktivität noch mit dem Krank- von Wirkung und Nebenwirkungen unter Berück-
heitsverlauf oder dem Therapieeffekt.
Tab. 5.10 Symptomatische Therapieoptionen bei der
SPSSE
Elektrophysiologie Stoffgruppe/ Dosierung Bemerkung
Verfahren
Die folgenden elektrophysiologischen Untersu- Benzodiazepine: • 5–50 (100) mg cave: Entzug
5 • Diazepam • (Dosis 1–6 mg,
chungsmethoden können ebenfalls zur Diagnostik
• Clonazepam aufdosieren)
eingesetzt werden (Gershanik et al. 2009; Meinck et
al. 2017): Baclofen • 5–100 mg bei sehr schwe-
•Oral • 50–800 rer Tonuserhö-
• EMG: kontinuierliche, nicht unterdrückbare •Intrathekale Ba- (1 500) μg/d hung als Ulti-
Muskelfaseraktivität mit normal konfigurierten clofen-Pumpe ma Ratio
Potenzialen motorischer Einheiten in betroffenen
Antikonvulsiva:
Muskeln in Ruhe, besonders paraspinal und pro- •Gabapentin
ximal in Agonisten und Antagonisten, normale •Pregabalin
oder reduzierte Entladungsfrequenz •Valproat
• Elektrostimulation: Auslösung von Muskelspas- •Carbamazepin
men nach kurzer Latenz von 50–80 ms, initial •Levetiracetam
hypersynchron, übergehend in tonisch-desyn- Botulinumtoxin vorübergehen-
chronisierte EMG-Aktivität (charakteristisch) de Entlastung
bei drohender
Gelenkschädi-
gung
5.2.4 Therapie
Ggf. Schmerz-
therapie:
Die Behandlung der SPSSE unterscheidet zwischen • Paracetamol
symptomatischer und immunmodulatorischer bzw. • NSAR
immunsuppressiver Therapie (s.a. Meinck et al. Physiotherapie cave: Symp-
2017). Zu wichtigen therapeutischen Fragen fehlen tomverstärkung
aufgrund der Seltenheit der Erkrankung für die durch Stimulus-
SPSSE Daten aus kontrollierten Studien. Unklar ist Sensitivität
auch, wann im Krankheitsverlauf eine Immunsup- Ggf. Psycho-
pression begonnen werden und wie ggf. eine „Eska- pharmaka,
lationsstrategie“ aussehen sollte. z.B. Antidepressiva
Verhaltens- Angstreduktion
therapie Coping-
strategien
+21881_Zettl.indb 124 19.09.2018 07:22:595.2 Stiff-Person-Sydrom-Spektrum-Erkrankung 125
sichtigung möglicher Toleranzentwicklung dosiert Zu weiteren Immunsuppressiva wie Azathioprin,
werden. Cyclophosphamid, Mycophenolat-Mofetil oder Me-
Neben den muskelrelaxierenden Ansätzen bzw. thotrexat liegen keine kontrollierten Studien vor, le-
Antikonvulsiva sind oft auch Analgetika und/oder diglich in Fallberichten wurde deren Nutzen anek-
Psychopharmaka indiziert. Durch kognitive Verhal- dotisch beschrieben.
tenstherapie kann infolge der Angstreduktion mög- Auch erfolgreiche Anwendungen der Plasmaphe-
licherweise ein Einfluss auf die Muskelsteifigkeit er- rese werden mitgeteilt (De la Casa-Fages et al. 2013;
reicht werden (Morrisa et al. 2014). Pagano et al. 2014), analog kann die Immunadsorp-
tion erwogen werden.
Immuntherapien
Neue Therapieoptionen
Mit der immunmodulatorischen Therapie oder der
Immunsuppression soll die Krankheitsaktivität ge- In Falldarstellungen wurde ein positives Ansprechen
mindert und der Krankheitsverlauf günstig beein- auf eine Therapie mit Rituximab, einem monoklona-
flusst werden. len Antikörper gegen CD20-B-Zellen, beschrieben
Angesichts der Seltenheit und Heterogenität in (Baker et al. 2005; Lobo et al. 2010; Quereshi et al.
Manifestation, Verlauf und zugrunde liegender Im- 2012), auch bei einem therapierefraktären Fall (Sevy
mungenese der Erkrankung sind kontrollierte The- et al. 2012). In einer randomisierten placebokontrol-
rapiestudien rar. Die meisten Empfehlungen stützen lierten Studie an 24 Patienten konnte zwar bei einem 5
sich auf Fallserien und Einzelfallberichte. Drittel der Patienten eine Verbesserung erreicht wer-
den, Signifikanz gegenüber Placebo wurde jedoch ver-
fehlt (Dalakas et al. 2017). Als Erklärung für einen
Intravenöse Immunglobuline (IVIG)
nicht konstanten Effekt wird angenommen, dass anti-
Neben einigen nicht kontrollierten Studien, Experten- GAD-Antikörper auch von langlebigen (long-lived)
meinungen sowie Fallserien und Fallberichten exis- Plasmazellen gebildet werden (Rizzi et al. 2010).
tiert eine randomisierte doppelblinde placebokontrol- Bei einer derartigen Konstellation wäre prinzipiell
lierte Cross-over-Studie (Dalakas et al. 2001). Es der Proteasom-Inhibitor Bortezomib zu erwägen,
konnte gezeigt werden, dass IVIG bei Patienten mit publizierte Erfahrungen hierzu liegen nicht vor.
einer signifikanten Behinderung und ungenügendem Die autologe Stammzelltransplantation könnte
Ansprechen auf Diazepam oder Benzodiazepin eine für therapieresistente Fälle eine alternative Therapie
sichere und effektive Therapie darstellt. Die Dauer des darstellen. Sanders et al. berichteten 2014 erstmals
Ansprechens betrug bei den meisten Patienten über zwei erfolgreich behandelte anti-GAD-Antikör-
5–12 Wochen. per-positive Patienten, die remittierten und ihr prä-
morbides Niveau erreichten.
Kortikosteroide
ACHTUNG
Zum Einsatz von Kortikosteroiden bei SPSSE exis- Anästhesiologisches Management
tieren keine kontrollierten Studien. Positive Effekte • Bei lebensbedrohlichem Status spasmodicus (anhal-
wurden berichtet (Piccolo et al. 1988), der Effekt ist tende, rasch aufeinanderfolgende Spasmusattacken)
aber oft nicht befriedigend. Empfohlen wird z. B. die unmittelbare intensivmedizinische Therapie: hochdo-
initial hochdosierte Gabe von Methylprednisolon sierte Benzodiazepine oder Propofol-Narkose – sehr
(500 mg/d für 5 Tage, dann Reduktion innerhalb langsames Ausschleichen
• Cave: Inhalationsnarkotika und neuromuskuläre Blo-
von 6–8 Wochen von 100 mg auf eine Erhaltungsdo-
cker haben das Potenzial, eine verlängerte Hypotonie
sis von 5–10 mg jeden zweiten Tag; Meinck et al. mit respiratorischem Versagen trotz voller Remission
2012). Allerdings sollte die Gefahr, einen Diabetes der neuromuskulären Blockade hervorzurufen.
zu triggern, gerade bei GAD-positiven Patienten An- (Hylan et al. 2016; Meinck et al. 2012)
lass zur Zurückhaltung sein.
+21881_Zettl.indb 125 19.09.2018 07:22:59Sie können auch lesen