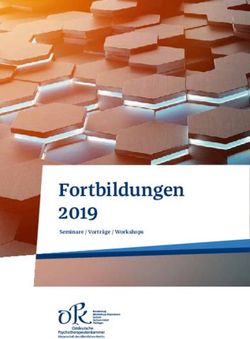Ein schmaler Grat Erfahrungen mit Leihmutterschaft in den USA - Regine Meyer-Spendler - FamART.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, sind verboten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlags und der Autorin reproduziert werden. Ein schmaler Grat. Erfahrung mit Leihmutterschaft in den USA Regine Meyer-Spendler Photo: Chris Brignola 1. Auflage - Mörfelden FamART Verlag, 2015 ISBN PDF 978-3-9452-7519-1 FamART Verlag Langener Str. 37 D-64546 Mörfelden +49 (0) 6105 22629 info@famart.de www.famart.de
Inhaltsverzeichnis
Ein schmaler Grat Inhaltsverzeichnis
Vorworte 6
Anmerkungen zur Leihmutterschaft von Petra Thorn 7
Zur Entstehung dieses Buches von Petra Thorn 14
Vorwort von Regine Meyer-Spendler 16
Begrifflichkeiten und Erläuterungen von Regine Meyer-Spendler 20
Einleitung 22
Erste Schritte und Erfahrungen 23
Die Einführung der IVF-Behandlung in die Leihmutterschaft 30
Der Weg von der traditionellen Leihmutterschaft zur Tragemutterschaft 31
Die Leihmutter in der IVF-Behandlung 32
Medizinische Aspekte der IVF-Behandlung im Rahmen der Tragemutterschaft 34
Die medizinischen Voraussetzungen der Wunscheltern in der IVF-Behandlung 37
Die Vorbereitung auf die IVF-Behandlung „zu dritt“ 41
Der lange (und teure Weg) bis zum ersten Transfer 46
Das (Erfolgs-)Geheimnis der IVF-Behandlung bei Leihmutterschaften 48
Die Schwangerschaft aus körperfremden Eizellen 52
Mehrlingsschwangerschaften im Rahmen der Tragemutterschaft 53
Frühgeburten im Rahmen der Tragemutterschaft 58
Von der juristischen in die medizinische Krise? 61
Im Sog der unbegrenzten Möglichkeiten 62
Der wilde Westen der Reproduktionsmedizin 63
Es wird schon gut gehen... 64
Die Behandlung mittels „Stellvertretern“ 68
Verwirrungen der alternativen Familienbildung 74
Von echten und weniger echten Eltern 75
Von leiblichen und nicht-leiblichen Müttern 77
Zwei Geschichten von Müttern 83
Traditionelle Leihmutterschaft: Ein schwieriger Weg zu einer ungewöhnlichen Familienform 84
Tragemutterschaft: Eine lange Reise hin zu einer „ganz normalen Familie“? 86
Das Konzept der Flexibilität 90
Wem gehört die Schwangerschaft? 93
„Ihr Körper – unser Baby“? 98
Das Ankommen in der Realität 101
Are the kids alright? 104
Eine Lüge zieht zehn andere nach 105
Ein Kind taugt weder zum Lügen noch zum Verheimlichen 108
Aber auch mit dem Recht darf man nicht so pingelig sein 112
Nachwort 116
Andreas Eckert 5Vorworte
Ein schmaler Grat Vorworte
Anmerkungen zur Leihmutterschaft von Petra Thorn
Die Leihmutterschaft ist in den meisten europäischen Ländern verboten und gilt allgemein als ein
besonders umstrittenes Verfahren der Reproduktionsmedizin. Zentraler Kritikpunkt ist die mögliche
Ausbeutung der Frauen, die sich als Leihmutter zur Verfügung stellen. Auch im deutschen Embryo-
nenschutzgesetz wird sie unter Strafe gestellt. Sie wird häufig in Kombination mit der Eizellspende
durchgeführt, die in Deutschland ebenfalls verboten ist. Die Rechtslage ist daher eindeutig: Beide Ver-
fahren sind hierzulande nicht erlaubt. Die Realität sieht in Deutschland jedoch anders aus: Wunsch-
eltern reisen ins Ausland, um sich dort bei uns unter Verbot stehenden Behandlungen zu unterziehen.
Einer europäischen Pilotstudie zufolge unterzogen sich bereits 2008/2009 jährlich rund 2.000 Paare
aus Deutschland Behandlungen im Ausland und viele davon einer Behandlung mit Eizellspende.1 Da
diese Studie das Phänomen des „reproduktiven Reisens“ nur in einigen wenigen europäischen Län-
dern untersuchte und eine Leihmutterschaft vor allem in Ländern wie den USA, Russland, Ukraine und
– bis vor kurzem – in Indien oder Thailand2 durchgeführt wird, wurden Zahlen hierfür nicht erfasst.
Es ist daher schwierig bis unmöglich zu schätzen, wie viele Paare aus Deutschland eine Leihmutter-
schaft durchführen. Wenig bekannt ist zudem, welche Wege sie gehen, um mit ihren Kindern nach
Deutschland einzureisen. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind es zurzeit einige pro Jahr. Und es kann
davon ausgegangen werden, dass diese Zahl als Folge der gesellschaftlichen Akzeptanz reprodukti-
onsmedizinischer Maßnahmen und neuartiger Familienzusammensetzungen in den nächsten Jahren
ansteigen wird.3
Als Sozialarbeiterin und Familientherapeutin biete ich seit über zwanzig Jahren psychosoziale Kin-
derwunschberatung an. Im Rahmen dieser Beratung hatte ich vor etwa zehn Jahren die ersten Be-
ratungsanfragen von Paaren, die eine Eizellspende überlegten. Nur wenige Jahre später wurde auch
die Familienbildung mit Leihmutterschaft in der Beratung angesprochen. In den Anfangsjahren han-
delte es sich um vereinzelte Beratungsanfragen. Doch in den letzten Jahren ist die Tendenz deutlich
gestiegen, dass immer mehr Paare über diese Behandlungen nachdenken – und viele diesen Weg
tatsächlich gehen. Gefragt nach ihrer Haltung gegenüber der unter Verbot stehenden Eizellspende
argumentieren Wunscheltern, dass die Samenspende hier erlaubt ist und beschreiben das Verbot der
Eizellspende als widersprüchlich, obgleich ihnen bewusst ist, dass die Eizellspende – im Gegensatz
zur Samenspende – für die spendende Person mit gesundheitlichen Risiken einher gehen kann. Sie
sprechen zugleich die Spannungen an, die diese Behandlung mit sich bringt: die mangelnde Trans-
1 Shenfield, F., et al. „Cross border reproductive care in six European countries“, Hum Reprod. 2010. 25: 1361-
1368
2 Mehrere Skandale in diesen Ländern haben dazu geführt, dass dort die Leihmutterschaft seit einiger Zeit
stärker kontrolliert wird
3 siehe z.B. die Ausführungen des Europäischen Parlaments aus dem Jahr 2013: Das System der Leihmutterschaft
in den EU-Mitgliedsstaaten. http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474403/
IPOL-JURI_ET(2013)474403(SUM01)_DE.pdf, letzter Zugriff: 12.08.2015
Andreas Eckert 7Ein schmaler Grat Vorworte
parenz in vielen Ländern hinsichtlich des Rekrutierungsprozesses der Spenderin, ihrer medizinischen
Voruntersuchungen und – bei Komplikationen – ihrer medizinischen Versorgung nach der Spende.
Hinzu kommen die in einigen Ländern gesetzlich vorgeschriebene Anonymität der Spenderin und
das mangelnde Auskunftsrecht der so gezeugten Kinder. Viele hadern mit diesen Schwierigkeiten und
auch damit, dass sie – bei einer Entscheidung dafür - einen Weg einschlagen, der in Deutschland
verboten ist. Moralische Bedenken haben nicht wenige, für einige ist jedoch der Wunsch nach einer
Familie mit Kind so stark, dass sie sich darüber hinweg setzen.
Deutlich weniger Paare sprechen im Rahmen einer Kinderwunschberatung die Möglichkeit einer
Leihmutterschaft an. Für die meisten ist dies die Form der Familienbildung, die sie am wenigsten mit
ihrer Vorstellung von „Familie“ in Einklang bringen können. Erst wenn medizinische Behandlungen er-
folglos bleiben, die Wunschmutter aus unterschiedlichen Gründen keine Schwangerschaft austragen
kann und auch eine Adoption keine Aussicht auf Erfolg hat, denken sie darüber nach. Zudem gibt es
eine kleine, aber vermutlich wachsende Zahl von homosexuellen Männern, die diesen Weg überle-
gen. In der Beratung werfen die Wunscheltern viele und komplexe Fragen auf:
• Darf man sich über das Verbot hinwegsetzen, wenn die Leihmutter-
schaft als letzte Möglichkeit verspricht, Eltern zu werden und eine Fa-
milie zu gründen?
• Wie geht man mit den Spannungen und Widersprüchen, mit der
Kommerzialisierung und möglichen Ausbeutung der Frauen um, die
sich als Leihmutter zur Verfügung stellen?
• Wie empfindet man gegenüber der Leihmutter, die Risiken eingeht,
damit man selbst ein Kind bekommen kann?
• Ist es hilfreich, mit Nahestehenden über die Leihmutterschaft zu spre-
chen? Welche Reaktionen erhält man?
• Wie geht man mit Ablehnung um? Wie kann man später das Kind auf-
klären und sicherstellen, dass es selbst nicht diskriminiert wird?
• Darf man sich tatsächlich als die Mutter eines Kindes empfinden,
wenn es von einer Leihmutter ausgetragen und vielleicht sogar mit
Hilfe einer Eizellspende gezeugt wurde?
• Welche Qualität der Beziehung zur Leihmutter (und ggf. zur Eizell-
spenderin, zum Samenspender) ist für das Kind am besten? Wie kann
man überhaut eine Beziehung und Vertrauen herstellen, wenn die
Leihmutter im Ausland lebt und man nur wenig Kontakt zu ihr hat?
Andreas Eckert 8Ein schmaler Grat Vorworte
• Ist die Leihmutter für das Kind die „eigentliche“ Mutter? Welche Nähe
oder Distanz empfindet man als Eltern gegenüber der Leihmutter als
angemessen?
• Wie kann man überhaupt eine solch komplexe Familienzusammen-
setzung so gestalten, dass den kurz- und langfristigen Bedürfnissen
aller Beteiligten Rechnung getragen wird?
• Was passiert, wenn die Leihmutter das Kind nach Geburt nicht abge-
ben möchte? Und lassen sich die rechtlichen Fragen zur Zufriedenheit
aller klären?
Einige dieser Fragen, beispielsweise die Frage der rechtlichen Zuordnung der Elternschaft, lassen sich
im Vorfeld kaum befriedigend lösen. Hier gehen deutsche Wunscheltern juristische Wagnisse ein,
deren Ausgang offen ist. Möglicherweise müssen sie auch langfristig mit Spannungen und Ambiva-
lenzen leben: Die finanzielle Kompensation ist zumindest bei vielen, wenn nicht bei allen Leihmüttern
ein Anreiz. Sie gehen das Risiko einer reproduktionsmedizinischen Behandlung, einer Schwanger-
schaft und Geburt ein. Gleichzeitig lässt sich ihr Beitrag kaum in Geld messen und jeglicher Versuch,
hierfür eine angemessene Geldsumme festzulegen, wird von Wunscheltern in der Beratung als absurd,
aber dennoch notwendig beschrieben. Sie empfinden den Leihmüttern gegenüber tiefe Dankbarkeit,
unabhängig von den Geldsummen, die gezahlt wurden. Für andere Aspekte der Leihmutterschaft
liegen mittlerweile wissenschaftliche Erkenntnisse vor – auch wenn es sich um erste Untersuchungen
handelt, die Studienlage noch nicht belastbar ist und vor allem noch repräsentative Langzeit- und
Verlaufsstudien sowohl für heterosexuelle als auch für homosexuelle Väterfamilien nach Leihmutter-
schaft fehlen. Zudem stammen viele Studien zur Kindesentwicklung und Familiendynamik aus Eng-
land, wo die Leihmutterschaft unter bestimmten Bedingungen zugelassen ist und somit das Tabu
geringer und die Aufklärungsrate höher ist als in Deutschland.
Die Studien weisen darauf hin, dass Familien nach Leihmutterschaft in der Regel gut funktionieren
und dass das Austragen durch eine Leihmutter die Entwicklung einer stabilen Familienbeziehung
und eine positive Kindesentwicklung nicht gefährdet. Viele Kinder sind über ihre Zeugungsart auf-
geklärt, manche haben Kontakt zur Leihmutter und beschreiben diesen als harmonisch. Die Bezah-
lung der Leihmutter ist kein entscheidender Faktor für die Beziehungsqualität. Schwierigkeiten bei
der Übergabe des Kindes von der Leihmutter an die Wunscheltern werden nur selten berichtet, und
das Vorhandensein oder die Abwesenheit einer genetischen Verbindung zwischen Leihmutter und
Kind scheint dabei keinen Unterschied zu machen. Offen ist, wie sich diese Beziehungen langfristig
entwickeln und welche Bedeutung die Zeugung mit Hilfe einer Leihmutter und deren Bezahlung für
die so gezeugten Kinder im Erwachsenenalter haben wird. Um die körperlichen und psychologischen
Risiken für die Leihmutter zu minimieren, wird eine sorgfältige Auswahl der Leihmutterkandidatin-
Andreas Eckert 9Ein schmaler Grat Vorworte
nen, eine risikoarme Behandlung (u.a. das Vermeiden einer Mehrlingsschwangerschaft) und für alle
Beteiligten eine verbindliche psychosoziale Beratung sowohl vor und während der Behandlung als
auch nach Geburt des Kindes dringend empfohlen.4
Die kommerzielle Durchführung der Leihmutterschaft wird international kontrovers diskutiert. Einige5
sehen die Bezahlung von Leihmüttern kritisch, da dies den informed consent 6 beeinträchtigen kann:
Vor allem bei einer internationalen Familienbildung mit Leihmutterschaft kommt es häufig zu einem
Wohlstandsgefälle. Wunscheltern kommen aus Ländern mit hohem Lebensstandard, Leihmütter (und
auch Eizellspenderinnen) aus Ländern bzw. Schichten mit geringerem Lebensstandard. Frauen lassen
sich möglicherweise vor allem aufgrund ihrer finanziellen Situation auf eine Leihmutterschaft ein, wer-
den risikobereit und verharmlosen oder ignorieren körperliche und psychische Gefahren. In manchen
Ländern werden sie dazu verpflichtet, sich während der Schwangerschaft einer kontrollierten Lebens-
situation zu unterziehen, und sie leben in dieser Zeit getrennt von ihrer eigenen Familie.7 Andere
beschreiben es als ethisch fragwürdig, dass medizinische, psychologische und juristische Fachkräfte
sowie Vermittlungsagenturen von der Leihmutterschaft finanziell profitieren, die Leihmutter selbst
jedoch das eigentliche Risiko eingeht und dafür keine angemessene finanzielle Kompensation erhält.8
Die Kommerzialisierung wurde auch im Vorfeld des Embryonenschutzgesetzes Mitte der 1980er Jahre
in Deutschland diskutiert: Es wurde vor allem angemerkt, dass eine finanzielle Nötigung eintreten
kann, da eine hohe Entschädigung einen zu großen Anreiz biete. Eine Leihmutterschaft als Leistung
mit finanzieller Gegenleistung wurde zudem als sittenwidrig und somit unwirksam eingeschätzt. Auch
wurden Bedenken wegen der körperlichen Gefahren aufgrund der Behandlung, der Schwangerschaft
und Geburt geäußert. Letztendlich wurde davon ausgegangen, dass eine Leihmutter emotional am-
bivalent an das Kind gebunden wäre: Eine zu enge Bindung würde dazu führen, dass sie sich weigern
4 Golombok, S. „Modern Families. Parents and children in new family forms“, Cambridge, Cambridge University
Press, Cambridge, 2015
5 z.B. Diel, A. „Leihmutterschaft und Reproduktionstourismus. Schriften zum deutschen und ausländischen Fa-
milien -und Erbrecht. Band 11.“ 25.09.2014, https://www.wm-verlag.de/sites/wmv.site/files/produkte/down-
loads/61001-1_diel_band_11.pdf, letzter Zugriff: 29.09.2015
6 Als informed consent gilt im medizinischen Bereich die Einwilligung nach erfolgter Aufklärung über Art, Um-
fang, Durchführung und zu erwartende Folgen und Risiken eines medizinischen Eingriffs
7 In Indien leben Leihmütter beispielsweise oft getrennt von ihren Familien in sog. „Leihmütterhäusern“, um
eine gute Versorgung sicherzustellen, http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2014-08/leihmutter-
schaft-indien, letzter Zugriff: 13.08.2015
8 Millbank, J. „Rethinking „Commercial“ Surrogacy in Australia“, J Bioeth Inq. 2014, doi 10.1007/s11673-014-
9557-9, advanced access
Andreas Eckert 10Nachwort
Ein schmaler Grat Nachwort
Während ich noch an diesem Text geschrieben habe, gab die Präsidentin des Bundesgerichtshofs
Bettina Limperg der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Interview1, in dem sie sich auch zur Leihmut-
terschaft und insbesondere zur Problematik der Verträge und der Leihmutterschaft als Geschäftsmo-
dell geäußert hat. In diesem Kontext sagte sie:
„Wenn Leihmutterschaft zu einem Geschäftsmodell wird, lauern überall Ge-
fahren.“
Zum Entscheid des BGH zur Anerkennung der kalifornischen Beschlüsse zur Elternschaft wollte Frau
Limperg sich nicht äußern, auch nicht zu der Frage, ob dieser nicht Tür und Tor für die Leihmutter-
schaft aufstoßen würde. Ihre Antwort lautete wie folgt:
„Ich kann und will konkrete Entscheidungen nicht kommentieren. Der Fall
zeigt aber eines beispielhaft: Richterinnen und Richter stehen vor dem Pro-
blem, dass sie am Ende entscheiden müssen. Das Kind war ja schließlich auf
der Welt. Sie können es nicht wie Salomon in die Luft halten und schauen, wer
bereit ist, es durchzuschlagen. Ich fürchte, dass die tatsächliche Entwicklung,
das deutsche Verbot der Leihmutterschaft im Ausland zu umgehen, schon
sehr weit fortgeschritten ist.“
Sie beendete die Befragung mit den Sätzen:
„Ich persönlich glaube, dass es Schicksal gibt. Aber natürlich muss nicht jeder
jedes Schicksal ertragen. Ich habe großes Verständnis, dass Eltern mit uner-
fülltem Kinderwunsch nach anderen Möglichkeiten suchen. Aber man kann
auch nicht alles ‚machen‘ - weder am Anfang noch am Ende des Lebens.“
Zeitnah zu diesem Interview erschien ein Artikel in der WELT2 und ein Fernsehbericht auf RTL23: Ein
Paar, sie 55, er 50 Jahre alt, schildert die Geschichte seiner Leihmutterschaftsbehandlung mit zusätz-
licher Eizellspende in der Ukraine. Beide sind seit kurzem Eltern von Zwillingen, nachdem sie sich
eigentlich vor 18 Jahren nach zahlreichen erfolglosen Behandlungen von ihrem Kinderwunsch ver-
abschiedet hatten. Kurz darauf erzählte eine deutsche Wunschmutter in der „Brigitte“, wie sie ihre
Leihmutterschaftsbehandlung in den USA, aus der ebenfalls Zwillinge hervorgegangen sind, rückbli-
ckend erlebt hat.4
1 Bubrowski, H., Müller, R.: BGH-Richterin Bettina Limperg „Polizei, Verfassungsschutz und Justiz brauchen Ver-
bindungsdaten“, FAZnet vom 20.03.2015, http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/bgh-praesidentin-betti-
na-limperg-ueber-den-richterberuf-13493931-p2.html, letzter Zugriff: 06.06.2015
2 Mitic-Pigorsch, K. „Mutter mit 55, dank Eizellspende und Leihmutter“, Die WELT, 17.03.2015, Seite 23 und
http://www.welt.de/vermischtes/article138500409/Mutter-mit-55-dank-Eizellspende-und-Leihmutter.html,
letzter Zugriff: 19.08.2015
3 http://www.rtl2.de/sendung/wunschkinder-der-traum-vom-babyglueck/folge/folge-12-21, letzter Zugriff:
07.06.2015
4 Hussendörfer, E. „Mamas Bauch ist kaputt, Candices Bauch ist heil. Deswegen hilft sie uns“, Brigitte, 11/2015,
http://www.hussendoerfer.com/texte/Brigitte_11_2015.pdf, letzter Zugriff: 10.06.2015
Andreas Eckert 117Ein schmaler Grat Nachwort
Das ist die augenblickliche Situation: Wie Frau Limperg es vermutet, geht eine zunehmende Zahl
deutscher Paare den Weg der Leihmutterschaft, obwohl diese in Deutschland verboten ist und – nicht
nur hier – kritisch gesehen wird. Die Leihmutterschaft, insbesondere wenn sie unter kommerziellen
Bedingungen erfolgt, ist das in der Öffentlichkeit am wenigsten akzeptierte reproduktionsmedizini-
sche Verfahren.5 Mit „no maternity traffic“6 und „stop surrogacy now“7 wurden zwei Initiativen ins Le-
ben gerufen, die sich international für das Verbot der Leihmutterschaft einsetzen, unter anderem mit
folgender Erklärung:
„Wir sind der Ansicht, dass die Praxis der kommerziellen Leihmutterschaft
vom Handel mit Kindern nicht unterschieden werden kann. Selbst wenn sie
nicht-kommerziell (d.h. unbezahlt oder „altruistisch“) ist, sollte jegliche Pra-
xis, die Frauen und Kinder solchen Gefahren ausliefert, verboten werden.
Niemand, ob heterosexuell, homosexuell oder in freiwilligem Single-Dasein
lebend, hat ein Recht auf ein Kind.“ 8
In den Kampagnen geht es um das Verbot einer „neuen Form der Sklaverei“, bei welcher der weibliche
Körper und Kinder unter Ausnutzung von Notsituationen zur Ware werden würden. Die medizinischen
und psychologischen Risiken wären immens. „Wo Leihmutterschaft legal sei, würde dieser mögliche
Schaden institutionalisiert.“ 9 Das Bild, das auf den Internetseiten der Gegner von der Leihmutterschaft
gezeichnet wird, ist sehr düster.
Sehr viel bunter und fröhlicher erscheinen da die Homepages von Agenturen und bestimmten
IVF-Zentren, auf denen für das Verfahren geworben wird. Die Seiten sind voller wunderbarer Erfah-
rungen gemeinsamer „Reisen“ von Leihmüttern mit ihren Wunscheltern. Eine Leihmutter erzählt
scheinbar begeistert von ihrer geplanten achten Schwangerschaft, nachdem sie bereits neun Kinder
ausgetragen hat.10 Kinder präsentieren stolz ihre Mütter, die als Leihmütter helfen würden „Wunder
wahr zu machen“. Es geht um Freundschaften fürs Leben, reibungslose Schwangerschaften und meist
großartige und anrührende gemeinsame Geburtserlebnisse. Immer wieder tauchen die Wörter „Lie-
be“, „Geschenk“, „Vertrauen“ und „Hoffnung“ auf. In einem der Werbemagazine11 findet man ein Foto
von einem amerikanischen Soldaten, der neben seiner Ehefrau steht und ein Schild hält, auf dem
geschrieben ist: „While I was deployed I told my wife to pick up a hobby…“. – „Ich sagte meiner Frau, sie
solle sich ein Hobby suchen, während ich im Einsatz bin…“. Neben ihm steht seine Frau mit einem Schild
5 Ciccarelli, J.C., Beckman, L.J. „Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy“, J
Soc Issues. 2005 Mar, 61 (1): 21-43
6 http://www.nomaternitytraffic.eu/wordpress/, letzter Zugriff: 19.06.2015
7 http://www.stopsurrogacynow.com/the-statement/statement-german/#sthash.26uUZlfa.dpbs, letzter Zu-
griff: 16.06.2015
8 siehe vorherige Fußnote
9 siehe vorherige Fußnote
10 Diese Leihmutter hatte in sieben Schwangerschaften neun Kinder ausgetragen.
11 „Surrogacy together magazine“, siehe: http://www.surrogacytogether.com/, letzter Zugriff: 10.06.2015
Andreas Eckert 118Ein schmaler Grat Nachwort
mit der Aufschrift „he never thought that hobby would be surrogacy“ – „nie hätte er gedacht, dass dieses
Hobby die Leihmutterschaft sein würde“. Die Leihmutterschaft als Hobby – welch ein seltsamer Gegen-
entwurf zur Leihmutterschaft als neue Form der Sklaverei.
Es ist nicht einfach, sich angesichts dieser widersprüchlichen Haltungen der Leihmutterschaft sach-
lich zu nähern. Und so ist das Bild, das die Wissenschaft von der Leihmutterschaft zeichnet, bislang
eigentlich nur eine Skizze. Bei der Recherche nach Studien wird deutlich, dass das wissenschaftliche
Bemühen im Kontext der Leihmutterschaft äußerst sparsam zu sein scheint. In James Goldfarbs Buch
zur Reproduktionsmedizin mit Hilfe Dritter12 gibt es im medizinischen Abschnitt zur Eizellspende 218
Verweise auf wissenschaftliche Arbeiten, im medizinischen Teil zur Leihmutterschaft sind es nur acht
und das obwohl die Behandlung in den USA seit den 80er Jahren13 in zunehmendem Umfang prak-
tiziert wird. Auch bei der Untersuchung möglicher psychosozialer Folgen der Behandlung erscheint
das Engagement eher dürftig:
„Angesichts der ausgesprochen kontroversen Sichtweisen sollte man anneh-
men, es würde beachtliche Forschungsaktivitäten geben.(…) Bislang ist die
entsprechende Forschungsliteratur aber extrem spärlich. Bei der Auswertung
der Arbeiten findet man eine Fülle von ethischen, moralischen, rechtlichen
und psychologischen Schlussfolgerungen, aber nur begrenzte empirische Da-
ten zu psychologischen und sozialen Aspekten.“
Zu diesem Schluss kommt die Autorin einer Literaturrecherche14 über die von 1993 bis 2003 veröf-
fentlichten Studien zu verschiedenen psychosozialen Aspekten der Leihmutterschaft. Sie fand dabei
nur 27 Untersuchungen, meist basierend auf kleinen Gruppen, Kontrollgruppen fehlten fast immer.
Zahlreiche der Publikationen beruhten ausschließlich auf Erfahrungsberichten von Betroffenen, vor
allem von Leihmüttern.15 Man muss sich vor Augen halten, dass diese persönlichen Geschichten vor
dem Hintergrund der kontroversen Sichtweisen der Leihmutterschaft erzählt werden. Es wird ja nicht
nur den Wunscheltern zur Last gelegt, dass sie „ihren Lebenstraum durch Ausbeutung anderer erfül-
len“16, sondern die Leihmütter sehen sich Vorwürfen ausgesetzt, sie würden „ihr Kind nach der Geburt
gegen Geldzahlung abgeben.“17 Die an einer Leihmutterschaft Beteiligten sehen sich also mit zum Teil
12 Goldfarb, J.M., „Gestational Carrier: Medical Aspects“, in Goldfarb J. (Hrsg.) „Third-Party Reproduction, A Com-
prehensive Guide“, Editor Goldfarb, J.M., Springer, New York, 2014
13 Braverman, A. et al. „Reproduction through surrogacy: the UK and US experience“, in Richards, M. et al. (Hrsg.)
„Reproductive Donation“, Cambridge University Press, Cambridge, 2012, S. 289-307
14 Ciccarelli, J.C., Beckman, L.J. „Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy.“ J
Soc Issues. 2005 Mar, 61 (1): 21-43
15 z.B. Blyth, E. “I wanted to be interesting. I wanted to be able to say ‘I‘ve done something interesting with my
life’: Interviews with surrogate mothers in Britain“, J Reprod Infant Psychol. 01/1994, 12 (3): 189-198
16 Jungen, O. „Leihmütter – Gebären als Geschäft“, Frankfurter Allgemeine Feuilleton, 03.09.2010, http://www.
faz.net/aktuell/feuilleton/fernsehen/leihmuetter-gebaeren-als-geschaeft-11037279.html, letzter Zugriff:
13.06.2015
17 AG Hamm, 22. Februar 2011 , Az. XVI 192/08
Andreas Eckert 119Ein schmaler Grat Nachwort heftigen Kritiken konfrontiert. Ist in dieser Situation zu erwarten, dass Leihmütter offen und ehrlich antworten, wenn sie befragt werden, warum sie sich zur Leihmutterschaft entschieden haben und wie sie diese erlebten? Die Autorin der obengenannten Arbeit, Janice Ciccarelli, vermutet, „dass Leih- mütter in Befragungen zu den Motiven ihrer Leihmutterschaft eher sozial akzeptierte Gründe nennen wür- den, als ihre wahren Motive offenzulegen.“ 18 In einer anderen Untersuchung wird festgestellt, dass „die angegebenen Beweggründe der Leihmütter oftmals wie auswendig gelernt klingen – alle gleichlautend.“ 19 Die Studienlage zu Eltern mit Kindern aus Leihmutterschaft ist noch dünner als die zum Erleben der Leihmütter. Laut Ciccarelli dürften sich die meisten Eltern, die den Weg der Leihmutterschaft gegan- gen sind, „in Anbetracht des mit der Leihmutterschaft verbundenen sozialen Stigmas – vor allem auf Sei- ten des auftraggebenden Paares – lieber in ihre ungestörte Privatsphäre zurückziehen als an Forschungs- arbeiten teilzunehmen.“20 Das kann ich auf Basis meiner Erfahrungen nur bestätigen. Andere Eltern mit Kindern aus Leihmutterschaft nehmen nicht an Untersuchungen teil, weil sie im Verlauf der Behand- lung auch negative Erfahrungen gemacht haben und fürchten, dass – wenn diese an die Öffentlich- keit kämen – es „Wasser auf den Mühlen der Gegner“ wäre. So zumindest äußerte sich eine Mutter mit Kindern aus Leihmutterschaft mir gegenüber. Und ich denke, diese Befürchtung ist nicht ganz unbe- rechtigt. Sieht man sich eine der Kampagnen zum Verbot der Leihmutterschaft näher an21, werden dort im Abschnitt „Studien“ alle möglichen negativen Veröffentlichungen zur Thematik gesammelt. In Anbetracht solcher Kampagnen werden viele Eltern mit Kindern aus Leihmutterschaft sich hüten, auch nur ein negatives Wort über die Behandlung zu verlieren. Sie schweigen also und versuchen, die Geschichte der Entstehung ihrer Kinder eher zu verbergen. Einige wenige Eltern wiederum gehen bewusst mit besonders positiven Geschichten zur Leihmutterschaft an die Öffentlichkeit, wobei man diesen Erlebnisberichten häufig das Bemühen anmerkt, ein Gegenbild zu den Vorbehalten gegenüber der Leihmutterschaft zu zeichnen. Meist wird zunächst darauf verwiesen, dass die „finanzielle Situation der eigenen Leihmutter stabil war und die Hilfe selbstlos“22, die Entscheidung zur Leihmutterschaft also „altruistisch motiviert“ und „nicht aus einer finanziellen Notlage oder einer misslichen Situation heraus“.23 Dann folgt die Schilderung der besonders guten Verbindung zur Leihmutter, die mehr eine Freund- 18 Ciccarelli, J.C., Beckman, L.J. „Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy“, J Soc Issues. 2005 Mar, 61 (1): 21-43 19 Ragone, H. „Surrogate motherhood: Conception in the heart“, Westview Press, Boulder, CO, 1994, S. 52 20 Ciccarelli, J.C., Beckman, L.J. „Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy“, J Soc Issues. 2005 Mar, 61 (1): 21-43 21 http://www.stopsurrogacynow.com/the-statement/statement-german/#sthash.4JYN5NJi.dpbs, letzter Zu- griff: 17.06.2015 22 http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/frautv/videoleihmutterschaft100_size-L.html?autost- art=true, letzter Zugriff: 04.06.2015 23 Konigorski M. „Der gemietete Bauch“, Ethische Überlegungen zur Leihmutterschaft, Deutschlandfunk, 09.05.2013, http://www.deutschlandfunk.de/der-gemietete-bauch.886.de.html?dram:article_id=246049, letzter Zugriff: 10.06.2015 Andreas Eckert 120
Ein schmaler Grat Nachwort schaft zweier „irgendwie ähnlicher“ Frauen und Mütter war als eine „Geschäftsbeziehung“,24 ein Kontakt „gar nicht so anderer“ Menschen, bei welchem „das Geld nicht im Vordergrund stand“, sondern es auch um das „Verwirklichen von Träumen“ ging.25 Ich selber kann die verschiedenen Formen des Umgangs der Eltern mit der Leihmutterschaft durch- aus nachvollziehen – sowohl das Sich-Zurückziehen und Schweigen und das Bemühen, die Leihmut- terschaft zu verheimlichen als auch die Versuche, mit besonders schönen Geschichten den Vorbe- halten gegenüber der Leihmutterschaft etwas entgegen zu setzen. Und obwohl ich beide Wege gut verstehen kann, sehe ich sie kritisch. Das Verheimlichen und Verbergen der Leihmutterschaft ist aus meiner Sicht problematisch, weil (wie die BGH-Präsidentin Bettina Limperg es in dem oben zitierten Interview sagte) die durch Leihmütter geborenen Kinder „ja schließlich auf der Welt sind“. Wird man all diesen Kindern gerecht, wenn man nicht versucht, einen Umgang mit der Leihmutterschaftsbehand- lung zu finden, bei dem berücksichtigt wird, dass in Deutschland bereits zahlreiche Kinder leben, die durch Leihmütter zur Welt gebracht wurden? Das Landgericht Frankfurt am Main, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR und der deutsche Bundesgerichtshof sind mit ihren 2012 und 2014 gefällten Beschlüssen26 einen wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen und haben den im Ausland geborenen Kindern aus Leihmutterschaften unter bestimmten Umständen eine größere rechtliche Sicherheit gegeben. Laut EGMR sollte „jeder Mensch in der Lage sein, den Kern seiner Identität zu bestimmen.“ 27 Die Gerichte haben also bereits erste Wege gebahnt, trotz des Verbots der Leihmut- terschaft in Deutschland zum Wohl der Kinder zu handeln. Ich denke, dieses ist eine gute Ausgangs- lage, um offener mit der Leihmutterschaft umzugehen und anzustreben, die Situation vor allem der Kinder zu verbessern. Ich weiß von Eltern mit Kindern aus Leihmutterschaft, die mit besonders schönen Erfahrungsberichten über ihre Leihmutterschaftsbehandlung an die Öffentlichkeit gegangen sind, dass sie genau dieses Ziel der Verbesserung der Situation ihrer Kinder verfolgen. Obwohl ich es gut finde, wenn offener über die Leihmutterschaft gesprochen wird, sehe ich die Veröffentlichung dieser betont positiven Berich- te mit Skepsis. Erfahrungsgemäß kommen langwierige IVF-Behandlungen, Schwangerschafts- und Geburtskomplikationen, Frühgeburten, Aufenthalte der Kinder auf der neonatologischen Intensiv- 24 Hussendörfer, E.,„Mamas Bauch ist kaputt, Candices Bauch ist heil. Deswegen hilft sie uns“, Brigitte, 11/2015, http://www.hussendoerfer.com/texte/Brigitte_11_2015.pdf, letzter Zugriff: 10.06.2015 25 Kuczynski, A. „Her Body, My Baby“, New York Times, published November 28, 2008, http://www.nytimes. com/2008/11/30/magazine/30Surrogate-t.html?pagewanted=all&_r=0 , letzter Zugriff: 04.06.2015 26 Bechluss des Landgerichts Frankfurt am Main, 03.08.2012. 9. Zivilkammer - Az. 2-09 T 50/11, Beschluss des XII. Zivilsenats vom 10.12.2014 - XII ZB 463/13 und Beschluss des EGMR vom 26.06.2016, AZ 65192/11 und AZ 65941/11 27 Übersetzung aus dem Beschluss des EGMR vom 26.06.2014 von Rechtsanwaltskanzlei Höper und Panning, Kiel. http://www.hpp-recht.de/meldungen/artikel/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=45&tx_news_pi1%5Bcont- roller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=d72839271e4dc06a823e24ef02eb1410, letz- ter Zugriff: 19.08.2015 Andreas Eckert 121
Ein schmaler Grat Nachwort station, Konflikte im Verlauf des Verfahrens oder Schwierigkeiten im späteren Umgang mit der Be- handlung in diesen Berichten selten vor. Die Leihmutterschaft wird also problemloser dargestellt als sie in vielen Fällen verläuft. Aus meiner Sicht ist es wichtig, dass Eltern, die darüber nachdenken, ihren Kinderwunsch mit Hilfe einer Leihmutter zu erfüllen, wissen, worauf sie sich einlassen. Eine Leihmutterschaft fordert die Be- teiligten sehr und nach meinen Erfahrungen ist der Grat zur Überforderung schmal. Janice Ciccarelli spricht von „rauen Gewässern“, in denen man bei der Leihmutterschaft fahren würde. Es sei nur zu gut vorstellbar, „dass die Wahrscheinlichkeit sozialer, psychologischer und rechtlicher Komplikationen mit der Anzahl der Personen dramatisch ansteigt, die an der Entstehung eines Kindes beteiligt sind“.28 Und bei einer Leihmutterschaft sind „mehr Menschen beteiligt als das zahlende Paar und das Kind“,29 wobei die Behandlung obendrein sehr langwierig ist. Völlig unabhängig davon, ob eine Tragemutterschaft un- ter kommerziellen oder nicht-kommerziellen Bedingungen stattfindet, umfasst sie dieselben Schrit- te: die Vorbereitungszeit, eine oder mehrere IVF-Behandlungen „zu dritt“, die Schwangerschaft der Leihmutter, die Geburt, die Übergabe des Kindes oder der Kinder, die rechtliche Klärung der Eltern- schaft, den Umgang mit der Behandlung im weiteren Leben. Direkt an der Behandlung beteiligt sind die Wunscheltern, die Leihmutter, eventuell Gametenspender und das ausgetragene Kind. Indirekt beteiligt sind gegebenfalls der Partner der Leihmutter und ihre bereits geborenen Kinder. Das sind viele Schritte und viele Personen. Wenn man sich das Ziel setzt, während all dieser Schritte die Bedürf- nisse aller an der Behandlung Beteiligten zu berücksichtigen, ist das eine enorme Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, bei der man aus meiner Sicht zwingend neutrale und professionelle Beratung und Beglei- tung braucht, um die Risiken für alle Beteiligten zu minimieren. Nur ist es schwierig, diese Unterstüt- zung in Anbetracht des Verbotes der Leihmutterschaft in Deutschland tatsächlich zu bekommen. Und so übertreten Paare mit Kinderwunsch beim reproduktionsmedizinischen Reisen mehr oder weniger unvorbereitet Grenzen, die in Deutschland gezogen wurden. Sie kommen aber mit den Kindern zu- rück nach Deutschland, wo diese Grenzen weiterhin bestehen. Das ist eine Situation, die aus meiner Sicht niemand unterschätzen und niemand bagatellisieren sollte. 28 Ciccarelli, J.C., Beckman, L.J. „Navigating rough waters: an overview of psychological aspects of surrogacy“, J Soc Issues. 2005 Mar, 61 (1):2 1-43 29 Polli,T. „Ein Baby für 25.000 Franken“, Beobachter 24/2012, 23.11.2014, http://www.beobachter.ch/justiz-be- hoerde/gesetze-recht/artikel/leihmuetter_ein-baby-fuer-25000-franken, letzter Zugriff: 09.06.2015 Andreas Eckert 122
Ein schmaler Grat ... Gibt es einen falschen Weg der Familienbildung? Kann die Zeu- gung eines Kindes verwerflich sein? Darf man sich einfach über die Gesetzgebung seines Heimatlandes hinwegsetzen? Eine Leihmutterschaft in Anspruch zu nehmen - das ist sicherlich einer der schwierigsten und kontroversesten Wege, ein Kind zu zeugen. Menschen, die diesen Weg gehen, balancieren auf einem schmalen Grat zwischen ihrem Urbedürfnis nach einem Kind und dem eindeutigen gesetzlichen Verbot in Deutschland, zwischen der Chance, mit eigenen Samen- und Eizellen ein Kind zu bekom- men und der Notwendigkeit eine Frau zu finden, die bereit ist, die Schwangerschaft auszutragen, zwischen dem Wunsch, nach Geburt in die Normalität eines Familienalltags übergehen zu kön- nen und der komplexen Familienzusammensetzung, die sich nicht einfach verheimlichen lässt. Und dennoch gibt es mittlerweile mit einiger Wahrscheinlichkeit nicht wenige Menschen, die diesen Weg gehen - weil es für sie die einzige Chance ist, eine Familie zu gründen. Regine Meyer-Spendler beschreibt in ihrem Buch nicht nur die Erfahrungen, die sie selbst und ihre Familie im Rahmen einer Leihmutterschaft in den USA gemacht haben. Sie beleuchtet auch die Herausforderungen und Schwierigkeiten, die dieser Weg der Familienbildung mit sich bringt. Ihr Buch ist eine kritische Betrach- tung der Leihmutterschaft wie sie unter den derzeitigen Bedin- gungen stattfindet, gleichzeitig aber auch ein Appell, diese Form der Familienbildung offen, ehrlich und reflektiert anzugehen. www.famart.de 978-3-9452-7519-1
Sie können auch lesen