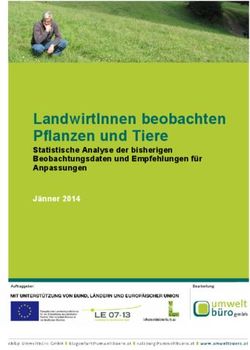Einfluss anglerischer Bewirtschaftung auf die Biodiversität von Baggerseen: Eine vergleichende Studie verschiedener gewässerge-bundener ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
153
Lauterbornia 87: 153-187, D-86424 Dinkelscherben, 2020-12-28
Einfluss anglerischer Bewirtschaftung auf die Biodiversität von
Baggerseen: Eine vergleichende Studie verschiedener gewässerge-
bundener Organismengruppen
Impact of recreational fisheries management on the biodiversity of gravel pit lakes: a
comparative study involving several groups of aquatic and riparian organisms
Robert Nikolaus, Sven Matern, Malwina Schafft, Thomas Klefoth, Andreas Maday, Christi-
an Wolter, Alessandro Manfrin, Jan Uwe Lemm und Robert Arlinghaus
Mit 6 Abbildungen, 4 Tabellen im Text und 12 Tabellen im Anhang
Schlagwörter: Pisces, Niedersachsen, Deutschland, Baggersee, Biodiversität, Angeln, Freizeitnutzung
Keywords: Pisces, Lower Saxony, Germany, gravel pit, biodiversity, angling, recreation
Vorliegende Studie erfasst erstmalig sämtliche Standgewässer in Niedersachsen und zeigt, dass künstlich ge-
schaffene kleine Baggerseen der dominierende Gewässertyp der Region sind. Zudem legt diese Studie verglei-
chende Ergebnisse zur Biodiversität anglerisch bewirtschafteter und unbewirtschafteter Baggerseen vor. Ob-
wohl die anglerisch bewirtschafteten Baggerseen intensiver freizeitlich genutzt wurden, fanden sich bei
Pflanzen, Amphibien, Libellen und Vögeln keine Unterschiede in der Artvielfalt und in der Simpson-Diversi -
tät. Signifikante Einflüsse der Angelfischerei waren lediglich in Bezug auf die Fischgemeinschaften nachweis-
bar, die in bewirtschafteten Seen artenreicher als in unbewirtschafteten Vergleichsgewässern waren. Es wird
geschlussfolgert, dass die anglerische Bewirtschaftung die gewässertypspezifische Fischartenvielfalt in Bagger-
seen fördert und dass die Angelfischerei unter den spezifischen sozial-ökologischen Bedingungen Niedersach-
sens keinen relevanten Einflussfaktor auf die sonstige Artenvielfalt darstellt.
We mapped all lakes in Lower Saxony and show that gravel pit lakes are the dominant lake type in the stu -
dy region. Furthermore, we compared gravel pit lakes managed and not managed by recreational fisheries in
terms of biodiversity across a range of aquatic and riparian taxa. Although the angling lakes were used more
intensively for recreation, no differences in species richness and the Simpson diversity index were detected for
plants, amphibians, damsel- and dragonflies, and birds. The only relevant biodiversity effect detected in re-
sponse to fisheries management related to fish communities, which were found to be more species-rich in ang-
ler-managed lakes compared to unmanaged ones. We conclude that management by anglers promotes the
water-type-specific fish species diversity in gravel pit lakes, and recreational angling is unlikely a relevant fac -
tor influencing the species richness under the social-ecological conditions of Lower Saxony.
1 Einleitung
Die Biodiversität ist weltweit stark bedroht, das gilt auch für Süßwasserarten (Albert et al.
2020, He et al. 2019). Neben den Süßwassermollusken (44 % der Arten bedroht, Cuttelod
et al. 2011) gehören in Europa Süßwasserfische zu den stark bedrohten Arten (37 % der Ar-
ten bedroht; Freyhof & Brooks 2011). Europaweit sind 15 % der Libellenarten (Kalkman et
al. 2010), 13 % der Vogelarten (BirdLife International 2015) und 7 % der Wasserpflanzen-
arten (Bilz et al. 2011) bedroht.
Anthropogen geschaffene Ökosysteme, wie Baggerseen können wichtige Ersatzlebens-
räume und Sekundärbiotope für seltene und gefährdete wassergebundene Arten darstellen
(Damnjanović et al. 2018, Matern et al. 2019, Santoul et al. 2009, Søndergaard et al. 2018) .
Allerdings ist über ihre Biodiversitätsausstattung nur wenig bekannt (Braune 2004, Völkl
2010), unter anderem weil Baggerseen nicht systematisch untersucht und aufgrund ihrer ge-
ringen Größe (154 (Richtlinie 2000/60/EG) überwacht werden. Selbst die genaue Anzahl und Größe von Bag- gerseen ist in vielen Bundesländern nicht flächendeckend erfasst. Zudem ist bisher nur we- nig erforscht, welche strukturellen Bedingungen und interagierenden Umweltfaktoren Ein- fluss auf die Wertigkeit der Baggerseen für den Arten- und Naturschutz haben (Braune 2004, Köppel 1995, Neumann et al. 1994). Die natürliche Besiedlung von Baggerseen durch Fische ist vor allem mittels Zu- und Ab- läufen (Borcherding et al. 2002) oder stochastischen Flutereignissen (Pont et al. 1991) mög- lich. Dass Fischlaich über Vögel transportiert wird, galt bis vor kurzem als empirisch nicht bestätigt (Hirsch et al. 2018). Allerdings zeigen neueste Befunde, dass zumindest eine Aus- breitung von Cyprinideneiern durch aquatische Vögel oder Insekten über Darmpassagen oder Anheftung möglich ist (Lovas-Kiss et al. 2020, Suetsugu & Togashi 2020). Zumeist werden Fische aber in isolierte, neu geschaffene Baggerseen über den fischereilich motivier- ten Fischbesatz eingebracht (Emmrich et al. 2014, Matern et al. 2019). Die Etablierung zu- fällig oder bewusst eingebrachter Fische ist artspezifisch abhängig von verschiedenen abioti- schen Faktoren (Persson et al. 1991, Lewin et al. 2014, Mehner et al. 2005), aber auch vom Prädationsdruck (Englund et al. 2009, Henriksson et al. 2016, Emmrich & Düttmann 2010, Veldkamp 1995). Der potenzielle Einfluss von Fischbesatz auf die Fischartengemeinschaf- ten in Baggerseen ist derart offensichtlich, dass die deutschsprachige naturschutzfachliche Literatur eine sehr kritische Perspektive zur fischereilichen Hege, insbesondere zum Besatz, eingenommen hat (Waterstraat 2002, Weibel & Wolf 2002). Inwieweit der regelmäßig durchgeführte Fischbesatz die Fischgemeinschaften in Baggerseen geprägt hat, wird in vor- liegender Studie durch den Vergleich mit nicht fischereilich gehegten Vergleichs-Baggerseen aufgearbeitet. Natürliche Seen und Baggerseen bieten dem Menschen viele Ökosystemnutzen (Rey- naud & Lanzanova 2017). Die meisten Baggerseen in Deutschland werden durch Angelver- eine bewirtschaftet. Mit dem Fischereirecht geht gleichzeitig eine Hegepflicht einher (Ar- linghaus et al. 2015), sodass Angler nicht nur Nutzer der Fischbestände und Gewässer sind, sondern über Fang und Hege auch aktiv auf die Fischpopulationen (z. B. über Besatzmaß- nahmen, Befischung oder Habitataufwertungen) einwirken und die Uferregionen gestalten (Arlinghaus 2017, Arlinghaus et al. 2015, Matern et al. 2019). Diese Einwirkungen durch Angler können Folgeeffekte auf verschiedene Taxa haben, zum Beispiel submerse Makro- phyten (Bajer et al. 2016), Amphibien (Hecnar & M’Closkey 1997) und Invertebraten (Knorp & Dorn 2016). Außerdem können Angler Uferhabitate z. B. durch das Anlegen von Angelstellen beeinträchtigen und so Litoralpflanzen (O’Toole et al. 2009) und Libellen (Remsburg & Turner 2009) beeinflussen. Auch können Angler als Störfaktoren auf uferbrü- tende Vögel wirken (Reichholf 1970). Deshalb werden Angler je nach Perspektive als we- sentliche Bewirtschafter und Schützer der Gewässer und der darin beheimateten Arten an- gesehen (Arlinghaus 2017, Arlinghaus et al. 2015) oder aber als potentielle Gefahrenquelle für die Artenvielfalt, die es zu regulieren gilt (Reichholf 1970, Waterstraat 2002, Weibel & Wolf 2002). Die Freizeitnutzung von Seen (z. B. Angeln, Baden, Boot fahren) kann in der Tat im Wi- derspruch zu Naturschutzzielen stehen (DWA 2017, Venohr et al. 2018). Die deutschspra- chige naturschutzfachliche Literatur thematisiert vor allem den möglichen Einfluss mensch- licher Freizeitnutzungen an Gewässern auf Sing- und Wasservögel, z. B. über das Angeln (Krüger 2016, Reichholf & Reichholf-Riehm 1982, Wichmann 2010). Die Mehrzahl der ver- fügbaren Studien fokussiert auf individuelle Verhaltensreaktionen der Vögel (Bateman & Fleming 2017); seltener wurden Bruterfolg und lokale Abundanzen untersucht (Reichholf 1988). Aus wissenschaftlicher Sicht ist zu den meisten Studien zum Einfluss des Angelns auf
155 Wasservogelpopulationen einschränkend anzumerken, dass sie keine raum-zeitlichen Kon- trollen in das Studienkonzept integrierten. Das heißt, es fehlen Beobachtungen zur Vogel - entwicklung in Vergleichsgewässern ohne freizeitliche Nutzung. Trends im Zusammenhang von Angleraufkommen und Bruterfolg von Wasservögeln an Einzelgewässern könnten auch zufällig durch Veränderungen im Vogelaufkommen (getrieben durch andere Umweltfaktoren) auftreten. Weitere wissenschaftliche Kritikpunkte sind die Beschränkung der Beobachtungen auf einzelne Standorte innerhalb eines Gewässers (Reichholf 1970, 1988), anstatt über mehrere Seen repliziert die Gesamteffekte der Freizeitnutzung auf Ge- wässerebene zu erheben. Insgesamt erscheinen die Biodiversitätswirkungen der Freizeitnutzung auf Wildtiere und speziell auf die Vogelpopulationen „überschätzt“ (Bateman & Fleming 2017). Analog dazu konstatierte eine deutsche Überblicksstudie, dass Effekte der Wasserfreizeit vor allem aus lärmenden und stark mobilen Formen der Freizeitnutzung (z. B. Bootsfahren) resultieren, weniger vom stationären Uferangeln (Krüger 2016). Letzteres ist an Baggerseen typisch. Wissenschaftlich belastbare Studien der Auswirkungen des Angelns und anderer Freizeit- nutzungen müssen Kontrollgewässer ohne anglerische Nutzung einschließen. Genau diese Art von Untersuchungskonzept wendet die vorliegende Studie an, indem ein Raum-für- Zeit-Substitutionskonzept zur Wirkung der anglerischen Freizeitnutzung auf die Biodiver- sität ausgewählter Artengruppen über eine Vielzahl bewirtschafteter und unbewirtschafteter Baggerseen vorgestellt wird. Substantielle Veränderungen der Häufigkeit störungssensitiver Arten in Reaktion auf die anglerische Baggerseenutzung sollten sich langfristig in veränder- ten aggregierten Diversitätsmaßen (z. B. Artenzahl, Simpson-Index) der Artengemeinschaft als Ganzes manifestieren. Dementsprechend fokussiert vorliegende Studie auf diese aggre- gierten Diversitätsmaße, die substantielle Veränderungen sowohl in der Anzahl als auch in der relativen Häufigkeit der Arten zueinander abbilden, ohne jedoch das Vorkommen ein- zelner Arten an sich zu bewerten. Ziel vorliegender Studie war es zum einen, den Umfang vorhandener Stillgewässerlebens- räume in Niedersachsen zu kartieren, und zum anderen die potenziellen Auswirkungen des Angelns auf die Biodiversität künstlich geschaffener, kleiner Baggerseen als dominierender Standgewässertyp der Studienregion Niedersachsen vergleichend zu untersuchen. Dafür wurden anglerisch bewirtschaftete und nicht bewirtschaftete Baggerseen in Niedersachsen ausgewählt und deren Artenvielfalt, Artendiversität und Naturschutzwert am Beispiel von acht naturschutzfachlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen vergleichend analysiert und bewertet: Ufervegetation, submerse Makrophyten, Groß- und Kleinlibellen, Amphibien, Fische, Sing- und Wasservögel. Aufbauend auf den Ergebnissen werden Rückschlüsse auf die ökologischen Störwirkungen von Anglern und ihrer fischereilichen Hege auf die Biodi- versität von Baggerseen getroffen. 2 Methodik Erfassung aller Standgewässer in Niedersachsen Die Geoinformationen aller stehenden Gewässer in Niedersachsen wurden aus dem frei verfügbaren Kartennetzwerk OpenStreetMap (www.openstreetmap.org/copyright) und der Gewässerdatenbank MARS (Globevnik et al. 2017) extrahiert und in eine GIS Datenbank überführt. Mittels Polygon-Extrapolation wurden dann die Flächen der Wasserkörper er- rechnet. Die Unterscheidung zwischen natürlichen Seen und künstlichen Wasserkörpern er- folgte über die Recherche der natürlichen Wasserkörper in Niedersachsen. Dabei wurden sowohl behördliche Quellen (Grudzinski et al. 2010) als auch frei verfügbare Internetquel-
156 len sowie persönliche Gespräche mit lokalen Anliegern herangezogen. Als (potentiell) künstliche Wasserkörper wurden alle Gewässer definiert, die nicht sicher als Naturseen identifiziert werden konnten. Da die Anzahl der Naturseen in Niedersachsen überschaubar und gut bekannt ist, wurden alle relevanten Naturseen >10 ha Fläche identifiziert. Bei Ge - wässern unter 10 ha war die Zuordnung unsicher und für Gewässer kleiner als 1 ha kaum möglich. Es ist davon auszugehen, dass die meisten dieser kleinen Gewässer künstlichen Ursprungs sind, obwohl es in der Region ursprünglich auch sehr kleine Naturseen gab und einzelne Gewässer möglicherweise nicht als solche identifiziert werden konnten. Untersuchungsgebiet und Auswahl der Baggerseen Das Untersuchungsgebiet umfasste insgesamt 26 Baggerseen in Niedersachsen mit einer maximalen Fläche von 20 ha. Davon waren 16 Baggerseen im Eigentum von Angelvereinen und daher anglerisch bewirtschaftet, während 10 Baggerseen anglerisch unbewirtschaftet waren (Abb. 1, Tab. A1). Abb. 1: Übersichtskarte der untersuchten Baggerseen in Niedersachsen mit Visualisierung der vier Flussgebiete Elbe (rosa), Ems (grün), Weser (gelb) und kleiner Nordsee-Zuflüsse (blau) Zunächst wurden über das Anschreiben aller Angelvereine, die im Anglerverband Nieder- sachsen e.V. organisiert sind, interessierte Vereine identifiziert, die Baggerseen bewirtschaf- ten und sich an den Untersuchungen beteiligen wollten. Aus dem Pool der benannten Seen wurde eine Reihe bewirtschafteter Seen zufällig ausgewählt. Anschließend wurden mög- lichst in unmittelbarer räumlicher Nähe ähnlich große, unbewirtschaftete Baggerseen iden- tifiziert und als Kontrollgewässer in den Versuch integriert. Dieses gepaarte Untersu- chungskonzept war nicht in allen Fällen umsetzbar, da manchmal keine unbewirtschafteten
157 Vergleichsgewässer in unmittelbarer Nähe zu einem bewirtschafteten See lagen. In solchen Fällen wurde der nächstgelegene unbewirtschaftete See in die Untersuchung einbezogen. Anglerisch bewirtschaftete Gewässer zeichneten sich durch regelmäßige Besatzmaßnahmen und Angelaktivitäten aus. Bei den unbewirtschafteten Gewässern handelte es sich überwie- gend um Privateigentum, Gewässer von Naturschutzstiftungen oder auf Firmengeländen mit beschränktem Zugang, an denen keine fischereilichen Aktivitäten stattfanden (Anhang Tab. A1). Bei den bewirtschafteten Seen handelte es sich in der Regel um beliebte Angelge- wässer der Vereine. Laut separat durchgeführten Erhebungen entsprach die potentielle An- gelintensität (Vereins-Mitglieder je Vereins-Gewässerfläche) an den ausgewählten Seen mit im Mittel 21 Angler/ha Seefläche dem deutschen Durchschnitt mit 24 Angler/ha Seefläche (Theis et al. 2017). Landnutzung und Urbanisierung Zu jedem Gewässer wurden verschiedene Landnutzungs-, Wasser-, Urbanisierungs- und Freizeitnutzungsvariablen erfasst. Die Distanz zur nächsten Stadt, Dorf, See, Fließgewässer etc. wurde mittels Google maps berechnet (© 2017). Die anteiligen Landnutzungen inner- halb eines Umkreises von 100 m um das Gewässer wurden mit QGIS 3.4.1 mit GRASS 7.4.2 unter Nutzung von ATKIS® Landnutzungsdaten mit einer Rasterauflösung von 10 x 10 m (© GeoBasis-DE/AdV 2006, BKG 2013) bestimmt. Die Landnutzungen wurden in folgende Kategorien unterteilt: (1) Urban: Alle menschlichen Infrastrukturen wie Gebäude, Straßen, Bahngleise). (2) Landwirtschaft: Alle Anbauflächen wie Äcker, Felder oder Streu- obstwiesen, jedoch keine Wildwiesen oder Weiden. (3) Wälder und Forste. (4) Feuchtgebie- te wie Sümpfe und Moore. (5) Abgrabungen: Offene Abbauflächen oder Kiesgruben. (6) Wasserflächen: Seen, Flüsse, Kanäle und (7) Andere Landnutzungen, d.h. Nutzungen, die keiner der vorab genannten Kategorien zugehörig waren. Gewässerstrukturen, Uferstrukturen und Wasserqualität Mit einem SIMRAD NSS7 evo2 Echolot und einem Lawrence TotalScan Signalgeber wurde die komplette Wasserfläche zwischen Juli und August in dichten Transekten (25-40 m Ab- stand) mittels Boot abgefahren, um Gewässertiefe und die Ausbreitung von Unterwasser - pflanzen zu erfassen. Tiefenkarten wurden mit einem Kriging-Verfahren mit dem gstat- package in R (Gräler et al. 2016, R Core Team 2013) erstellt. Mit diesen Daten wurden die maximale und relative Tiefe (Damnjanović et al. 2018) berechnet. Mittels QGIS 3.4.1 wur- den zudem Uferlänge und Wasserfläche in Relation gestellt und daraus der Uferentwick- lungsfaktor (Hutchinson 1957) ermittelt. Während der Frühjahrsvollzirkulation wurden die Konzentration an Gesamtphosphor (TP), Gesamt-Kohlenstoff (TOC), Ammonium und Nitrat (NH4, NO3) sowie Chlorophyll a (Chl-a) als Maß der Algenbiomasse erhoben. Au- ßerdem wurden pH-Wert, Leitfähigkeit und Secchi-Tiefe gemessen. Tier- und Pflanzenarten und Strukturvielfalt Die Bestimmung der Arten- und Strukturvielfalt an den Untersuchungsgewässern erfolgte zwischen 2016 und 2018, wobei die Datenaufnahme für jedes Gewässer binnen eines Kalen- derjahres abgeschlossen war. Es wurde Wert gelegt auf die Erhebung mehrerer Artengrup- pen über eine Vielzahl von Seen und einen vergleichenden Ansatz, in dem das Artenvor- kommen in möglichst vielen bewirtschafteten mit unbewirtschafteten Seen verglichen wurde. Dafür wurden aus Gründen der Machbarkeit (gleichzeitige Analyse in 26 Seen) Abstriche bei der Suche nach seltenen Arten innerhalb bestimmter Taxagruppen gemacht.
158 Die Untersuchung erhebt daher keinen Anspruch, das vollständige Arteninventar nachge- wiesen zu haben, insbesondere bei mobilen Arten wie Libellen, Fischen oder Vögeln. Aber bei diesem Fehler handelt es sich um einen systematischen Fehler, der beide Seetypen trifft und die Robustheit der für vorliegende Studie relevanten relativen Aussagen zum mittleren nachweisbaren Artenaufkommen in beiden Seetypen nicht beeinflusst. Die Besonderheit vorliegender Studie ist, dass ein ganzes Bündel von Artengruppen gleichzeitig untersucht wird, was in der Literatur zu Auswirkungen der Freizeitnutzung von Gewässern selten ist (Völkl 2010). Zur Erhebung der Uferhabitate und des litoralen Totholzes wurde ein Plot-Konzept nach Kaufmann & Whittier (1997) erstellt. Menge, Volumen und Komplexität des vorge- fundenen Totholzes sowie alle Vegetations- und Strukturdaten wurden nach Newbrey et al. (2005) sowie Kaufmann & Whittier (1997) aufgenommen. Die Arten und Abundanz der Ufervegetation im Uferrandstreifen wurden im Mai aufgenommen. An jedem Gewässer wurden insgesamt vier Transekte parallel zur Uferlinie von je 100 m Länge untersucht; je ein Transekt am Nord-, Ost-, Süd- und Westufer. In jedem Transekt wurden im 20 m Ab - stand fünf Vegetationsaufnahmen in Plots von je 1 m 2 Fläche durchgeführt. Bäume über 3 m Höhe wurden entlang des gesamten Transekts gezählt. Alle Arten (krautige Vegetation in Plots, Bäume entlang des Transekts) wurden nach Spohn et al. (2015) bestimmt. Die Abun- danz jeder Art wurden nach Braun-Blanquet (1964) geschätzt. Das nationale Arteninventar der Farn- und Blütenpflanzen wurde der Roten Liste Deutschlands (Ludwig & Schnittler 1996) entnommen. Die Erhebung der submersen Makrophytenarten erfolgte zwischen Ende Juni und Ende August nach Schaumburg et al. (2014) mittels Tauchbeprobung. Die betauchten Transekte verliefen vom Ufer bis zur Vegetationsgrenze, bzw. bis zur Seenmitte, und lagen im Ab - stand von jeweils 80-150 m (je nach Gewässergröße) zueinander. Die Makrophytenenarten wurden nach Van de Weyer & Schmitt (2011) vor Ort bestimmt. Bei Unsicherheiten wur- den UProben zur späteren Nachbestimmung mitgenommen. Die Charophyceae wurden nur auf Gattungsniveau (Chara sp. und Nitella sp.) bestimm und als zwei Artengruppen in die Analysen aufgenommen. Die Dominanzwerte aller Arten wurden nach Kohler (1978) unter Wasser bestimmt und später nach Van der Maarel (1979) in Deckungsgrade umge- wandelt. Das nationale Arteninventar der submersen Makrophyten wurde Van de Weyer & Schmitt (2011) entnommen. Die Amphibien wurden während der Paarungszeit (von März bis Mai) aufgenommen. Je- der See wurde zweimal untersucht. Zum einen wurde tagsüber mit einem Schlauchboot langsam das Ufer abgefahren und nach adulten Tieren, Laichballen (Frösche) und Laich- schnüren (Kröten) gesucht, zum anderen wurde nach Sonnenuntergang der See zu Fuß um- rundet, um rufende Adult-Tiere aufzunehmen. Jede Beobachtung (Adult oder Laich) wurde mit einem GPS (Garmin Oregon 600) markiert, vor Ort nach Schlüpmann (2005) identifi- ziert oder für eine spätere Identifizierung fotografiert. Die Arten des Wasserfrosch-Kom- plexes (Pelophylax sp.) wurden als eine Artengruppe in die Analyse aufgenommen und nicht bis auf Artniveau bestimmt. Anzahlen wurden exakt notiert (Adult) bzw. geschätzt (Laich), wobei von 700 bis 1500 Eiern je Ballen (Frösche) bzw. 10.000 Eiern je m2 (bei 100 % Bedeckung) Laichschnur-Ansammlung (Kröten) ausgegangen wurde (Trochet et al. 2014). Das nationale Arteninventar der Amphibien (ohne Salamander) wurde der Roten Liste Deutschlands (Kühnel et al. 2009) entnommen. Libellen wurden im Früh- bis Mittsommer an einem Termin je Gewässer erfasst. Am Tag wurde die gesamte Uferlinie nach Individuen abgesucht. Sitzende oder auffliegende Imagi- nes wurden mit einem Libellen-Netz (0,2 mm Maschenweite, bioform.de) gefangen, vor
159
Ort nach Lehmann & Nüss (2015) bestimmt und wieder frei gelassen. Das nationale Arten-
inventar der Groß- und Kleinlibellen wurde der Roten Liste Deutschlands (Ott et al. 2015)
entnommen.
Wasservögel wurden während jeder Gewässerbegehung (zwischen 6-9 Begehungen je
Gewässer) nach Dierschke (2016) bestimmt und gezählt. Zur Erhebung der Singvögel wur-
den einmalig entlang der Uferlinie in jeweils 200 m Abstand voneinander Audioaufnahmen
von je 2 Minuten Dauer aufgenommen (ZOOM Handy Recorder H2, Surround 4-Channel
Einstellung, 44.1kHz Frequenz, 16 bit Quantifikation). Daraus wurden anschließend die
Vogelstimmen mithilfe einer Audio-Software identifiziert (BirdUp - Automatic Birdsong
Recognition, entwickelt von Jonathan Burn, Version 2018) und die Arten mittels Referenz-
Aufnahmen bestimmt. Das nationale Arteninventar der Wasser- und Singvögel wurde der
Roten Liste Deutschlands (Grünberg et al. 2015) entnommen.
Zur Bestimmung der Fischartenvielfalt wurden 25 (16 bewirtschaftet und 9 unbewirt-
schaftet, Abb. 1, Tab. A1) der insgesamt 26 Gewässer im Herbst 2016, 2017 oder 2019 ent-
lang der gesamten Uferlinie mit einem Elektrofischfanggerät befischt (FEG 8000, 8 kW,
150-300/300-600 Volt, EFKO Fischfanggeräte GmbH, www.efko-gmbh.de). Zusätzlich
wurden Multimaschenstellnetze standardisiert eingesetzt, um die Fischartengemeinschaft
auch auf Gesamt-Seeebene zu erfassen. Hierfür wurde der CEN Standard zur Fischartener-
fassung im Rahmen der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Appelberg 2000, CEN 14757) gemäß
Matern et al. (2019) für kleinere Gewässer angepasst. Das nationale Arteninventar der Fi-
sche wurde der Roten Liste Deutschlands (Freyhof 2009) entnommen.
Der Artenreichtum der einzelnen Taxa an jedem Gewässer wurde anhand von Präsenz-
Absenz Daten ermittelt. Nach Oertli et al. (2002) wurde zusätzlich zur Artenzahl ein ge-
wichteter „Naturschutzwert“ für jedes Gewässers pro Taxon berechnet. Der logarithmisch
nach Schutzstatus gewichtete Naturschutzwert für eine Artengemeinschaft steigt nichtlinear
mit den Vorkommen seltener und bedrohter Arten an (Tab. 1). Der Schutzstatus jeder vor-
kommenden Art wurde anhand der Roten Listen Deutschlands (Freyhof 2009, Grünberg et
al. 2015, Korsch et al. 2013, Kühnel et al. 2009, Ludwig & Schnittler 1996, Ott et al. 2015)
bestimmt. Je höher der Schutzstatus, desto stärker wurde das Auftreten einer Art gewichtet
(Tab. 1).
Tab. 1: Rangfolge der Rote Liste Kategorien zur Berechnung der gewichteten Naturschutzwerte
Status auf der Roten Liste Rang Gewichtung
Deutschlands
1 – vom Aussterben bedroht 4 16
2 – stark gefährdet
3 8
R – extrem selten
3 – gefährdet
G – Gefährdung unbekannten 2 4
Ausmaßes
V – Vorwarnliste 1 2
* – ungefährdet
0 1
- – Daten unzureichend
Dementsprechend indiziert ein hoher Naturschutzwert, dass die lokale Artengemeinschaft
einer Organismengruppe viele national bedrohte Arten umfasst. Zudem wurde der Simp-
son-Index als Diversitätsmaß der Artengemeinschaft berechnet (Simpson 1949), welcher die
relativen Häufigkeiten jeder Art berücksichtigt und somit eine zusätzliche Aussage über die
Zusammensetzung der Artengemeinschaften liefert. Bei den Fischen wurden die Abundanz-160 daten aus der Elektrofischerei zur Ermittlung des Simpson-Index herangezogen, da die Uferfischgemeinschaft artenreicher ist (Diekmann et al. 2005). Freizeitnutzungen Bei jeder Gewässerbegehung wurde die Anzahl von Erholungssuchenden und deren Frei- zeitaktivitäten aufgenommen (6-9 Begehungen je Gewässer). Dazu wurden über einen zu- fälligen Zeitraum von mindestens drei Stunden je Tag alle am See angetroffenen Besucher erfasst. Da es sich ganz überwiegend um relativ kleine, überschaubare Baggerseen handelte, ist von einer Vollerfassung auszugehen. Zusätzlich wurden indirekte Nachweise der Inten- sität der freizeitlichen Nutzungen erfasst. Dazu wurde jeder See mit einem Messrad (NESTLE Cross-country Messrad, Modell Nr. 12015001, mit 2 m Umfang und 0,1 % Ge - nauigkeit) umrundet und die Längen aller Wege und Pfade am See gemessen. Diese wurden aufsummiert und durch die Länge der Uferlinie geteilt. Angelplätze und offene Flächen ent- lang der Uferlinie wurden gezählt und vermessen. Jede offene bzw. Angel-Stelle wurde standardisiert (in 0,25m2-Plots und gesamt) nach Müll abgesucht und alle gefundenen Ab- fälle gezählt, gewogen und einer der beiden Kategorien zugeordnet: (1) angelspezifisch (z.B. Bleigewicht, Nylonschnur, Kunstköder) oder (2) nicht angelspezifisch (z.B. Kunststoffver- packungen, Bierflaschen, Zigaretten). Statistische Analyse Die beiden Gewässertypen (bewirtschaftet vs. unbewirtschaftet) wurden in Bezug auf Mit- telwert- bzw. Medianunterschiede der Umweltvariablen, Artenzahlen, Naturschutzwert und Simpson-Diversitätsindex mittels t-Test nach Student (wenn Varianzhomogenität und Normalerteilung nach Shapiro-Wilk-Test gegeben war), Welch-F-Tests (Normalverteilung ohne Varianzhomogenität) oder Mann-Whitney-U-Test getestet. Bei multiplen univariaten Vergleichen wurden die p-Werte korrigiert (Šidák 1967). Für alle Analysen wurde das Sta- tistikprogramm R verwendet (R Core Team 2013). Detaillierte multivariate Analysen fin- den sich in begleitenden Fachpublikationen (Matern et al. 2019, Nikolaus et al. 2020). 3 Ergebnisse Erfassung der Standgewässer Niedersachsens In Niedersachsen wurden 38151 stehende Gewässer mit einer Gesamtfläche von 35048 ha ermittelt (Abb. 2Fehler: Verweis nicht gefunden, Tab. 2). Insgesamt 3632 Standgewässer hatten Gewässerflächen von 1 ha und mehr mit einer Gesamtfläche von 29879 ha. Nur 580 Seen wiesen über 10 ha Fläche auf (59 % der gesamten Wasserfläche), wovon lediglich 99 (22 % der gesamten Wasserfläche) natürlichen Ursprungs waren. Dementsprechend wird festgestellt, dass der weit überwiegende Teil stehender Gewässer über 10 ha in Niedersachsen künstlichen Ursprungs ist (Abb. 2, Tab. 2). Bei den Standgewässern unter 10 ha Größe war eine zweifelsfreie Einteilung in Naturseen und künstlich geschaffenen Gewässern wie bereits erwähnt nicht möglich. Es ist aber davon auszugehen, dass die 37571 Gewässer dieser Kategorie ebenfalls hauptsächlich künstlichen Ursprungs sind, da trotz intensiver Recherche sehr kleine Naturgewässer (
161
Abb. 2: Übersichtskarte aller erfassten Standgewässer in Niedersachsen
Tab. 2: Übersicht aller identifizierten Gewässer in Niedersachsen nach Anzahl und Fläche in unter-
schiedlichen Kategorien
Gewässerkategorie Gewässerzahl Anteil Fläche in ha Anteil
potenziell künstlich
34.519 90 % 5169 15 %
(0-1 ha)
potenziell künstlich
3.052 8% 8972 26 %
(1-10 ha)
Baggersee
465 1% 11461 33 %
(> 10 ha)
Talsperre/Speichersee
16 10 ha)
Natursee
99 10 ha)
Gesamt 38151 100 % 35049 100 %
Umweltfaktoren der Untersuchungsgewässer
Die 26 untersuchten Baggerseen waren relativ jung (Mittelwert ± Standardabweichung [SD]
27,3 ± 13,3 Jahre, min.-max. 6-54 Jahre), klein (6,7 ± 5,1 ha, 0,9-19,6 ha), flach (max. Tiefe
9,7 ± 5,1 m, 1,6-24,1 m) und mesotroph (Gesamtphosphor 26,3 ± 30,4 µg/l, 8-160 µg/l) bei
einer durchschnittlichen Sichttiefe (Secchi-Tiefe) von 2,4 ± 1,4 m (0,5-5,5 m). Die Landnut-
zung innerhalb der 100 m Pufferzone um die Gewässer variierte stark. Der relative Anteil
ackerbaulicher Nutzung betrug 27 ± 22 % (2,4-79 %) und der relative Anteil forstwirt-
schaftlicher Nutzung 16 ± 21 % (0-68 %). Die Seen lagen nah an Siedlungen (mittlere Di-
stanz zur nächsten Ortschaft 618,3 ± 523,1 m, 20-1810 m) und weiteren Gewässern (mittle-
re Distanz zum nächsten See, Fluss oder Kanal 55,8 ± 84,7 m, 1-305 m). Die 26 unter-162
suchten Baggerseen waren über vier Flussgebiete verteilt: Elbe, Ems, Weser und kleine
Nordsee-Zuflüsse (Abb. 1). Die meisten Seen wurden unabhängig vom individuellen
Schutzstatus durch den Menschen legal oder illegal genutzt und waren durch Wege und
Parkplätze erreichbar (Details zu allen Messwerten sind im Anhang Tab. A2-A5 gelistet).
Die Baggerseen wiesen fortgeschrittene Sukzessionsstadien auf und sahen sämtlich sehr
naturnah aus (Abb. 3). Bewirtschaftete und unbewirtschaftete Baggerseen unterschieden
sich im Mittel bzw. Median weder in ihrem Alter noch in ihrer Morphologie, Nährstoff -
reichtum, Nähe zu anderen Wasserkörpern oder Siedlungen, Ausdehnung des Litorals,
Menge an Totholz im Gewässer, Ausdehnung von Schilfpflanzen am Ufer, dem Deckungs-
grad von Uferpflanzen oder der Landnutzung in einem Umkreis von 100 m (alle p-Werte
>0,05, Anhang Tab. A6).
Abb. 3: Beispiel eines untersuchten Baggersees (Linner See im Landkreis Osnabrück)
Es bestand ein starker statistischer Trend zu höheren Deckungsgraden von Unterwasser-
pflanzen in bewirtschafteten Seen (Pflanzendeckungsgrad in % ± SD: 39,3 ± 19,9, min.-
max. 12,5-82,3; gegenüber: 21,1 ± 27,5, 0-85,2; U-Test, W = 126, p = 0,083) sowie eine signi-
fikant höhere Freizeitnutzungsintensität durch Angler (p163
Tab. 3: Vergleiche der nutzungsabhängigen Umweltvariablen zwischen anglerisch bewirtschafteten
und unbewirtschafteten Baggerseen. P-Werte sind Sidak-korrigiert, um den multiplen Vergleich von
Nutzungsindikatoren zu berücksichtigen ( ´ = statistischer Trend, * = signifikant, ** = hoch signifikant)
Umweltvariable Mittelwert ± SD Median (min. – max.) Tests auf Unterschiede
(Einheiten) bewirtschaftet unbewirtschaftet Test Test-Statistik p-Wert
(n = 16) (n = 10)
0,05 ± 0,05 0,002 ± 0,007
Anglermüll
0,03 0,00 U-test W = 140,5 0,007**
(Anzahl pro Ufermeter)
(0-0,20) (0-0,021)
0,70 ± 0,50 0,34 ± 0,71
Sonstiger Müll
0,58 0,05 U-test W = 126 0,124
(Anzahl pro Ufermeter)
(0,02 - 1,48) (0 - 2,29)
Angelstellen und Anteil of- 18,5 ± 19,8 8,4 ± 14,4
fener Uferbereiche 16,4 4,6 U-test W = 133 0,044 *
(% Ufer ohne Bewuchs) (3,6 - 87,7) (0 - 48,6)
0,9 ± 0,1 0,4 ± 0,5
Trampelpfadlänge relativ
1,0 0,2 U-test W = 138 0,019 *
zur Uferlänge (m pro m)
(0,6 - 1,1) (0 - 1,4)
1,6 ± 1,6 0,1 ± 0,2
Angler pro See
1,1 0,0 U-test W = 143 0,006 **
(Anzahl pro Besuch)
(0 - 5,1) (0 - 0,8)
Spaziergänger mit Hund 1,7 ± 1,9 0,5 ± 1,0
pro See (Anzahl pro Be- 0,7 0,0 U-test W = 123,5 0,154
such) (0 - 6) (0 - 3,3)
2,9 ± 2,6 0,7 ± 1,0
Schwimmer pro See
2,3 0,3 U-test W = 129,5 0,075 ‘
(Anzahl pro Besuch)
(0 - 10) (0 - 3,1)
2,9 ± 3,2 0,9 ± 1,4
Andere Freizeitnutzer pro
1,5 0,3 U-test W = 128,5 0,087 ‘
See (Anzahl pro Besuch)
(0,3 - 11,9) (0 - 3,8)
Arteninventar
Insgesamt wurden 34 Wasservogelarten, drei Amphibienarten, 33 Libellenarten, 36 Singvo-
gelarten, 22 Fischarten, 39 submerse Makrophytenarten (bzw. –gattungen), 44 Baumarten
und 191 krautige Pflanzenarten erfasst (Anhang Tab. A8-A12). Diese Artausstattung reprä-
sentierte einen hohen Anteil des nationalen Arteninventars der Bäume (54 %), Wasservögel
(43 %) und Libellen (41 %). Hingegen wurden bei Singvögeln (33 %), Fischen (19 %), Am-
phibien (19 %), submersen Makrophyten (14 %) und krautiger Ufervegetation (6 %) weni-
ger als ein Drittel des nationalen Arteninventars nachgewiesen. Es wurden insgesamt 11 Ar-
ten gefunden, die in Deutschland nicht einheimisch sind: zwei submerse Makrophytenarten,
drei Baumarten, eine Libellenart, zwei Wasservogelarten und zwei Fischarten (vier Indivi-
duen: drei Blaubandbärblinge, Pseudorasbora parva, zwei in einem bewirtschafteten und ei-
ner in einem unbewirtschafteten See, und ein brauner Katzenwels, Ameiurus nebulosus, in
einem unbewirtschafteten Seen).
Die lokale Artenvielfalt und die Präsenz von bedrohten Arten waren an den einzelnen
Seen beider Gewässerkategorien sehr variabel, d. h. einzelne Seen unterschieden sich z. T.
deutlich im Artenvorkommen. Das Vorkommen bedrohter Arten war in beiden Seetypen
jedoch sehr ähnlich (Fehler: Verweis nicht gefundenTab. 4). Die meisten Gewässer
enthielten mindestens eine gefährdete Art jeder Organismengruppe. Innerhalb jedes Taxons
gab es mit Ausnahme der Amphibien mindestens fünf Arten, die ausschließlich in oder an
einem der untersuchten Gewässer nachgewiesen wurden. Die Anzahl der Arten, die
ausschließlich an einem See nachgewiesen wurde, war insbesondere bei den submersen
Makrophyten, bei den Singvögeln und bei der krautigen Ufervegetation hoch (Tab. 4).164
Tab. 4: Anzahl der ausschließlich in einem Bewirtschaftungstyp bzw. nur an einem einzigen Baggersee
nachgewiesenen Arten, sortiert nach insgesamt identifizierten Arten je Taxon. Die Prozente in
Klammern geben den Anteil am jeweiligen Arteninventar der Gewässerkategorie wieder
Taxon Anzahl der Arten, die exklusiv nachgewiesen wurden in/an
Gesamt- bewirtschafteten unbewirtchafteten einem einzigen See (unab-
Artenzahl Seen (n = 16) Seen (n = 10) hängig vom Typ) (n = 26)
Krautige 191 55 (33 %) 31 (21 %) 58 (30 %)
Ufervegetation
Bäume am Ufer 44 6 (15 %) 5 (13 %) 8 (18 %)
Submerse 39 13 (43 %) 9 (35 %) 20 (51 %)
Makrophyten
Singvögel 36 9 (30 %) 6 (22 %) 12 (33 %)
Wasservögel 34 10 (36 %) 6 (25 %) 6 (18 %)
Libellen 33 5 (19 %) 8 (28 %) 7 (21 %)
Fische 22 6 (33 %) 4 (25 %) 1 4 (18 %) 1
Amphibien 3 0 (0 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
1
Fischdaten sind nur von n = 9 unbewirtschafteten Seen vorhanden
Biodiversitäts-Unterschiede zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Bag-
gerseen
Bei den Uferkräutern, Uferbäumen und submersen Makrophyten fanden sich keine Unter-
schiede in Artenzahl, Naturschutzwert oder Simpson-Index zwischen bewirtschafteten und
unbewirtschafteten Baggerseen (Abb. 4, Anhang Tab. A7). Gleiches gilt für adulte Amphi-
bien, Groß- und Kleinlibellen (Abb. 5, Tab. A7) sowie für Wasser- und Singvögel (Abb. 6,
Tab. A7). Lediglich die Fische wiesen in bewirtschafteten Baggerseen signifikant höhere Ar-
tenzahlen (95 % Konfidenzintervall, 5-12 Arten) und Naturschutzwerte als in unbewirt-
schafteten Seen (95 % Konfidenzintervall, 3-8 Arten) auf (Abb. 6, Anhang Tab. A7). Die
Unterschiede bei den Fischen resultierten überwiegend aus höheren Artenzahlen anglerisch
beliebter Raubfische und größerer Cypriniden (z. B. Brassen, Abramis brama), während in
den unbewirtschafteten Seen vor allem Kleinfischarten nachgewiesen wurden. Allerdings
wurden auch in unbewirtschafteten Seen zum Beispiel Karpfen nachgewiesen, deren Vor-
kommen wahrscheinlich auf illegalen Besatz zurückgehen. Es ist zu resümieren, dass mit
Ausnahme der Fische die anglerische Bewirtschaftung der Baggerseen keinen Einfluss auf
die Vielfalt, Diversität und den Naturschutzwert der untersuchten Tier- und Pflanzengrup-
pen hatte.
4 Diskussion
Standgewässer in Niedersachsen
Erstmalig wurde eine vollständige Erfassung niedersächsischer Standgewässer vorgelegt, de-
ren Gesamtanzahl bisherige Schätzungen zur Anzahl der Baggerseen in den alten Bundes-
ländern (20.000 nach Bartmann et al. 1990) allein in Niedersachsen weit übersteigt. Die Ge-
samtanzahl von Baggerseen ist deutschlandweit also deutlich größer als bislang
angenommen. Dieser Gewässertyp ist der prägende Standgewässertyp in ansonsten gewäs-
serarmen Bundesländern wie Niedersachsen (Cyrus et al. 2020). Die Baggerseen, Teiche
und andere künstlich entstandenen Gewässer bilden heute ein enges Netzwerk aus nah be-
nachbarten aquatischen Lebensräumen und sind damit trotz struktureller und funktioneller
Einschränkungen gegenüber natürlichen Gewässern, z.B. Auengewässern (Köppel 1995),
bedeutend für den Schutz und den Erhalt der wassergebundenen Artenvielfalt an Seen
(Damnjanović et al. 2018, Emmrich et al. 2014, Matern et al. 2019, Santoul et al. 2009, Völkl
2010). Neben Baggerseen wurden auch andere künstlich geschaffene Gewässer in Deutsch-165 land als wichtige Sekundärhabitate für verschiedene, teilweise bedrohte, Organismen identi- fiziert, insbesondere Fischteiche oder urbane Kleingewässer (Holtmann et al. 2017, 2018). Abb. 4: Vergleiche der Artenzahl, des Simpson-Diversitätsindex und des Naturschutzwertes bei Ufer- kräutern, Bäumen und Wasserpflanzen zwischen bewirtschafteten (n = 16) und unbewirtschafteten (n = 10) Baggerseen. „Raute“ = Mittelwert, ̶ ̶ = Median, das obere und untere Ende der Boxen be - schreibt jeweils das obere und untere Quartil, Punkte beschreiben statistische Ausreißer, n.s. = nicht signifikant.
166 Abb. 5: Vergleiche der Artenzahl, des Simpson-Diversitätsindex und des Naturschutzwerts bei Amphi- bien, Großlibellen und Kleinlibellen zwischen bewirtschafteten (n = 16) und unbewirtschafteten (n = 10) Baggerseen. „Raute“ = Mittelwert, ̶ ̶ = Median, das obere und untere Ende der Boxen beschreibt je- weils das obere und untere Quartil, Punkte beschreiben statistische Ausreißer, n.s. = nicht signifikant.
167 Abb. 6: Vergleiche der Artenzahl, des Simpson-Diversitätsindex und des Naturschutzwerts bei Was- servögeln, Singvögeln und Fischen zwischen bewirtschafteten (n = 16) und unbewirtschafteten (n = 10 bei Vögeln, n = 9 bei Fischen) Baggerseen. „Raute“ = Mittelwert, ̶ ̶ = Median, das obere und untere Ende der Boxen beschreibt jeweils das obere und untere Quartil, Punkte beschreiben statistische Aus- reißer, n.s. = nicht signifikant, ** = hoch signifikant Die vorgelegten Daten zeigen, dass niedersächsische Baggerseen, die von Anglern genutzt und bewirtschaftet werden, einen geeigneten Lebensraum für diverse Taxagruppen bieten, mit Ausnahme der Amphibien. Die an den Seen nachgewiesenen Arten repräsentierten bei einigen Taxa einen hohen Anteil des nationalen Arteninventars, sowohl bei aquatischen als auch bei ufergebundenen Arten. Einige der nachgewiesenen Arten sind überdies national bestands-bedroht. Wie auch in anderen Lebensraumtypen ist an Baggerseen nicht das voll- ständige nationale Arteninventar zu erwarten, da einige Arten Lebensraumansprüche ha- ben, die an Baggerseen nicht realisierbar sind. Zum Beispiel können in Baggerseen keine ty - pischen Arten der Fließgewässer und Fluss-Fischarten existieren. Baggerseen in Nieder-
168 rsachsen stellen stattdessen für stagnophile Arten, sowohl bei Fischen als auch anderen Organismengruppen, geeignete Sekundärhabitate in Landschaften dar, die arm an Na- turseen sind. Einfluss von Angelnutzung auf die Biodiversität an Baggerseen Im Rahmen eines vergleichenden und im Raum replizierten Beprobungsschemas auf der Ebene ganzer Baggerseen und für ganze Artengemeinschaften über zahlreiche gewässerge- bundene Taxa wurde nachgewiesen, dass bewirtschaftete und unbewirtschaftete Baggerseen in landwirtschaftlich geprägten Kulturlandschaften für die überwiegende Anzahl der unter- suchten Taxa vergleichbare Artenzahlen und Diversitäten sowie einen ähnlichen Natur- schutzwert entwickeln. Das gilt allerdings nicht für Fische, bei denen bewirtschaftete Bag - gerseen artenreichere Gemeinschaften aufwiesen als unbewirtschaftete. Insgesamt zeigen die Daten, dass die anglerische Bewirtschaftung der Fischbestände und eine damit verbundene angelfischereiliche Nutzung der Ufer die Etablierung eines reichen Arteninventars unter- schiedlicher Tier- und Pflanzenarten in und an Baggerseen nicht einschränkt, der Natur- schutzwert sich nicht reduziert und dass bei einigen Artengruppen wie den Fischen die Bio- diversität sogar positiv beeinflusst wird (Matern et al. 2019). Weiterführende multivariate statistische Analysen des hier exemplarisch zusammengefassten Datensatzes zeigten, dass an den untersuchten Baggerseen für alle untersuchten Taxa sowohl das angelfischereiliche Ma- nagement als auch die Freizeitnutzung keinen Einfluss auf die Artenvielfalt hatten (vgl. Ni- kolaus et al. 2020 zu den Details). Freizeitnutzung im Rahmen der Angelfischerei und Ar- tenschutz schließen sich an Baggerseen in agrarwirtschaftlich geprägten Landschaften folglich nicht aus. Zudem zeigte der Simpson-Index, der die relative Abundanz der Arten einer Gemeinschaft berücksichtigt, bei allen Taxa keinerlei Unterschiede zwischen den bei- den Bewirtschaftungsformen an; identische Ergebnisse liegen auch für den Shannon-Index vor, die aus Platzgründen nicht in das Manuskript eingeflossen sind. Daher kann die angle- rische Freizeitnutzung der untersuchten Gewässer als wesentliche Störwirkung auf die Tier- und Pflanzenwelt ausgeschlossen werden, sofern die potentielle Störung durch Angler an aggregierten Indizes des Artenreichtums, an der Simpson-Diversität oder an nach dem Be- drohungsstatus gewichteten Naturschutzwerten der nachgewiesenen Gemeinschaft abgele- sen wird. Das schließt nicht aus, dass einzelne Arten – insbesondere sehr störungssensitive Arten – beeinflusst werden (z. B. Reichholf 1970), was eine artspezifische Betrachtung ver - langt, die in vorliegender Studie im Sinne einer ganzheitlichen Betrachtung über multiple Arten nicht vorgenommen wurde. Anglerisch bewirtschaftete Gewässer wiesen eine bessere Erreichbarkeit und Zugänglich- keit durch Wege und Parkmöglichkeiten auf und waren dementsprechend auch für andere Freizeitaktivitäten als das Angeln einfacher zugänglich. Trotz der signifikant höheren In- tensität freizeitlicher Nutzungen zeichneten sich bewirtschaftete Gewässer mit Ausnahme der Fische aber bei allen untersuchten Taxa durch eine ähnliche Artenvielfalt und einen ähnlichen Naturschutzwert wie die unbewirtschafteten Seen aus. Zu berücksichtigen ist al - lerdings, dass alle bewirtschafteten Gewässer in dieser Studie im Eigentum von Angelverei- nen waren, welche ihrerseits diverse Alternativnutzungen im Rahmen der Fischereikontrol- le einschränken. Dies betrifft insbesondere den Badebetrieb, Boot fahren, Partys, offenes Feuer und Grillen sowie Schwarzangeln. Spaziergänger mit und ohne Hund hingegen wer- den in der Regel an den Angelgewässern nicht eingeschränkt. Die anglerische Nutzung wirkt somit auch eingrenzend gegenüber störungsintensiven Alternativnutzungen, was wie- derum die vorgefundene Artenvielfalt an den untersuchten bewirtschafteten Gewässern be-
169
einflusst haben könnte. Möglicherweise ist die Störungsintensität an größeren Baggerseen,
die von Motorbooten befahrenen werden, stärker als in vorliegender Studie abgebildet wird.
All diese Möglichkeiten ändern aber nicht die Schlussfolgerung, dass das vorliegende Da-
tenmaterial keine Nachweise für eine spezifisch durch das Angeln und die anglerische Be -
wirtschaftung ausgelöste Wirkung auf die Artenvielfalt und den Naturschutzwert von Li-
bellen, Pflanzen, Amphibien, Fischen und Vögeln liefert, sofern diese Wirkung an
aggregierten Diversitätsmaßen ohne spezifische Betrachtung des Vorkommens einzelner
Arten ablesbar ist.
Aufgrund früherer Studien wurde erwartet, dass anglerisch bewirtschaftete Seen stark
veränderte Uferlinien und eine reduzierte Pflanzendecke im Uferrandstreifen aufweisen,
weil Angler über Pflegemaßnahmen Angelstellen herstellen und den Zugang zum Ufer und
Wasser verbessern (O’Toole et al. 2009). Obwohl tatsächlich eine erhöhte Zugänglichkeit
an anglerisch bewirtschafteten Baggerseen nachgewiesen wurde (insbesondere mehr Weg-
strecke und offene Stellen), war die Ausdehnung der terrestrischen Ufervegetation an be-
wirtschafteten Baggerseen ähnlich ausgeprägt wie an unbewirtschafteten, und bei den sub-
mersen Makrophyten zeigten sich bewirtschafte Seen sogar stärker bewachsen als
unbewirtschaftete Vergleichsgewässer. Diese Ergebnisse zeigen, dass ein ausreichender Ge-
wässerzugang für Angler nicht zwangsläufig stark veränderte Uferhabitate nach sich zieht.
Natürlich haben Angler ein Interesse daran, dass ein gewisser Zugang zum Gewässer ge-
währleistet bleibt (Meyerhoff et al. 2019), gleichzeitig liegt es jedoch auch in ihrem Interes-
se, geeignete Habitate für ihre Zielfischarten zu entwickeln und zu fördern und über die
Förderung von „Sichtschutz“ zwischen Angelstellen auch die Qualität des Freizeiterlebnis-
ses (Ruhe, Entspannung) zu gewährleisten (Beardmore et al. 2015, Meyerhoff et al. 2019).
Diese Art der Uferpflege kann wiederum auch direkten positiven Einfluss auf die Biodiver -
sität weiterer Taxa haben. Die litorale Uferzone zählt zu den produktivsten Habitaten von
Seeökosystemen (Winfield 2004). Viele Zielfischarten von Anglern sind zur Reproduktion
und als Jungfischrefugium von Wasser- und Uferpflanzen abhängig (Lewin et al. 2014).
Deshalb sind an den meisten der untersuchten Baggerseen die Angelstellen mosaikartig zwi-
schen langen Streifen intakter Uferstrecken angelegt (Abb. 3). An vielen der Seen wurden
von den Angelvereinen auch selbstmotiviert Schutzzonen etabliert, die nicht beangelt oder
betreten werden dürfen, um Rückzugsräume für Fische und sonstige Tier- und Pflanzenar-
ten zu bieten. Ob diese Schutzgebiete besondere Refugien z. B. für störungssensitive Vogel-
arten bieten, muss in weiterführenden Studien geklärt werden.
Mosaikartig angelegte, diverse, strukturierte Habitate (wie Schilf und überhängende Bäu-
me usw.) bieten vielen Arten, nicht nur Fischen, geeignete Lebensräume (Holtmann et al.
2017, 2018, Kaufmann et al. 2014). Es wird vermutet, dass regelmäßige Uferpflegemaßnah-
men durch Angler im Sinne einer intermediären Störung die Sukzession von Bäumen parti-
ell unterbindet. Die dadurch weniger beschatteten Habitate entlang der Uferlinie fördern
wiederum das Aufkommen von Schilf und krautiger Vegetation (Nikolaus et al. 2020). Ins-
besondere Libellen profitierten von einem höheren Vorkommen vegetationsreicher Litoral-
habitate (Holtmann et al. 2018, Remsburg & Turner 2009). Diverse Kraut- und Schilfgürtel
stellen auch wichtige Lebensräume für viele weitere Arten dar (Paracuellos 2006, Shulse et
al. 2010). Allem Anschein nach wirken sich anglerische Uferpflegemaßnahmen und die ver -
ringerte Beschattung durch das partielle Offenhalten von Angelstellen positiv auf die ufer -
gebundene Artenvielfalt aus.
Frühere Studien wiesen auf den Rückgang der Wasservögel durch die Störwirkung von
Anglern hin (Reichholf 1970, 1988). Im Gegensatz zu diesen Arbeiten wurden an den hier
untersuchten anglerisch bewirtschafteten Baggerseen vergleichbar hohe Artenzahlen, Simp-170 son-Diversitäts-Indices und Naturschutzwerte der Wasservögel nachgewiesen wie an unbe- wirtschafteten Baggerseen. Weitergehende multivariate Analysen vorliegenden Datensatzes durch Nikolaus et al. (2020) zeigten, dass die Artenvielfalt der Wasservögel an Baggerseen hauptsächlich durch die Gewässergröße und die Steilheit der Ufer beeinflusst wird, wobei größere und flachere Seen eine höhere Artenvielfalt an Wasservögeln beherbergten. Dies steht in Übereinstimmung zur Literatur (Bell et al. 1997). Die Vielfalt und der Naturschutz- wert der Wasservögel werden an Baggerseen somit weniger von der Freizeitnutzung als vielmehr von den Gewässereigenschaften bestimmt. Grundsätzlich bestätigen die hier vor- gelegten Befunde nicht die oft zitierte Aussage, dass sich Angler schon bei geringen Dichten stark negativ auf die Wasservogelvielfalt an Gewässern auswirken (Reichholf 1970, 1988). Selbstverständlich ist diese Aussage auf die eingesetzten Indikatoren (Artenvielfalt, Simp- son-Index, Naturschutzwert) beschränkt und schließt nicht aus, dass das Angeln trotzdem die Populationsgröße von lärmsensitiven Arten negativ beeinflussen könnte. Auch ist unbe- kannt, wie die Vogelgemeinschaften in vollkommen ungestörten Vergleichsbaggerseen aus- sehen, da auch die hier untersuchten unbewirtschafteten Baggerseen Nutzungsspuren ande- rer Freizeitaktivitäten als Angeln aufwiesen. Fische wiesen als einzige Organismengruppe eindeutige Unterschiede in den Arteninven- taren zwischen bewirtschafteten und unbewirtschafteten Gewässern auf. Die hier unter- suchten Baggerseen waren isoliert, ohne direkte Verbindung zu anderen Gewässern, was die natürliche Zuwanderung von Fischen weitgehend ausschließt. Es ist daher anzunehmen, dass ein Großteil der Fischarten aus legalen, im Rahmen der fischereilichen Hege erfolgten, oder illegalen Besatzmaßnahmen stammt (Matern et al. 2019, Zhao et al. 2016). Angler be- wirtschaften ihre Seen über Initialbesatz und regelmäßige besatzgestützte Förderung angle- risch relevanter Arten, wie z. B. Hecht (Esox lucius) oder Karpfen, die dementsprechend in bewirtschafteten Seen flächendeckend vorkommen und die Artenzahlen erhöhen (Matern et al. 2019). Da aber kein einziges der untersuchten Gewässer fischfrei war und trotz insge- samt geringerer Artenzahlen in unbewirtschafteten Gewässern vergleichbare Abundanzen und Biomassen an Fischen wie in bewirtschaften Seen nachgewiesen wurden (Matern et al. 2019), wurden offenbar auch in den unbewirtschafteten Baggerseen illegal Fische einge- bracht. Selbst wenige, einmalig illegal aus Gartenteichen oder Aquarien entlassene Fische können eine Population etablieren. Deshalb erscheint es schwierig, unbewirtschaftete Bag- gerseen langfristig fischfrei zu halten. Das hier nachgewiesene Fischarteninventar der bewirtschafteten Baggerseen entsprach mit 7-11 Fischarten dem von Naturseen mit vergleichbarer Größe und Habitatausstattung (vgl. Emmrich et al. 2014). Wichtig ist auch, dass trotz anglerischer Bewirtschaftung die Fischartenzusammensetzung typisch für vergleichbare bewirtschaftete Naturseen war, und es in der Studienregion keine Hinweise auf verfremdete Artengemeinschaften mit einem ho- hen Anteil gebietsfremder Fischarten gab (Matern et al. 2019), wie es z. B. aus französischen Baggerseen von Zhao et al. (2016) dokumentiert und für Deutschland von Waterstraat (2002) und Weibel & Wolf (2002) vermutet wurde. Nur einer von 16 bewirtschafteten und zwei von neun unbewirtschafteten Seen beherbergten Einzelexpemplare nicht einheimischer Fischarten (Matern et al. 2019). Die Fischfaunen der unbewirtschafteten Baggerseen variier- ten jedoch stark von See zu See und waren insgesamt artenarm mit hoher Dominanz einzel- ner, anglerisch unbedeutender Kleinfischarten (vgl. Matern et al. 2019). Folglich fördert die fischereiliche Hege die lokale Fischdiversität (alpha-Diversität), reduziert aber durch Ho- mogenisierung die Variation der Fischgemeinschaften zwischen den Seen (beta-Diversität). Es ist zudem festzustellen, dass die in den bewirtschafteten Baggerseen nachgewiesene
171 Fischartengemeinschaft mit Ausnahme des Vorkommens von Aalen (Anguilla anguilla) dem Gewässertyp angepasst und naturnah war. Naturschutzkonflikte entstehen regelmäßig bei der fischereilichen Bewirtschaftung mit Karpfen, weil vermutet wird, dass sich Karpfen negativ vor allem auf Wasserpflanzenbe- stände und die Wasserqualität auswirken (Van de Weyer et al. 2015). In der Tat ist davon auszugehen, dass die Karpfen-Biomasse in bewirtschafteten Baggerseen höher ist als in un- bewirtschafteten (Borkmann 2001, Schälicke et al. 2012). Trotzdem wurden vergleichbare Artenzahlen und Diversität bei den submersen Makrophyten in bewirtschafteten Baggerse- en im Vergleich zu unbewirtschafteten festgestellt, die Pflanzen-Deckungsgrade waren in bewirtschafteten Baggerseen sogar im Mittel etwas größer (Nikolaus et al. 2020). Andere Studien zeigten, dass Karpfenbesatz bis zu einer Dichte von 180 kg/ha keine Effekte auf die Wassergüte in Baggerseen hat (Arlinghaus et al. 2017). Der Karpfen ist folglich bei modera - ten Besatzmengen, wie sie für viele bewirtschaftete Baggerseen in Niedersachsen typisch sind, nicht per se eine Bedrohung der Wassergüte oder der Wasserpflanzenbestände. In stark beangelten Seen wird auch ein Großteil der einmal besetzten Karpfen nach kurzer Zeit von Anglern zurückgefangen (Arlinghaus et al. 2017), was die Karpfenbiomassen in Gren - zen halten kann. Weitere Unterschiede in der Fischgemeinschaft umfassten höhere Anteile von großmäu- ligen Arten wie Hecht, Barsch (Perca fluviatilis), Schleie (Tinca tinca) oder Brasse (Abramis brama) in bewirtschafteten Baggerseen im Vergleich zu unbewirtschafteten. Obwohl durch diese Arten theoretisch der Fraßdruck auf Libellenlarven, Kaulquappen oder sogar Wasser- vogelküken ansteigen dürfte (z. B. Hecnar & M’Closkey 1997, Knorp & Dorn 2016), fan- den sich keine signifikanten Unterschiede in Artenzahl, Diversität und Naturschutzwert der genannten Taxa. Die vorliegenden Befunde legen nahe, dass eine durch die anglerische Bewirtschaftung geprägte Fischgemeinschaft nicht zwangsläufig die Etablierung anderer Organismengruppen, über Fraßdruck oder Einflüsse auf die Sedimente (z. B. Aufwühlen durch Karpfen oder Brassen, Breukelaar et al. 1994), einschränkt. Wie zuvor bei der Stör- wirkung auf Wasservögel besteht auch hier die realistische Möglichkeit, dass der Fraßdruck durch die Fische die Abundanz der genannten Taxa negativ beeinflusst, ohne jedoch den Artenreichtum durch das Aussterben einzelner Arten zu verändern. Methodische Limitationen Die methodische Stärke der vorliegenden Studie begründet sich aus der vergleichenden Analyse gesamter Seen und nicht nur ausgewählter Gewässerstrecken, der Betrachtung mehrerer Organismengruppen gleichzeitig und die Existenz eines wesentlichen diskriminie- renden Faktors zwischen den beiden untersuchten Gewässertypen – die Präsenz von Ang- lern und der anglerischen Hege. Allerdings analysiert vorliegende Studie vor allem Artnach- weise und berücksichtigt die relative Abundanz ausgewählter Arten lediglich über den Simpson-Index. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass Auswirkungen des Angelns auf den Bruterfolg oder die Abundanz einzelner störungssensitiver Arten unerkannt blieben, sofern diese sich nicht in Veränderungen des Simpson-Index oder der Artenvielfalt manifes- tieren. Übereinstimmend beobachteten Cryer et al. (1987) an englischen Baggerseen ledig- lich Veränderungen der Verteilung von Wasservögeln in Reaktion auf Angler, jedoch keine Veränderungen der Abundanzen. Ebenso stellten Bell et al. (1997) keine Einflüsse von Frei - zeitaktivitäten auf die Artgemeinschaften der Wasservögel fest, beobachteten jedoch gerin- gere Häufigkeiten vor allem von Tauchenten (Aythya sp.), wenn Angler und andere Erho- lungssuchende präsent waren. Diese subtilen Unterschiede in der relativen Häufigkeit
Sie können auch lesen