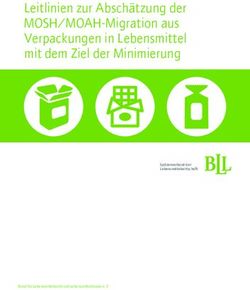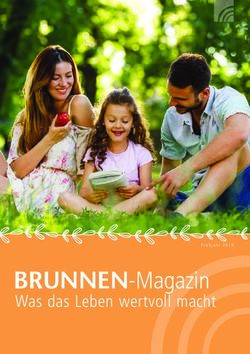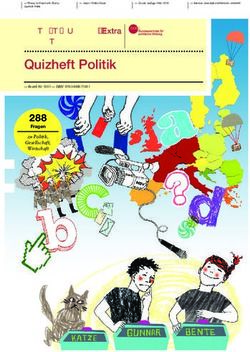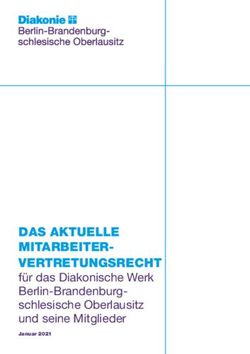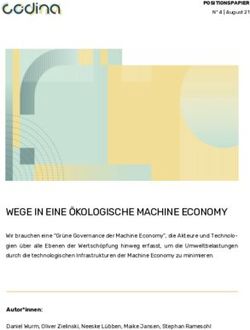ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage © BVL, 1. Februar 2022 Seite 1 von 42
ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
Impressum
©2022 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Herausgeber: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)
Dienststelle Berlin
Mauerstraße 39-42
10117 Berlin
Redaktionsgruppe:
Deutschland: Dr. C. Bendadani (Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-
heit (BVL), Berlin, (frühere) Vorsitzende, derzeit abgeordnet), Dr. N. Bakhiya
(Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), Berlin), T. Böhm (Landesuntersu-
chungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen, Chemnitz),
Dr. B. Dessloch (Landesamt für Verbraucherschutz, Saarbrücken), G. Kesseler
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM), Bonn), U. Kürz-
dörfer (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper, Kre-
feld), Dr. K.P. Latté (Landeslabor Berlin-Brandenburg, Berlin), Dr. V. Lander
(Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Ober-
schleißheim), R. Maslo (Sachverständige i. R. Landesamt für Verbraucherschutz
und Lebensmittelsicherheit, Braunschweig), M. Meier (BVL, Berlin), M. Paul
(BVL, Berlin), Dr. B. Schlagintweit (Sachverständige i. R. Bayerisches Landesamt
für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Oberschleißheim), Dr. N. Schramek
(Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Ober-
schleißheim), K. Steigerwald (Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Rhein-Ruhr-Wupper, Krefeld), C. Struck (Chemisches und Veterinäruntersu-
chungsamt Münsterland-Emscher-Lippe, Münster), Dr. S. Urmersbach (BVL,
Berlin, Vorsitzende)
Schweiz: U. Deiss (Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV),
Bern), F. Franchini (BLV, Bern)
Österreich: K. Riediger (Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit
GmbH (AGES), Wien)
Externe Experten: Prof. Dr. C. Griehl (Leiterin des Kompetenzzentrums Algenbiotechnologie und
Direktorin des Life Science Centers, Hochschule Anhalt), Dr. C. Hahn (Bayeri-
sche Mykologische Gesellschaft, Dießen am Ammersee), Prof. Mag. Dr. I. Kri-
sai-Greilhuber (Department für Botanik und Biodiversität, Universität Wien),
Prof. Mag. Dr. M. Schagerl (Department für Funktionelle und Evolutionäre
Ökologie, Universität Wien), Prof. i. R. Mag. Dr. S. Till (Department für Ernäh-
rungswissenschaften, Universität Wien), Prof. Dr. S. Wölfl (Institut für Pharma-
zie und Molekulare Biotechnologie - Pharmazeutische Biologie, Pharmazeuti-
sche Bioanalytik und Molekulare Zellbiologie, Universität Heidelberg)
ViSdP: H. Händel (BVL, Pressestelle)
Titelbilder: ©Kathleen Rekowski, chelmicky– Fotolia.com; Dartae - stock.adobe.com
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 2 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
1 Präambel
2 Zur 3. Auflage
3 Nachdem im vorletzten Jahr die 2. Auflage des Vorwortes und der Pflanzenliste
4 sowie die 1. Auflage der Pilzliste veröffentlicht wurden, wird mit der neu veröf-
5 fentlichten Algenliste den Verwenderinnen und Verwendern der Stofflisten nun
6 auch eine Einstufungshilfe für Erzeugnisse, die Algen oder bestimmte Zuberei-
7 tungen aus Algen enthalten, an die Hand gegeben.
8
9 Im Zuge der Veröffentlichung der Algenliste wurden entsprechende Aktualisie-
10 rungen im Vorwort notwendig: So findet sich in der nun vorliegenden 3. Auflage
11 des Vorwortes ein Abschnitt mit Verwendungshinweisen zur Algenliste. Neben
12 einigen redaktionellen Korrekturen und Aktualisierungen wurden außerdem die
13 bereits in der 2. Auflage des Vorwortes und der Pflanzenliste enthaltenen Infor-
14 mationen zur Zulassung neuartiger Lebensmittel weiter präzisiert sowie die Refe-
15 renzen für die wissenschaftliche Bezeichnung der Stoffe und ihrer Synonyme er-
16 gänzt.
17
18 Bereits an dieser Stelle weist die AG Stoffliste darauf hin, dass die Veröffentli-
19 chung bzw. Aktualisierung der einzelnen Listen sowohl unabhängig voneinander
20 als auch unabhängig vom Vorwort erfolgen wird!
21
22 Die AG Stoffliste ist den Benutzerinnen und Benutzern der Stofflisten jederzeit
23 für Anmerkungen, Korrekturen, Kritik oder Ergänzungen zu den einzelnen Listen
24 bzw. Einträgen dankbar.
25
26 Präambel der 2. Auflage (Oktober 2020):
27 Die Stofflisten sollen in knapper wissenschaftlich präziser Darstellung einen
28 Überblick über die Stoffe geben, für die eine Verwendung in Lebensmitteln emp-
29 fohlen, nicht empfohlen oder nur mit Beschränkung empfohlen wird. Um eine
30 einheitliche Systematik zu gewährleisten, werden die Einträge in den Listen als
31 „Stoffe“ bezeichnet, auch wenn es sich dabei nicht um definierte Einzelsubstan-
32 zen handelt. Die Einzellisten werden zukünftig nach ihrer Kategorie benannt.
33
34 Inzwischen liegen die Arbeiten für die 1. Auflage der Stoffliste des Bundes und
35 der Bundesländer, die ausschließlich die Kategorie „Pflanzen und Pflanzenteile“
36 umfasst, sechs Jahre zurück. Für die 2. Auflage wurde die Stoffliste Kategorie
37 „Pflanzen und Pflanzenteile“ in Pflanzenliste umbenannt, komplett überarbeitet
38 und aktualisiert: Es wurden über 100 Monographien und über 250 Pflanzen neu
39 aufgenommen und alle bereits vorhandenen Einträge anhand der aktuellen Da-
40 tenlage geprüft und gegebenenfalls aktualisiert, erweitert und in ihren Einstufun-
41 gen angepasst. Mit Hilfe der 2. Auflage der Pflanzenliste kann sich der Leser so-
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 3 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
42 mit nun umfassend zu den einzelnen Stoffen hinsichtlich ihrer Einstufung als Le-
43 bensmittel, Arzneistoff und neuartiges Lebensmittel informieren. Außerdem
44 wurde die „Pilzliste“ neu erstellt. Zukünftig sollen Listen für weitere Stoff-Kate-
45 gorien, wie zum Beispiel Algen, erarbeitet werden. Die Stofflisten werden weiter-
46 hin von einer Redaktionsgruppe aus Behördenvertretern des Bundes und der
47 Bundesländer erarbeitet. Neu hinzugekommen zu der Redaktionsgruppe sind
48 auch Vertreter aus Österreich und der Schweiz sowie externe Fachexperten zur
49 jeweiligen Stoffkategorie, so dass die Stofflisten eine weitgehend einheitliche Be-
50 urteilung von Stoffen im deutschsprachigen Raum ermöglichen können. Dies
51 spiegelt sich auch im neuen Titel der 2. Auflage wider: Stofflisten des Bundes und
52 der Bundesländer unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich
53 und der Schweiz (im Folgenden Stofflisten). Die Stofflisten können als Orientie-
54 rungshilfe bei der Beurteilung von Stoffen als Lebensmittel oder Lebensmittelzu-
55 taten auch in Österreich und der Schweiz dienen. Es ist möglich, dass einzelne
56 Einstufungen in Österreich und der Schweiz von den Stofflisten abweichen. Es
57 sind in jedem Fall die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen von Österreich
58 und der Schweiz zu beachten.
59
60 Die Stofflisten sollen über wichtige Fragen Auskunft geben: Handelt es sich bei
61 dem Stoff um ein (neuartiges) Lebensmittel oder um einen (traditionellen) Arz-
62 neistoff? Die Stofflisten liefern zudem einen Überblick über die kritischen In-
63 haltsstoffe und die damit verbundenen Risiken. Eine umfassende Risikobewer-
64 tung der einzelnen Stoffe ist allerdings nicht das Ziel dieser Listen – hierzu soll-
65 ten weitere Informationsquellen herangezogen werden. Die Listen geben auch
66 keinen Überblick über alle essbaren Stoffe der Welt, alleine deren Auflistung
67 würde Hunderte von Einträgen beanspruchen. Zur größeren Benutzerfreundlich-
68 keit wurden die Stoffe alphabetisch nach ihrem wissenschaftlichen Namen ange-
69 ordnet. Dabei richtet sich die Benennung nach den gängigen Referenzwerken.
70 Darüber hinaus sind für jeden Stoff zudem die wichtigsten Synonyme sowie die
71 Trivialnamen aufgeführt.
72
73 Um eine einheitliche Grundlage zu gewährleisten, wurden zur Bestimmung der
74 therapeutisch wirksamen Dosierung die Monographiesammlungen des HMPC,
75 der ESCOP und der WHO berücksichtigt. Die Monographiesammlungen der
76 Kommission E, die seit 1994 nicht mehr aktualisiert wurden und an Bedeutung
77 verloren haben, wurden nur dann in die Einstufung miteinbezogen sofern keine
78 HMPC-Monographien, die als neuer regulatorischer Standard angesehen werden,
79 vorlagen.
80
81 Grundsätzlich ist bei der Einstufung eines Stoffes als Arzneistoff jedoch zu be-
82 achten, dass ein Stoff auch dann eine pharmakologische Wirkung entfalten kann,
83 wenn seine Dosierung unter derjenigen liegt, die die Monographie für eine thera-
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 4 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
84 peutische Wirksamkeit festlegt. Daher sollten zusätzlich klinische Studien an Pa-
85 tienten bei der Beurteilung der pharmakologischen Wirkung herangezogen wer-
86 den. Auch können sich die toxikologischen und/oder pharmakologischen Effekte
87 eines komplexen Gemisches oder eines Extraktes von denjenigen der Ursprungs-
88 stoffe unterscheiden. Stoffe sind zudem weltweit Gegenstand moderner wissen-
89 schaftlicher Forschung, sodass die Fülle neuer Forschungsergebnisse, nicht nur
90 zu Namensänderungen, sondern auch dazu führen kann, dass die Stofflisten der
91 vorliegenden Auflage um aktuelle Informationen ergänzt bzw. geändert werden
92 müssen. Die Stofflisten werden daher regelmäßig durch die Redaktionsgruppe
93 überarbeitet und fortgeschrieben. Aus diesem Grund ist Ihnen die Redaktions-
94 gruppe für Anmerkungen, Korrekturen, Kritik oder Ergänzungen dankbar.
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 5 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
95 Inhaltsverzeichnis
96 1.1 Warum wurden die Stofflisten erstellt? ...................................................................................................... 7
97 1.2 Rechtlicher Rahmen für die Verwendung von Stoffen als Lebensmittel ............................................ 8
98 1.3 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als Arzneimittel/Arzneistoff ................................................. 9
99 1.4 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als neuartiges Lebensmittel ............................................... 10
100 1.5 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als sicheres Lebensmittel ................................................... 13
101 2 Erläuterungen zu den Stofflisten ............................................................................................................... 13
102 3 Entscheidungsbaum – Erläuterungen zur Einstufung der Stoffe in den Stofflisten ..................... 17
103 3.1 Einordnung in die Listen A, B und C ......................................................................................................... 19
104 3.2 Entscheidungsbaum ..................................................................................................................................... 20
105 4 Relevante Rechtsgrundlagen (in der aktuell gültigen Fassung) ......................................................... 21
106 5 Referenzen ...................................................................................................................................................... 25
107
108
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 6 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
109 1 Stoffe - Entwicklung und Bedeutung auf nationaler und europäischer Ebene
110 1.1 Warum wurden die Stofflisten erstellt?
111 Der Trend zur zunehmenden Verwendung eher unbekannter Stoffe in Lebensmitteln ist EU (Europäische
112 Union) weit steigend. Darüber hinaus rückt bei Verbrauchern und Inverkehrbringern neben dem Nährwert oder
113 Genusszweck von Lebensmitteln ein gesundheitlicher Nutzen in den Fokus. In Supermärkten, Drogerien und im
114 Versand über das Internet werden daher zunehmend Erzeugnisse verkauft, die der Gesunderhaltung dienen
115 sollen. Zum einen handelt es sich hierbei um angereicherte, herkömmliche oder neuartige Lebensmittel (Novel
116 Food, NF), zum anderen um Nahrungsergänzungsmittel (NEM) und Lebensmittel für besondere medizinische
117 Zwecke (ergänzende bilanzierte Diäten, ebD). Letztere können zum Teil Zubereitungen enthalten, welche bis-
118 her in dieser oder in ähnlicher Form in Arzneimitteln eingesetzt wurden.
119 Nahrungsergänzungsmittel dienen dazu, die allgemeine Ernährung zu ergänzen. Lebensmittel für besondere
120 medizinische Zwecke sind Lebensmittel, die zur Ernährung von Patienten unter ärztlicher Aufsicht im Rahmen
121 des Diätmanagements bestimmt sind. Für beide Produktgruppen besteht in Deutschland eine Anzeigepflicht
122 beim Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) nach § 5 der Nahrungsergänzungs-
123 mittelverordnung (NemV) und nach Art. 9 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/128 in Verbindung mit § 4a
124 der Diätverordnung (DiätV).
125 Der Markt dieser beiden Produktgruppen zeigte sich in der Vergangenheit innovationsfreudig. So hat die Zahl
126 der Anzeigen kontinuierlich zugenommen: Beim BVL wurden in den letzten drei Jahren jährlich ca. bis zu 26.000
127 NEM und etwa 200 ebD neu angezeigt.
128 Immer wieder bewegen sich Erzeugnisse aus diesen beiden Produktgruppen hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe und
129 Bewerbung im Grenzbereich zwischen Arznei- und Lebensmitteln. Während Arzneimittel vor dem Inverkehr-
130 bringen ein gesetzlich vorgeschriebenes Zulassungsverfahren durchlaufen, in dem die Qualität, Wirksamkeit
131 und Unbedenklichkeit durch die zuständige Behörde geprüft werden und eine Nutzen-Risiko-Bewertung durch
132 diese erfolgt, ist bei Lebensmitteln, von bestimmten Ausnahmen abgesehen, eine solche Prüfung nicht erfor-
133 derlich. Lebensmittel müssen sicher sein und den Anforderungen des Lebensmittelrechts entsprechen. Hier
134 liegt die Verantwortung primär beim Inverkehrbringer. Einzige Ausnahmen sind neuartige Lebensmittel und
135 Lebensmittelzutaten sowie gentechnisch veränderte Lebensmittel, Lebensmittel-Zusatzstoffe, Aromen und En-
136 zyme die einem Zulassungs- bzw. Genehmigungsverfahren unterliegen.
137 Die Stofflisten des Bundes und der Bundesländer unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich
138 und der Schweiz (im Folgenden Stofflisten) wurden erstellt, um allen am Warenverkehr Beteiligten eine Ent-
139 scheidungshilfe bei der Einstufung von Stoffen hinsichtlich einer Verwendung als Lebensmittel oder Lebens-
140 mittelzutat zur Verfügung zu stellen.
141 Eine abschließende Einstufung von Erzeugnissen, die diese Stoffe oder Zubereitungen daraus enthalten, muss
142 jedoch stets auf den Einzelfall bezogen und unter Berücksichtigung aller beurteilungsrelevanten Kriterien erfol-
143 gen.
144 Die Stofflisten werden für verschiedene Kategorien erstellt. Um eine einheitliche Systematik der Stofflisten zu
145 gewährleisten, werden die Einträge in den Kategorien als „Stoffe“ bezeichnet, auch wenn es sich hierbei übli-
146 cherweise nicht um chemisch definierte Einzelsubstanzen handelt. Eine nähere Definition erfolgt gegebenen-
147 falls begleitend zu den Kategorien. Die Einzellisten werden nach ihrer Kategorie benannt.
148 Die Stofflisten erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit (gesundheitliche Risiken, Synonyme) und entbin-
149 den den Inverkehrbringer nicht von seiner Verantwortung, sicherzustellen, dass das jeweilige Erzeugnis sicher
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 7 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
150 ist und rechtmäßig als Lebensmittel in Verkehr gebracht wird. Die Stofflisten sind grundsätzlich für eine Fort-
151 schreibung offen, um neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie der Entwicklung des Lebensmittelmarktes
152 Rechnung zu tragen.
153 In Österreich hat die Unterkommission Nahrungsergänzungsmittel den Beschluss gefasst, den aktuellen Ent-
154 wicklungen Rechnung zu tragen und die deutschen Stofflisten als Orientierungshilfe für die beteiligten Ver-
155 kehrskreise anzusehen, wobei jedoch die darin vorgenommenen Einstufungen als Arzneimittel für Österreich
156 keine rechtliche Relevanz besitzen. Dies gilt auch für die Zuordnung der Stoffe zu bestimmten Lebensmittelka-
157 tegorien, wie z.B. teeähnliche Erzeugnisse, Gewürze.
158 In der Schweiz wurde das Informationsschreiben 2021/4: Verwendung von «Stoffen» der Kategorien Pflanzen,
159 Pilze, Flechten und Algen sowie daraus hergestellten Zubereitungen als Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten
160 publiziert. Dieses empfiehlt die Stofflisten aus Deutschland als Orientierungshilfe für die Beurteilung von «Stof-
161 fen» als Lebensmittel oder Lebensmittelzutaten. Sie haben jedoch keinen rechtlich verbindlichen Charakter.
162 Auch in der Schweiz ist es möglich, dass einzelne Einstufungen von den Stofflisten abweichen. Maßgeblich sind
163 in jedem Fall die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen der Schweiz. Dies gilt sowohl in Bezug auf die Ein-
164 stufung in bestimmte Kategorien (z. B. Novel Food), die Anforderungen an einzelne Lebensmittelkategorien (z.
165 B. Kräutertees, Nahrungsergänzungsmittel, Speisepilze), die Verbotsliste für Pflanzen, Pflanzenteile und daraus
166 hergestellte Zubereitungen, als auch die Abgrenzung zu den Arzneimitteln.
167 1.2 Rechtlicher Rahmen für die Verwendung von Stoffen als Lebensmittel
168 Im Sinne des Art. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 (Lebensmittel-Basisverordnung, BasisV) sind Lebensmit-
169 tel alle Stoffe oder Erzeugnisse, die dazu bestimmt sind oder von denen nach vernünftigem Ermessen erwartet
170 werden kann, dass sie in verarbeitetem, teilweise verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand von Menschen
171 aufgenommen werden.
172 Diese weite Fassung des Lebensmittelbegriffs erfordert somit den Ausschluss bestimmter Stoffe, die von Ge-
173 setzes wegen keine Lebensmittel sind, wie beispielsweise Betäubungsmittel (Synonym Suchtmittel) und psy-
174 chotrope Stoffe sowie Arzneimittel.
175 Welche Vitamin- und Mineralstoffverbindungen in Lebensmitteln verwendet werden dürfen, ist europaweit
176 einheitlich in den Anhängen der Richtlinie 2002/46/EG, der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 bzw. der Verord-
177 nung (EG) Nr. 1925/2006 (Anreicherungsverordnung) detailliert geregelt. Nicht geregelt sind jedoch die zulässi-
178 gen Höchstmengen. Für Stoffe, die keine Vitamine oder Mineralstoffe sind, besteht bislang keine konkrete Re-
179 gelung wie etwa für verbindliche Spezifikationen, Höchst- oder Mindestmengen.
180 Die rechtlichen Voraussetzungen für die Regelung von anderen Stoffen als Vitamine und Mineralstoffe wurden
181 jedoch bereits mit der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 geschaffen. So eröffnet das in Art. 8 dieser Verordnung
182 geregelte Verfahren die Möglichkeit, solche anderen Stoffe, die bei der Herstellung von Lebensmitteln (ein-
183 schließlich angereicherten Lebensmitteln, NEM und ebD) nicht verwendet werden sollen, wenn sie gesund-
184 heitsschädlich und daher in Lebensmitteln verboten sind, in Anhang III Teil A, oder, wenn sie nur unter be-
185 stimmten Bedingungen verwendet werden dürfen, in Anhang III Teil B aufzunehmen. Stoffe, deren Verwen-
186 dung in Lebensmitteln möglicherweise gesundheitsschädlich ist, bei denen jedoch wissenschaftliche Unsicher-
187 heit besteht, werden in Anhang III Teil C aufgenommen. Für einen Stoff, der in Teil C des Anhang III aufge-
188 nommen wurde, kann innerhalb von 4 Jahren auf Basis neu eingereichter wissenschaftlicher Daten entschieden
189 werden, ob die Verwendung allgemein erlaubt wird oder ob er gegebenenfalls in Anhang III Teil A oder B auf-
190 genommen wird. Bis zur abschließenden Entscheidung sind die nationalen Vorschriften für den Stoff weiter an-
191 wendbar, eine harmonisierte Regelung wird nicht getroffen. Die Aufnahme in den Anhang III erfolgt dabei ent-
192 weder aus eigener Initiative der Kommission oder aufgrund der von einem Mitgliedstaat übermittelten Anga-
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 8 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
193 ben. Von diesem Verfahren wurde bisher nur für wenige Stoffe Gebrauch gemacht. Für alle weiteren Stoffe gel-
194 ten weiterhin die nationalstaatlichen Regelungen. Mehrere Mitgliedstaaten der EU haben im Rahmen ihrer Re-
195 gulierungssysteme bereits eigene nationale Listen mit Stoffen erstellt, die deren Verwendung erlauben, ein-
196 schränken oder verbieten. Sofern für einen Stoff noch keine spezifischen Vorgaben für dessen Verwendung,
197 etwa in Form einer Positivliste, gemacht wurden, hat der Inverkehrbringer im Einzelfall zu prüfen, ob sein Er-
198 zeugnis den allgemeinen lebensmittelrechtlichen Bestimmungen entspricht. Dabei gelten unter anderem fol-
199 gende grundsätzliche Anforderungen:
200 • Arzneimittel, Betäubungsmittel (Synonym Suchtmittel) und psychotrope Stoffe sind nach Art. 2 d) und g)
201 der BasisV keine Lebensmittel.
202 • Lebensmittel, die nicht sicher sind, dürfen nicht in den Verkehr gebracht werden (Art. 14 Abs. 1 der BasisV).
203 • Neuartige Lebensmittel benötigen vor dem Inverkehrbringen eine Zulassung (Art. 10, 14 und 16 der Verord-
204 nung (EU) 2015/2283 – Novel Food-Verordnung).
205 1.3 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als Arzneimittel/Arzneistoff
206 Aufgrund des wechselseitigen Ausschlusses in den Legaldefinitionen kann ein Erzeugnis entweder ein Lebens-
207 mittel oder ein Arzneimittel sein. Dennoch ist es grundsätzlich möglich, dass die Verwendung eines Stoffes so-
208 wohl in Arzneimitteln als auch in Lebensmitteln zulässig ist.
209 Der europäische Arzneimittelbegriff nach Art. 1 Nr. 2 der Richtlinie 2001/83/EG ist zweigeteilt: zum einen wer-
210 den alle Stoffe oder Stoffzubereitungen erfasst, die als Mittel zur Heilung oder zur Verhütung menschlicher
211 Krankheiten bestimmt sind (sog. „Präsentationsarzneimittel“ oder „Arzneimittel nach der Bezeichnung“). Zum
212 anderen umfassen die Arzneimittel alle Stoffe oder Stoffzusammensetzungen, die im oder am menschlichen
213 Körper zur Erstellung einer ärztlichen Diagnose oder zur Wiederherstellung, Besserung oder Beeinflussung der
214 menschlichen physiologischen Funktionen verwendet oder verabreicht werden können (sog. „Funktionsarznei-
215 mittel“).
216 Ein Erzeugnis erfüllt die Anforderungen an ein Arzneimittel, sofern eine der beiden Definitionen für ein Erzeug-
217 nis zutrifft.
218 Diese Definitionen aus der Richtlinie 2001/83/EG wurden in § 2 Abs. 1 in das deutsche Arzneimittelgesetz
219 (AMG) und in § 1 Abs. 1 in das österreichische Arzneimittelgesetz in nationales Recht überführt. Die Schweiz als
220 Nicht-EU-Mitglied verwendet im Heilmittelgesetz (HMG; SR 812.21), das die gesetzlichen Regelungen für Arz-
221 neimittel und Medizinprodukte enthält, in Art. 4 Absatz 1 Bst. a eine geringfügig abweichende Definition für
222 Arzneimittel und führt detaillierte Definitionen für bestimmte Arzneimittelgruppen (Phytoarzneimittel und
223 Komplementärarzneimittel) auf. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sind die maßgeblichen Kriterien
224 für die Einstufung als Arzneimittel vergleichbar. Sie beruhen auf der Bestimmung des Erzeugnisses und dem
225 Nachweis der tatsächlichen pharmakologischen, metabolischen oder immunologischen Wirkung. Üblicherweise
226 wird der Begriff „pharmakologische Wirkung“ als Oberbegriff für die pharmakologische, metabolische und im-
227 munologische Wirkung verwendet.
228 Gemäß der Rechtsprechung müssen belastbare Belege für eine pharmakologische Wirkung vorliegen. Entspre-
229 chende Belege können Monographien der Kommission E bzw. anderer wissenschaftlicher Gremien sein, ebenso
230 aber auch klinische Studien, bestehende Arzneimittelzulassungen und/oder weiteres wissenschaftliches Er-
231 kenntnismaterial. Jedoch ist die pharmakologische Wirkung im Sinne der Einstufung als (Funktions-)Arzneimit-
232 tel strikt von der therapeutischen Wirksamkeit zu trennen, die im Rahmen des Zulassungsverfahrens gegenüber
233 der Arzneimittelzulassungsbehörde nachzuweisen ist.
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 9 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
234 Die therapeutische Wirksamkeit, belegt durch klinische Studien oder Monographien, berechtigt zwar im Wege
235 eines Erst-Recht-Schlusses zur Annahme einer pharmakologischen Wirkung, sie ist aber keine Voraussetzung
236 für das Vorliegen einer pharmakologischen Wirkung im Sinne der Arzneimittelgesetzgebung.
237 Eine besondere Gruppe der Arzneimittel mit pflanzlichen Stoffen stellen die traditionellen pflanzlichen Arznei-
238 mittel dar. Den übergeordneten Rechtsrahmen liefert die Richtlinie 2004/24/EG, die in Deutschland durch §§
239 39a-d des deutschen Arzneimittelgesetzes bzw. in Österreich durch § 12 und § 12a des österreichischen Arznei-
240 mittelgesetzes umgesetzt wird. Für traditionelle pflanzliche Arzneimittel erfolgt ein erleichtertes Verfahren, die
241 sog. Registrierung, da keine klinischen Daten zur Wirksamkeit vorgelegt werden müssen; die pharmakologische
242 Wirkung gilt aufgrund der langjährigen Anwendung und Erfahrung als plausibel. Dabei muss der Antragsteller
243 nachweisen, dass das Arzneimittel mindestens schon 30 Jahre lang Verwendung findet und davon mindestens
244 15 Jahre in der EU, und dass im Zusammenhang mit der Anwendung keine schädlichen Wirkungen aufgetreten
245 sind.
246 In der Schweiz können Phytoarzneimittel vereinfacht zugelassen werden, sofern die jeweiligen Voraussetzun-
247 gen erfüllt sind. Für die vereinfachte Zulassung als traditionell verwendete Phytoarzneimittel ist analog zu
248 Deutschland und Österreich der Nachweis zu erbringen, dass das Phytoarzneimittel oder ein mit diesem ver-
249 gleichbares Arzneimittel (Vergleichspräparat) seit mindestens 30 Jahren medizinisch verwendet wird, davon
250 mindestens 15 Jahre in einem EU- / EFTA- Land. Für weitere Details wird auf die Komplementär- und Phy-
251 toarzneimittelverordnung (KPAV; SR 812.212.24) und die Wegleitung Zulassung Phytoarzneimittel verwiesen.
252 Bei der Erstellung der Stofflisten wurden die Monographien des HMPC (Committee on Herbal Medicinal Pro-
253 ducts), der European Scientific Cooperative on Phytotherapy (ESCOP) und der Weltgesundheitsorganisation
254 (WHO) berücksichtigt. Die Monographiesammlungen zu pflanzlichen Stoffen des ehemaligen Bundesgesund-
255 heitsamtes (Kommission E), die seit 1994 nicht mehr aktualisiert wurden und an Bedeutung verloren haben,
256 wurden nur dann in die Einstufung miteinbezogen, sofern keine HMPC-Monographien vorlagen, die als neuer
257 regulatorische Standard angesehen werden.
258 Zusätzlich wurden zur Einstufung als Arzneistoff bestehende Arzneimittelzulassungen sowie Einstufungen zu-
259 ständiger Behörden herangezogen. Die Verwendung der Arzneimittelzulassungen erfolgt, weil der Nachweis
260 der Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des Stoffes bzw. des Erzeugnisses Voraussetzung für die Zu-
261 lassung als Arzneimittel ist. Nicht berücksichtigt wurden Stoffe, die ausschließlich homöopathisch verwendet
262 werden.
263 Aus den o.g. Quellen wurden nur für die Einstufung der Stoffe relevante Informationen übernommen. Für die
264 vollständigen Informationen wird auf die Original-Publikationen verwiesen.
265 Die Abgrenzung von Lebensmitteln zu Arzneimitteln ist im Einzelfall innerhalb der EU in der Kompetenz der
266 Mitgliedstaaten und somit in der Interpretation nicht unbedingt harmonisiert. Das bedeutet, dass die Einstu-
267 fungen, welche in den Stofflisten für Deutschland gelten, in Österreich oder der Schweiz abweichend sein kön-
268 nen. Zudem müssen immer die EU- und die nationale Rechtsprechung und ggf. behördliche Vorgaben berück-
269 sichtigt werden.
270 1.4 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als neuartiges Lebensmittel
271 Für Lebensmittel sind die Bestimmungen der Verordnung (EU) 2015/2283 (Novel Food-Verordnung) über neu-
272 artige Lebensmittel („Novel Food“, NF) zu beachten. "Neuartig" im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2283 ist ein
273 Lebensmittel oder eine Lebensmittelzutat dann, wenn diese vor dem 15. Mai 1997 in der EU nicht in nennens-
274 wertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet worden ist („history of safe consumption“) und in
275 mindestens eine der in Art. 3 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2015/2283 genannten Kategorien fällt.
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 10 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
276 Für die Stofflisten sind derzeit die folgenden Kategorien relevant:
277 • aus Mikroorganismen, Pilzen oder Algen oder daraus isoliert oder erzeugt
278 • aus Pflanzen oder Pflanzenteilen oder daraus isoliert oder erzeugt, ausgenommen Fälle, in denen das Le-
279 bensmittel eine Verwendungsgeschichte als sicheres Lebensmittel in der Union hat und das Lebensmittel
280 aus einer Pflanze oder Sorte derselben Pflanzenart besteht oder daraus isoliert oder erzeugt wurde, die ih-
281 rerseits gewonnen wurde mithilfe
282 – herkömmlicher Vermehrungsverfahren, die vor dem 15. Mai 1997 in der Union zur Lebensmittelerzeu-
283 gung eingesetzt wurden, oder
284 – nicht herkömmlicher Vermehrungsverfahren, die vor dem 15. Mai 1997 in der Union nicht zur Lebens-
285 mittelerzeugung eingesetzt wurden, sofern diese Verfahren nicht bedeutende Veränderungen der Zu-
286 sammensetzung oder Struktur des Lebensmittels bewirken, die seinen Nährwert, seine Verstoffwechse-
287 lung oder seinen Gehalt an unerwünschten Stoffen beeinflussen
288 • aus Tieren, Pflanzen, Mikroorganismen, Pilzen oder Algen gewonnenen Zell- oder Gewebekulturen oder
289 daraus isoliert oder erzeugt
290 • bei deren Herstellung ein vor dem 15. Mai 1997 in der Union für die Herstellung von Lebensmitteln nicht
291 übliches Verfahren angewandt worden ist, das bedeutende Veränderungen der Zusammensetzung oder
292 Struktur eines Lebensmittels bewirkt, die seinen Nährwert, seine Verstoffwechselung oder seinen Gehalt an
293 unerwünschten Stoffen beeinflussen
294 • die ausschließlich in Nahrungsergänzungsmitteln als nicht neuartig gelten und nun in anderen Lebensmit-
295 teln verwendet werden sollen
296 In der EU darf ein NF aus Gründen des vorsorgenden Verbraucherschutzes nur nach vorheriger Genehmigung
297 in Verkehr gebracht werden, da die Sicherheit des Lebensmittels nicht durch eine Verbrauchsgeschichte in der
298 EU bekannt ist. Im Rahmen dieser Genehmigung wird das Lebensmittel einer gesundheitlichen Bewertung
299 durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (European Food Safety Authority, EFSA) unterzogen.
300 Zuständig für die Genehmigung ist die Europäische Kommission, die hierzu die Mitgliedstaaten konsultiert.
301 Es sei hierzu allerdings ausdrücklich erwähnt, dass die Einstufung eines Stoffes grundsätzlich nicht auf die aus
302 diesem Stoff gewonnenen Extrakte anwendbar ist. Es ist jeweils im Einzelfall vom Inverkehrbringer zu prüfen,
303 ob der verwendete Extrakt als neuartiges Lebensmittel in den Regelungsbereich der Novel Food-Verordnung
304 fällt. Es ist im Allgemeinen immer zu prüfen, ob die angewandte Extraktionsmethode eine gezielte Anreiche-
305 rung (oder Abreicherung) von bestimmten Stoffen zur Folge hat. Sofern der spezifische Extrakt in der jeweiligen
306 Zusammensetzung vor dem 15. Mai 1997 in der Europäischen Gemeinschaft nicht in nennenswertem Umfang
307 als Lebensmittel verzehrt wurde, wäre dieser als neuartiges Lebensmittel im Sinne der Novel Food-Verordnung
308 anzusehen.
309 Ebenso ist im Einzelfall die Neuartigkeit eines Stoffes zu prüfen, sofern ausschließlich eine Verwendung als Ge-
310 würz, Tee oder teeähnliches Erzeugnis bekannt ist.
311 Aromen und Lebensmittelzusatzstoffe zur Verwendung in Lebensmitteln fallen nicht unter den Regelungsbe-
312 reich der Novel Food-Verordnung. Werden entsprechende Stoffe jedoch als Zutaten mit ernährungsphysiologi-
313 schen Eigenschaften und somit zu anderen Zwecken als zur Aromatisierung oder technologischen Funktion
314 eingesetzt, ist es möglich, dass sie als neuartig im Sinne der Novel Food-Verordnung einzustufen sind.
315 Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 ausschließlich als oder in NEM verwendet wurden, müssen für andere
316 Verwendungen als Lebensmittel entsprechend der Novel Food-Verordnung zugelassen werden.
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 11 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
317 Bei der Erstellung der Stofflisten wurde hinsichtlich der Einstufung als neuartiges Lebensmittel unter anderem
318 der öffentlich zugängliche Novel Food-Katalog der Europäischen Kommission herangezogen. Dieser stellt die
319 zwischen den Mitgliedstaaten abgestimmten Informationen über den NF-Status zu einzelnen Stoffen dar, je-
320 doch ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
321 • der Stoff wurde nicht vor dem 15. Mai 1997 als Lebensmittel oder -zutat verwendet und ist demzufolge als
322 neuartiges Lebensmittel zu betrachten (Kürzel im Novel Food-Katalog) – Status in den Stofflisten ge-
323 kennzeichnet durch NF
324 • der Stoff wurde vor dem 15. Mai 1997 als Lebensmittel oder -zutat verwendet und ist demzufolge nicht als
325 neuartiges Lebensmittel zu betrachten (Kürzel im Novel Food-Katalog) – bezüglich Novel Food (NF) ist
326 in den Stofflisten somit keine Kennzeichnung erforderlich
327 • der Stoff wurde vor dem 15. Mai 1997 ausschließlich als oder in NEM verwendet und ist für andere Anwen-
328 dungen als neuartiges Lebensmittel zu betrachten (Kürzel im Novel Food-Katalog) – Status in den Stoff-
329 listen gekennzeichnet durch Not NFS (not novel in food supplements)
330 Zusätzlich wurde bei der Aktualisierung der Stofflisten zur Ermittlung des Kriteriums NF die „Unionsliste“
331 (Durchführungs-VO (EU) 2017/2470) bei der Bestimmung des NF-Status berücksichtigt. In der konsolidierten
332 Fassung1 dieser Positivliste werden sämtliche bereits zugelassene neuartige Lebensmittel bzw. zugelassene tra-
333 ditionelle Lebensmittel aus einem Drittland nach Art. 10, 14 oder 16 der Novel Food-Verordnung aufgeführt.
334 Die Unionsliste enthält auch die Verwendungsbedingungen und die einzuhaltenden Spezifikationen für die je-
335 weiligen Lebensmittel. Die Unionsliste wird demnach laufend durch neue Zulassungen ergänzt. Diese Zulassun-
336 gen werden im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht und enthalten ausführliche Informationen zu
337 z.B. den Gründen für die Zulassung oder auch für die Aufnahme von Verzehrs- oder Warnhinweisen. Die Uni-
338 onsliste und alle Verordnungen zur Ergänzung oder Änderung der Unionsliste sind auf der Website der Europä-
339 ischen Kommission unter folgendem Link zu finden:
340 https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/union-list-novel-foods_en
341 Soweit sonstige Informationen zum NF-Status aus nationalen Lebensmittellexika, Fachbüchern, Nachschlage-
342 werken, Pflanzenlisten anderer Mitgliedstaaten oder aus Abfragen des BVL bei den Ländern bzw. unter den
343 Mitgliedstaaten vorlagen, wurden diese ebenfalls bei den Stofflisten beachtet.
344 Die Schweiz als Nicht-EU-Mitglied hat die rechtlichen Bestimmungen für neuartige Lebensmittel in Art. 15 der
345 Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (LGV, SR 817.02) definiert. „Neuartig“ im Sinne dieser
346 Definition sind Lebensmittel, die vor dem 15. Mai 1997 weder in der Schweiz noch in einem Mitgliedsstaat der
347 EU in nennenswertem Umfang für den menschlichen Verzehr verwendet wurden und die unter eine der in Art.
348 15 Abs. 1 LGV aufgeführten Kategorien fallen. Es ist somit grundsätzlich möglich, dass Stoffe, welche in der EU
349 als neuartig gelten, in der Schweiz keine neuartigen Lebensmittel sind. In der Schweiz sind die in der EU zuge-
350 lassenen neuartigen Lebensmittel ebenfalls verkehrsfähig. Zusätzlich hat die Schweiz aber ein eigenes Bewilli-
351 gungsverfahren für Novel Food. Das kann dazu führen, dass für die Schweiz, abweichend von der EU, Lebens-
352 mittel, die als neuartig einzustufen sind, bereits als Novel Food bewilligt und zulässig sind.
1 Um die letzte ergänzte Fassung der Unionsliste zu erhalten, klicken Sie auf der Website https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/?uri=CELEX:32017R2470 unter der Überschrift „Titel und Fundstelle“ (engl. “Title and reference“) auf das angezeigte Datum
hinter dem Hinweis: „In Kraft: Dieser Rechtsakt wurde geändert. Aktuelle konsolidierte Fassung:“ (engl. “In force: This act has been
changed. Current consolidated version:”)
ACHTUNG: Es können noch neuere Zulassungen vorliegen, die noch nicht in der letzten konsolidierten Fassung berücksichtigt wurden.
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 12 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
353 1.5 Rechtlicher Rahmen für die Einstufung als sicheres Lebensmittel
354 Grundsätzlich dürfen Stoffe, die nach Art. 14 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und in der Schweiz nach
355 Art. 7 Abs. 2 des Lebensmittelgesetzes (LMG, SR 817.0), „nicht sicher“ sind, d.h. gesundheitsschädlich oder für
356 den Verzehr durch den Menschen ungeeignet sind, nicht in den Verkehr gebracht werden.
357 Bei der Erstellung der Stofflisten wurde daher geprüft, ob die Stoffe grundsätzlich als Lebensmittelzutat geeig-
358 net sind und eine Einstufung als übliches Lebensmittel (LM) möglich ist, für dessen Verwendung keine Verwen-
359 dungsbeschränkungen angezeigt sind. Die Stofflisten enthalten hierzu Hinweise zu Risiken der jeweiligen
360 Stoffe. Dabei wurden die Daten zu bekannten gesundheitsschädlichen Wirkungen und Psychoaktivität von
361 Stoffen größtenteils aus aktueller Standardliteratur übernommen.
362 2 Erläuterungen zu den Stofflisten
363 Um möglichst kurzfristig Änderungen, Ergänzungen oder Aktualisierungen an den verschiedenen Listen sowie
364 dem Vorwort vorzunehmen, können die einzelnen Listen sowohl unabhängig voneinander als auch unabhängig
365 vom Vorwort veröffentlicht werden. Sowohl die jeweils aktuellen von der AG Stoffliste veröffentlichten Doku-
366 mente als auch Versionen dieser Dokumente, die in der Vergangenheit veröffentlicht und die zwischenzeitlich
367 überarbeitet wurden, können auf der Webpage der AG Stofflisten abgerufen werden:
368 https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/01_Lebensmittel/01_Aufgaben/07_Stofflisten/veroeffentli-
369 chungen/veroefentlichungen_basepage.html?nn=11035366
370 Künftig ist das Datum der Veröffentlichung dort und auch in den einzelnen Dokumenten selbst angegeben.
371 Die Stoffe in den Stofflisten werden als solche betrachtet und kategorisiert. Zubereitungen aus Stoffen, wie z. B.
372 Extrakte oder Isolate, können sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung, insbesondere bezogen auf die ernäh-
373 rungsphysiologischen und toxikologischen Eigenschaften, von den Stoffen selbst unterscheiden. Es ist daher im
374 Einzelfall zu prüfen, ob die Einstufung eines Stoffes auf eine Zubereitung daraus übertragen werden kann. Die
375 Einstufungen erfolgten anhand eines entwickelten Entscheidungsbaumes (siehe Kapitel 3).
376 Für die wissenschaftlichen Namen (Stammpflanze, und Synonyme, lateinisch) und ggf. für die Trivialnamen
377 (deutsch) wurden, sofern nicht anders in den Listen selbst angegeben, die folgenden Referenzen herangezogen
378 (s. u. Referenzen):
379 • Pflanzenliste: Plants of the world online (POWO) und Jäger (2005, 2011)
380 • Pilzliste: MycoBank sowie Pilze-Deutschland, Pilzdaten-Austria und Swissfungi
381 • Algenliste: Algaebase
382
383 Zum Verständnis der Stofflisten sind darüber hinaus folgende Hinweise zu beachten:
384 1. In den Stofflisten erfolgte die Einstufung der gelisteten Stoffe in Anlehnung an die Verordnung (EG) Nr.
385 1925/2006. Die Teillisten, bei denen es sich um Empfehlungen zur Verwendung handelt, haben demnach
386 folgende Bedeutung:
387 Liste A: Stoffe, für die eine Verwendung in Lebensmitteln nicht empfohlen wird
388 Liste B: Stoffe, für die eine Beschränkung bei der Verwendung in Lebensmitteln empfohlen wird
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 13 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
389 Liste C: Stoffe, deren Verwendung möglicherweise gesundheitsschädlich ist, wo jedoch weiterhin eine wis-
390 senschaftliche Unsicherheit besteht, oder Stoffe, die ausschließlich als nicht neuartig in NEM (Not
391 NFS) eingestuft wurden und ansonsten als Lebensmittel neuartig sind
392
393 2. Werden Stoffe als Lebensmittel üblicherweise in geringen Mengen oder nur sehr eingeschränkt verwendet,
394 beispielsweise als Gewürz oder als Zutat bei der Herstellung von Spirituosen, wird darauf durch folgende
395 Kürzel in der Zeile „Lebensmittel (LM)“ hingewiesen:
396 A: Verwendung ausschließlich als Lebensmittelzutat mit Aromaeigenschaften oder Ausgangsstoff für Aro-
397 men bekannt
398 G: Verwendung als Gewürz bekannt2
399 S: Verwendung als Schmuckdroge3 bekannt
400 T: Verwendung in oder als Tee oder teeähnliches Erzeugnis bekannt
401 NEM: Verwendung in oder als Nahrungsergänzungsmittel grundsätzlich bekannt (gemäß notifizierter Posi-
402 tivliste eines Europäischen Mitgliedstaates, es sei denn, der Stoff wurde in Liste A der Stoffliste ein-
403 gestuft)
404 Derartige Einschränkungen werden in der Regel nicht durch Aufnahme in Liste B dokumentiert. Eine zusätz-
405 liche Aufnahme in Liste B erfolgt im Ausnahmefall, wenn für den Stoff Wirkungen beschrieben sind, auf-
406 grund derer er nur beschränkt verwendet werden sollte.
407 Bei der Einstufung wird davon ausgegangen, dass der jeweilige Stoff, wie in der Liste dokumentiert, verwen-
408 det wird. Eine andere Verwendung, z. B. in höheren Mengen, kann zu Wirkungen führen, die gegebenenfalls
409 eine andere Einstufung erforderlich machen.
410
411 3. Stoffe, die vor Verzehr behandelt werden sollten (z. B. Erhitzen), sind durch den Zusatz „b“ in der Zeile „Le-
412 bensmittel (LM)“ kenntlich gemacht.
413
414 4. Bei der Einordnung eines Stoffes als neuartiges Lebensmittel/neuartige Lebensmittelzutat (NF) im Sinne der
415 Novel-Food-Verordnung ist in der Zeile „Anmerkungen“ aufgeführt, ob es sich dabei um ein zugelassenes
416 neuartiges Lebensmittel handelt.
417
418 5. Werden Beschränkungen eines Stoffes bei seiner Verwendung als Lebensmittel oder Lebensmittelzutat
419 (Liste B) aufgrund einer pharmakologischen Wirkung, die durch eine der o.g. Monographien, durch eine be-
420 stehende Arzneimittelzulassung etc. belegt ist (vergl. 1.3), vorgeschlagen (Ziffer 4 in den Erläuterungen zum
421 Entscheidungsbaum), bezieht sich die Beschränkung immer auf den im Beleg genannten Stoff (z. B. getrock-
422 nete Pflanze oder getrockneter Pflanzenteil).
423
2 Gewürze können auch zur Aromatisierung von Tee verwendet werden
3 „Schmuckdrogen“ sind Drogen mit geringen oder keinen Wirkstoffen, die als Bestandteil einer Teemischung diese bunt erscheinen lassen.
Drogen sind pflanzliche Rohstoffe
[Hermann P. T. Ammon, Manfred Schubert-Zsilavecz [Hrsg.]: Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch. 11., aktualisierte Aufl., de Gruyter,
Berlin, Boston 2014
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 14 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
424 6. Stoffe, für die gemäß §§ 39a ff. des Arzneimittelgesetzes eine pharmakologische Wirkung
425 oder die Wirksamkeit als Arzneimittel aufgrund langjähriger Anwendung und Erfahrung plausibel ist („Tra-
426 ditionsbeleg“), werden nicht allein aufgrund dieses Traditionsbelegs in Liste B aufgenommen. Für die Auf-
427 nahme in Liste B müssen pharmakologische Wirkungen wie in Punkt 5 aufgeführt oder Risiken beschrieben
428 sein, aufgrund derer nur eine beschränkte Verwendung in Lebensmitteln empfohlen wird.
429
430 7. Bei der Einordnung der Stoffe im Rahmen dieser Liste wird nur ihre Wirkung nach oraler Aufnahme berück-
431 sichtigt. Stoffe, die gemäß den Monographien ausschließlich zur äußerlichen Anwendung bestimmt sind,
432 werden in den Stofflisten nicht als Arzneistoff gekennzeichnet.
433
434 8. Für die „Pilzliste“ gelten folgende Besonderheiten:
435 • Die Einträge in der Liste beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, ausschließlich auf den Pilzfrucht-
436 körper.
437 • Der Rohverzehr von Pilzen ist aufgrund ihrer schweren Verdaulichkeit – mit Ausnahme geringer Mengen
438 von Trüffeln – nicht zu empfehlen.
439 • Die Prüfung selbst gesammelter Wildpilze vor Verzehr auf Essbarkeit durch Pilzsachverständige wird
440 empfohlen.
441 • Auf die besonderen Schutzbestimmungen für Pilze im Bundesnaturschutzgesetz und in der Bundesar-
442 tenschutzverordnung in den jeweils geltenden Fassungen wird hingewiesen. Bei Pilzen, die in den Roten
443 Listen der drei Staaten stehen, wird auf den jeweiligen Gefährdungsgrad in den Anmerkungen hingewie-
444 sen.
445 • Die mit einem Sternchen * kenntlich gemachten Speisepilze sollten nur unter den in der Zeile "Anmer-
446 kungen" genannten Einschränkungen in den Verkehr gebracht werden.
447
448 9. Für die „Algenliste“ gelten folgende Besonderheiten:
449 • Die Einträge in der Liste umfassen Makro- und Mikroalgen. Der Begriff „Algen“ ist ein rein funktioneller
450 Begriff, der unterschiedlich definiert wird. Aus praktischen Gründen enthält die Algenliste eukaryotische
451 Stämme u.a. Chlorophyta und Charophyta4, Chromista/Stramenopiles (Phaeophyceae, Bacillariophyceae,
452 Labyrinthulomycetes, Oomycetes), Euglenophyta und Rhodophyta sowie Cyanobakteria (früher Blaual-
453 gen).
454 • Einige Cyanobakterien- (wie Microcystis sp., Aphazinomenon sp., Anabena sp., Nodularia sp.) und
455 Dinoflagellatenarten (wie Gonyaulax sp., Gymnodinium sp.) können unter bestimmten Umweltbedingun-
456 gen (z.B. Massenentwicklung in Algenblüten) Biotoxine wie z.B. Microcystine, Nodularine, Anatoxine o-
457 der Saxitoxine bilden.
458 Diese können bei Aufnahme zu teils schwerwiegenden Intoxikationen führen. Durch eine gute Herstel-
459 lungspraxis und verantwortungsvolle Eigenkontrollen können Verunreinigungen in der Algenbiomasse
460 vermieden werden. Die chemische Analytik von Algentoxinen ist derzeit noch eine Herausforderung für
4 Eine gängige moderne Einteilung umfasst Algenstämme in den Subdomänen Archaeplastida, Alveolata, Stramenopiles, Excavata und
„incertae sedis“, also derzeit nicht eindeutig zuordenbaren Stämmen (Crypto- und Haprophyta) Boenigk (2021).
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 15 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
461 die Eigenkontrolle und die amtliche Lebensmittelüberwachung.
462 So sind Höchstgehalte für bestimmte Algentoxine z.B. in Muscheln und in Trinkwasser festgelegt.
463 • Bei einer Verwendung von bestimmten Braunalgen (Fucus vesiculosus, Fucus serratus und Ascophyllum
464 nodosum) in Arzneimitteln müssen die Vorgaben des Europäischen Arzneibuchs eingehalten werden.
465 • Einige natürlich vorkommende Makroalgen können größere Mengen an Arsen, Cadmium, Blei, Quecksil-
466 ber sowie Jod aus der Umwelt in der Biomasse anreichern.
467 – Empfehlung (EU) 2018/464 der Kommission vom 19. März 2018 zur Überwachung der Metall- und
468 Jodkonzentrationen in Seetang (engl. seaweed), Halophyten und auf Seetang basierenden Erzeugnis-
469 sen:
470 Der Begriff „seaweed“, in der deutschen Fassung übersetzt mit „Seetang“, umfasst nach Ziffer 1 die-
471 ser Empfehlung eine große Bandbreite von Seetangarten 5.
472 Zu den in dieser Empfehlung der Kommission genannten Metallen Arsen, Cadmium, Blei und Queck-
473 silber sowie Jod sollen seitens der europäischen Mitgliedstaaten zur Abschätzung der Exposition Da-
474 ten erfasst werden.
475 – Die Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 macht für Algen derzeit lediglich allgemeine Vorgaben für
476 Höchstwerte von Blei, Cadmium und Quecksilber in Nahrungsergänzungsmittel, sowie spezielle Vor-
477 gaben für Cadmium in Nahrungsergänzungsmitteln, die ausschließlich oder vorwiegend aus getrock-
478 netem Seetang5 oder aus Produkten, die aus Seetang gewonnen wurden, bestehen. Für Quecksilber
479 ist außerdem derzeit in der Verordnung (EG) Nr. 396/2005 ein Rückstandshöchstgehalt für Algen und
480 prokaryontische Organismen festgelegt.
481 – In der Schweiz sind die Höchstgehalte für Kontaminanten gemäß der Verordnung des EDI über die
482 Höchstgehalte für Kontaminanten (VHK; SR 817.022.15) und die mikrobiologischen Kriterien gemäß
483 der Verordnung des EDI über die Hygiene beim Umgang mit Lebensmitteln (HyV; SR 817.024.1) zu
484 beachten.
485 • Bezüglich des Jodgehaltes in getrockneten Meeresalgen gibt es keine rechtlich verbindlichen Vorgaben
486 auf europäischer Ebene. In einigen europäischen Mitgliedstaaten existieren jedoch nationale Empfehlun-
487 gen für Höchstmengen wie z.B. die des deutschen Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) oder der
488 französischen Behörde ANSES. Diese Empfehlungen orientieren sich i.d.R. an der von der EFSA abgelei-
489 teten tolerierbaren Tageshöchstmenge (engl. Tolerable Upper Intake Level, UL).
490 • Hersteller und Inverkehrbringer von Algenprodukten, die nicht als Nahrungsergänzungsmittel angebo-
491 ten werden, sollten konkrete Angaben zur mengenmäßigen Verwendung der Algen, deren Vor- und Zu-
492 bereitung sowie zum Jodgehalt und der maximalen täglich empfohlenen Verzehrsmenge machen. Letz-
493 tere sollte sich an der empfohlenen täglichen Jodzufuhr orientieren
494 (https://www.bfr.bund.de/cm/343/gesundheitliche_risiken_durch_zu_hohen_jodgehalt_in_getrockne-
495 ten_algen.pdf).
5 Arame (Ecklonia bicyclis, in Stoffliste unter Eisenia bicyclis), Blasentang (Fucus vesiculosus), Speise-Rotalge (Palmaria palmata), Hiziki (Hi-
zikia fusiforme, in Stoffliste unter Sargassum fusiforme), Irischmoos (Chondrus crispus), Fingertang (Laminaria digitata), Kombu (Laminaria
japonica, Saccharina japonica), Nori oder Purpurtang (Porphyra und Pyropia spp.), Knotentang (Ascophyllum nodosum), Meerlattich (Ulva
sp.), Riementang (Himanthalia elongata), Sägetang (Fucus serratus), Codium (Codium sp., derzeit kein Eintrag in der Stoffliste) Zuckertang
(Saccharina latissima), Wakame (Undaria pinnatifida) und Flügeltang (Alaria esculenta)
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 16 von 42ENTWURF: Vorwort zu den Stofflisten des Bundes und der Bundesländer
Unter Mitwirkung von Experten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3. Auflage
496 3 Entscheidungsbaum – Erläuterungen zur Einstufung der Stoffe in den Stofflisten
497 Der Entscheidungsbaum dient als Grundlage zur Einordnung von Stoffen als „Lebensmittel (LM)“, „Arzneistoff
498 (AS)“ und/oder „Neuartiges Lebensmittel/neuartige Lebensmittelzutat (NF)“ sowie mögliche Kombinationen
499 daraus (ambivalenter Charakter der Stoffe). Er gibt gleichzeitig Hinweise zur Einordnung der Stoffe in die Listen
500 A, B und C.
501 Die Einstufung als Arzneistoff erfolgt – abgesehen von den ambivalenten Stoffen (siehe unten Ziff. 3) – im
502 Sinne der Definition von Funktionsarzneimitteln in § 2 Abs. 1 Nr. 2a des AMG. Diese sind durch ihre pharmako-
503 logische, metabolische oder immunologische Wirkung charakterisiert. Im Entscheidungsbaum wird der Über-
504 sichtlichkeit halber für diese Definition der Begriff „pharmakologische Wirkung“ verwendet. Eine Einstufung als
505 Präsentationsarzneimittel im Sinne der Definition des § 2 Abs. 1 Nr. 1 des AMG bleibt unberücksichtigt.
506 Im Ergebnis der Abfragen nach diesem Entscheidungsbaum kommt es zu folgender Einstufung:
507
508 Ziffer 1: Lebensmittel
509 (Entscheidungsbaum I – über Frage 3)
510 Übliche Lebensmittel ohne bekannte Nutzung als Arzneistoff.
511 Aufgrund ihrer bisherigen Verwendung sind keine Anwendungsbeschränkungen angezeigt.
512
513 Ziffer 2: Lebensmittel + Liste B
514 (Entscheidungsbaum III – über Frage 3)
515 Übliche Lebensmittel ohne bekannte Nutzung als Arzneistoff.
516 Mengen- oder Anwendungsbeschränkungen sind aufgrund von Risiken durch in dem „Stoff“ enthaltene In-
517 haltsstoffe angezeigt.
518 Derartige Einschränkungen werden durch Aufnahme in Liste B deutlich gemacht.
519
520 Ziffer 3: Lebensmittel + traditioneller Arzneistoff
521 (Entscheidungsbaum II – über Frage 5)
522 Für traditionelle pflanzliche Arzneistoffe ist eine pharmakologische Wirkung gemäß §§ 39a ff. des AMG durch
523 langjährige Verwendung und Erfahrung plausibel. Derzeit werden für Pflanzen/ Pflanzenteile, die Bestandteil
524 traditioneller Arzneimittel sein können, bei der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) Aufbereitungsmono-
525 graphien neu erstellt oder überarbeitet. Soweit diese Monographien verabschiedet und veröffentlicht wurden,
526 sind sie entsprechend berücksichtigt. Teilweise werden die dort verwendeten Pflanzen/Pflanzenteile seit lan-
527 gem auch als Lebensmittel verwendet. Auf die Empfehlung einer Beschränkung (Liste B) wurde im Einzelfall
528 verzichtet, soweit diese ausschließlich aufgrund des traditionellen Wirkungsbelegs erfolgt wäre. Nur in diesem
529 Fall erfolgt daher trotz derart belegter pharmakologischer Wirkung eine Einstufung als ambivalenter Stoff
530 (LM/AS) ohne Beschränkung.
531
© BVL, 1. Februar 2022 Seite 17 von 42Sie können auch lesen