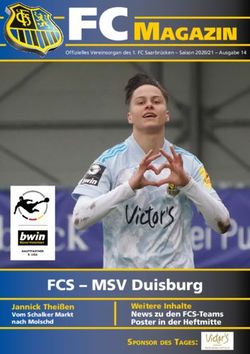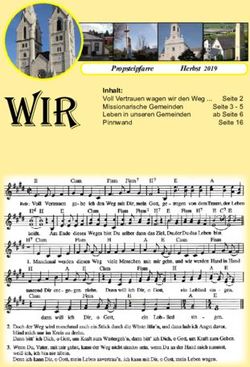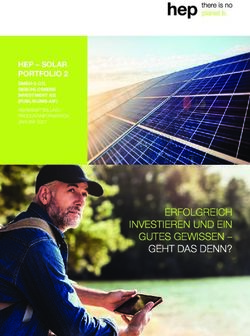Erinnerungsort Olympia-Attentat
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Erinnerungsort Olympia-Attentat
Konzept im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums
für Unterricht und Kultus
München, im August 2013
Konzeptautoren
Bernhard Purin
Jüdisches Museum München
St.-Jakobs-Platz 16
80469 München
Dr. Jörg Skriebeleit
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg
Gedächtnisallee 5
92696 Flossenbürg
Werner Karg
Bayerische Landeszentrale
für politische Bildungsarbeit
Praterinsel 2
80538 MünchenInhalt
1. Einleitung 3
2. Bestandsaufnahme 5
3. Inhaltliches Konzept 10
3.1 Das Attentat 11
3.2 Die Opfer 12
3.3 Kontextualisierung 15
3.3.1 Die politische Dimension Olympias 15
3.3.2 Die deutsch-israelischen Beziehungen 16
3.3.3 Transnationaler Terrorismus 17
3.3.4 Nachwirkungen 18
4. Standort 20
5. Perspektive Fürstenfeldbruck 23
6. Literatur (Auswahl) 251. Einleitung
Im September 2012 kündigte der Bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer
während eines Staatsbesuchs in Israel an, gemeinsam mit der Landeshauptstadt
München und weiteren Partnern einen „Gedenk- und Erinnerungsort Olympia-Attentat“
in München zu initiieren. Im Oktober 2012 lud Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle zu
einer Besprechung zu diesem Vorhaben ein, an der neben Kulturreferent Dr. Hans-
Georg Küppers (in Vertretung von Oberbürgermeister Christian Ude) Vertreter des
Bundesministeriums des Innern, des Deutschen Olympischen Sportbundes, des
Staatsministeriums für Inneres und der Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern sowie der Generalkonsul des Staates Israel teilnahmen. Bei diesem
Treffen bestand Konsens darüber, dass der geplante „Gedenk- und Erinnerungsort
nicht ein reines Mahnmal sein, sondern die Erinnerung an das Attentat und seine Opfer
durch Information wach halten solle.
In unmittelbarer Folge dieser Absichtserklärungen hat die innerhalb des
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus hier zuständige Landeszentrale für
politische Bildungsarbeit eine Konzeptgruppe berufen. Ihr gehören als Vertreter des
Freistaates Werner Karg (Landeszentrale) und Dr. Jörg Skriebeleit (KZ-Gedenkstätte
Flossenbürg) sowie seitens der Landeshauptstadt München Bernhard Purin (Jüdisches
Museum) an. Die Konzeptgruppe hatte den Auftrag auf Basis der oben genannten
Prämisse bis Anfang September 2013 ein inhaltliches Konzept zu erarbeiten sowie
Standortvorschläge vorzulegen.Das israelische Generalkonsulat, namentlich der
mittlerweile verabschiedete Generalkonsul Tibor Shalev Schlosser, sowie Angehörige
der elf israelischen Opfer waren in den Konzeptionsprozess von Beginn an
eingebunden.
Ein Zwischenergebnis der Überlegungen der Konzeptgruppe wurde am 5. Juni 2013
einer interministeriellen Arbeitsgruppe des Freistaates Bayern präsentiert, um vor allem
den inhaltlichen Charakter des künftigen Erinnerungsortes Olympia-Attentat sowie
dessen mögliche Situierung abzustimmen. Diese Arbeitsgruppe – bestehend aus
Vertretern der Staatskanzlei, der Staatsministerien der Finanzen und des Innern (hier
auch der Obersten Baubehörde), sowie des federführenden Kultusministeriums –
wurde von Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle eingesetzt, um die Entwicklung des
Konzepts von Beginn an mit der Verwaltung zu koordinieren.
Der Erinnerungsort, dessen Ausstellungsfläche 100 bis 200 qm umfassen wird, soll
–3–kein Museum im herkömmlichen Sinn werden, sondern ist als frei zugänglicher
pavillonartiger Ausstellungsort im Olympiapark gedacht. Im Mittelpunkt werden das
Ereignis des Attentats selbst sowie vor allem die Biografien der Opfer stehen.
Kontextualisierungsebenen sollen Informationen über die Olympischen Spiele und die
mit ihnen verbundenen Hoffnungen und Erwartungen, über die Vorgeschichte und die
weitere Entwicklung des internationalen Terrorismus sowie über die Nachwirkungen
des Anschlags geben.
Als möglicher Standort wird eine im Besitz des Freistaates befindliche Fläche südlich
der Connollystraße vorgeschlagen. Die Orte der Geiselnahme im Olympischen Dorf
wurden von Seiten der Konzeptgruppe frühzeitig ausgeschlossen, weil dies nicht nur
zu unzumutbaren Belastungen der Anlieger in dieser reinen Wohngegend, sondern zu
gravierenden rechtlichen Schwierigkeiten führen würde. Ebenso als ungeeignet erwies
sich der ehemalige S-Bahnhof Oberwiesenfeld, da dieser zu abgelegen ist und mit den
Ereignissen vom 5. September 1972 nicht in Verbindung steht.
In der Folge der Präsentation dieser inhaltlichen und topographischen Leitlinien fanden
auf Freistaats-Ebene intensive Abstimmungsprozesse zwischen den Ministerien sowie
mit den politischen Partnern statt. In diesen Prozess wurde auch der Landrat des
Landkreises Fürstenfeldbruck, Thomas Karmasin, und der Oberbürgermeister der Stadt
Fürstenfeldbruck, Sepp Kellerer, einbezogen, da die Gesamtdarstellung des
historischen Geschehens selbstverständlich auch den Fliegerhorst Fürstenfeldbruck
einzubeziehen hat. Als Ergebnis dieser Abstimmungen wurde noch vor der
Sommerpause – am 30. Juli 2013 – ein Beschluss der Staatsregierung zur
Realisierung des Grobkonzepts gefasst. Der Freistaat geht dabei davon aus, die
Landeshauptstadt – wie im Übrigen auch den Bund – als Kooperationspartner mit
substanziellen Beiträgen zu gewinnen. Inwieweit und in welchem Umfang sich die
Landeshauptstadt und der Bund bei diesem wichtigen Projekt engagieren, wird
Gegenstand von Gesprächen im Herbst 2013 sein. Etwaige Entscheidungen bezüglich
einer Kooperation werden – bezogen auf die Landeshauptstadt – gegebenenfalls durch
den Stadtrat zu treffen sein.
Auftragsgemäß wurde das Konzept Anfang September 2013 dem Bayerischen
Staatsministerium für Unterricht und Kultus übergeben.
Bernhard Purin
Dr. Jörg Skriebeleit
Werner Karg München, im August 2013
–4–2. Bestandsaufnahme
Zwei Denkmäler im Olympiapark München erinnern an die Opfer des Olympia-Attentats
der XX. Olympischen Sommerspiele:
Bereits im Dezember 1972 wurde von der Israelitischen Kultusgemeinde München und
Oberbayern eine Gedenktafel am Eingang der Connollystraße 31 angebracht. Die Tafel
ist zweisprachig, deutsch und hebräisch. Neben den Namen der elf ermordeten Israelis
trägt sie eine an das Ereignis erinnernde Inschrift. Die Tafel ist schlicht gehalten,
weitere Hintergrundinformationen erhält man an diesem Ort nicht.
Abb. 1) Gedenktafel Connollystraße 31, Olympiapark München
–5–Der zweite Gedenkort befindet sich an der Nordseite der Hanns-Braun-Brücke.
Nach der Gedenkveranstaltung zum 20. Jahrestag des Attentates 1992 befanden
Vertreter des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) in Israel und des Nationalen
Olympischen Komitees in Deutschland, der bestehende Gedenkstein an der
Connollystraße 31 würdige die Geschehnisse nicht ausreichend. Auf Initiative des
ehemaligen Präsidenten des Nationalen Olympischen Komittes, Willi Daume, wurde
der Bildhauer Fritz König beauftragt, ein weiteres Denkmal für die ermordeten Israelis
zu schaffen.
Am 27. September 1995 wurde es eingeweiht. Der zehn Meter breite und 18 Tonnen
schwere Granitbalken trägt als Inschrift die Namen der ermordeten israelischen
Sportler auf Hebräisch und den Namen des Polizeiobermeisters Anton Fliegerbauer auf
Deutsch. Der Balken soll sich – so ein Grundgedanke – den Besucherströmen des
Olympiaparks erinnernd und mahnend in den Weg stellen.
Abb. 2) Denkmal von Fritz König, Olympiapark München
–6–Bei diesem Denkmal gab es schon im Vorfeld die Kritik, die Inschrift führe nur die
Namen der Verstorbenen auf, erkläre jedoch nicht die Umstände des Attentats. Als
Reaktion darauf wurde nachträglich vor der Skulptur eine kleine Informationstafel im
Boden eingelassen.
Am zweiten zentralen historischen Ort, dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck, an dem das
Geiseldrama sein tragisches Ende fand, wurde 1999 ein Denkmal des Künstlers
Hannes L. Götz eingeweiht. Wie schon bei den beiden anderen Denkmälern gibt es
auch hier nur sehr wenig Informationen über die Geschehnisse am 5. und 6.
September 1972.
Die vorhandenen Denkmäler halten zwar die Erinnerung an die Opfer wach und
erfüllen damit eine ganz wesentliche Funktion. Das international so einschneidende
Ereignis des 5. und 6. September 1972 und seine dramatischen Folgen erschließen
sich den Besuchern des Olympiaparks jedoch nur unzureichend. Diese Funktion der
notwendigen Informationsvermittlung am historischen Ort des Geschehens soll der nun
geplante Erinnerungsort übernehmen. Zugleich soll er sich würdigend auf die
bestehenden Memoriale – Gedenkstein Connollystraße 31 und Gedenkbalken an der
Nordseite der Hanns-Braun Brücke – beziehen und auf sie verweisen.
Die Bedeutung des Attentates für Israel und die Verankerung im kulturellen Gedächtnis
des Landes kann man vor allem auch an den verschiedenen Erinnerungsorten in Israel
ablesen. Das zentrale Denkmal und der Ort der jährlich stattfindenden
Großveranstaltung zur Erinnerung an die verstorbenen Sportler ist die Skulptur des
Künstlers Eli Ilan War between the Sons of Light against the Sons of Darkness an der
Weizmann-Straße in Tel Aviv.
Daneben gibt es noch zahlreiche weitere Memoriale in Israel, unter anderem in Netanja
im Wingate Institute for Physical Education and Sports das Denkmal des Bildhauers
Naftali Israel, oder im Ben Shemen Wald in der Nähe von Shelat, wo sich ein Stein mit
den Namen der Verstorbenen befindet. Das Fußball-Stadion in Aschdod wurde im
Gedenken an die elf Ermordeten Etztadion HaYudAlef genannt, wobei Yud Alef
übersetzt elf heißt und als Begriff für die ermordeten Sportler im Sprachgebrauch
gängig verwendet wird. Verschiedene Straßen im Land sind nach den Toten von
München benannt, beispielsweise die „Straße der Elf Märtyrer von München“ in Lod
oder der „Platz der Elf“ in Bnei Brak.
–7–Abb. 3) Skulptur des Künstlers Eli Ilan „War between the Sons of Light
against the Sons of Darkness”, Tel Aviv.
Ein jährlich stattfindendes Jugendringer-Turnier in Israel heißt XI Martyrs, und das Lied
Stars in September von Ehud Manor, Gila Hassid und Hirsche Harz wurde in
Gedenken an die ermordeten Sportler komponiert.
Darüber hinaus sind seit 1972 weltweit Denkmäler für die ermordeten Israelis
–8–entstanden, etwa in London im Arthaus Hackney, im Sydney Olympic Park, im
Sportstadion Coliseum in Los Angeles oder im Nationalpark in Cleveland.
Im neu zu errichtenden Erinnerungs- und Informationsort könnte eine künstlerische
Intervention im Blick auf die die Denkmäler an die elf Israelis darauf verweisen, wie
stark dieses Attentat weltweit im kulturellen Gedächtnis vorhanden ist und damit
nochmals seine Tragweite hervorheben.
–9–3. Inhaltliches Konzept
Der geplante Erinnerungs- und Informationsort erinnert an das Attentat auf die
israelische Olympiamannschaft bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in
München. Das besondere Augenmerk liegt auf den Biographien der Opfer. Ohne eine
(kultur-)historische und politische Einbettung kann eine angemessene
Informationsvermittlung jedoch nicht stattfinden. Für ein tieferes Verständnis der
Ereignisse am 5. und 6. September 1972 sollen folgende Themenschwerpunkte
innerhalb des neu zu schaffenden Ortes erläutert werden.
1. Das Attentat
2. Die Opfer
3. Kontextualisierung
• Die politische Dimension Olympias allgemein und die besondere Bedeutung der
Sommerspiele 1972 für die Stadt München, für Bayern und für Deutschland
• Das deutsch-israelische Verhältnis zu dieser Zeit
– 10 –• Transnationaler Terrorismus dieser Zeit und die Attentäter des Schwarzen
Septembers
• Nachwirkungen des Attentats und das Erinnern an die Opfer weltweit
Die Punkte werden im Folgenden skizziert.
3.1 Das Attentat
Am Morgen des 5. September 1972 drangen acht Angehörige der terroristischen
Organisation Schwarzer September in das Olympische Dorf ein. Ihr Ziel war die
Connollystraße 31, wo Mitglieder der israelischen Mannschaft untergebracht waren. Als
die Terroristen in das Appartement 1 eindrangen, gelang es Tuvia Sokolowsky, Trainer
der Gewichtheber, über den Balkon zu fliehen. In Appartement 3 wurden weitere
Geiseln genommen. Dem Ringer Gad Tsabary gelang ebenfalls die Flucht. Am Ende
befanden sich elf israelische Sportler als Geiseln im Zimmer des Fechttrainers André
Spitzer: er selbst, Jacob Springer (Gewichtheber-Kampfrichter), Joseph Romano
(Gewichtheber), Joseph Gutfreund (Ringer-Kampfrichter), Moshe Weinberg (Ringer-
Trainer), Ze'ev Friedman (Gewichtheber), David Berger (Gewichtheber), Eliezer Halfin
(Ringer), Amitzur Shapira (Leichtathletik-Trainer), Kehat Shorr (Schützen-Trainer) und
Mark Slavin (Ringer). Appartement 2, in dem sich die zwei Fechter Dan Alon und
Yehuda Weinstain, die Sportschützen Henry Herkowitz und Zelig Shtorch als auch der
Geher Dr. Shaul Ladany befanden, wurde von den Geiselnehmern verschont.
Moshe Weinberg und Josef Romano – beide versuchten sich gegen die Terroristen zur
Wehr zu setzen – wurden noch in der Connollystraße 31 ermordet.
Nach mehreren gescheiterten Befreiungsaktionen beschloss der politische Krisenstab,
bestehend aus Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, Polizeipräsident Dr.
Manfred Schreiber und dem Bayerischen Innenminister Dr. Bruno Merk, alle Beteiligten
an den Flughafen nach Fürstenfeldbruck zu bringen, da man vorgab, die Terroristen
nach Kairo ausfliegen zu wollen. Die Verantwortlichen planten jedoch einen
Befreiungsversuch auf dem Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck. Diese Aktion endete in
einer Katastrophe: Alle Geiseln wie auch der deutsche Polizeiobermeister Anton
Fliegerbauer sowie fünf der Terroristen starben.
– 11 –Abb. 5) Die zentrale Gedenkfeier zum 40. Jahrestag des Olympiaattentats fand am 5. September
2012 in Fürstenfeldbruck statt, zu der die Angehörigen der Opfer und die israelischen
Mannschaftskollegen von 1972, die nicht dem Attentat zum Opfer fielen, eingeladen wurden.
Nicht nur das Sportereignis selbst war ein weltweit beachtetes Medienspektakel, auch
das Attentat wurde zu einem globalen Medienereignis. Fernsehstationen aus der
ganzen Welt berichteten live über die Ereignisse des 5. und 6.Septembers 1972.
Erstmals konnten Zuschauer an ihren Bildschirmen ein Attentat in Echtzeit
mitverfolgen. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt das Olympia-Attentat daher
gemeinhin als die Geburtsstunde des internationalen Terrorismus.
3.2 Die Opfer
Die Biographien der elf israelischen Opfer bilden das zentrale Narrativ der geplanten
Ausstellung. Durch den entstehenden Erinnerungsort soll den Opfern ein Gesicht
gegeben und damit die individuelle Menschenwürde zur Geltung gebracht werden.
Dabei werden individuelle Erinnerungen an die einzelnen Menschen und ihre jeweilige
Rolle beim Ereignis berücksichtigt, so dass diese Darstellung grundlegende Fragen der
Menschenwürde im Sinne einer Selbstverständigung im freiheitlichen Rechtsstaat
– 12 –anzusprechen vermag. Gleichzeitig öffnen die Biographien der Opfer in der Darstellung
von Herkunft, Lebensstationen und Nachwirkungen Perspektiven auf die israelische
Gesellschaft, ihre Vielfalt und Heterogenität. Zudem weisen die Einzelbiographien
selbstredend Schnittmengen zur Sportgeschichte auf.
Ebenso sollen die Erinnerungen der Angehörigen der Opfer, wie auch der
überlebenden israelischen Mannschaftskameraden der elf israelischen Sportler
berücksichtigt werden. Gleiches gilt für die teils gravierenden Aus- und Nachwirkungen
des Attentats auf diese Personen in ihrem weiteren Leben.
Bei einer ersten Israelreise der Konzeptgruppe im April 2013 fand bereits ein
Austausch mit Angehörigen und Mannschaftskameraden statt. Deren Bedürfnisse und
Empfindungen sollen impulsgebend für den Themenschwerpunkt der Biographien sein.
Hier ein kurzer Überblick über die elf israelischen Sportler, die dem Attentat zum Opfer
fielen:
David Berger wurde 1944 in Shaker Hights im US-Bundesstaat Ohio geboren
und studierte Psychologie. 1970 wanderte er nach Israel ein und nahm 1972 als
Gewichtheber im Leichtschwergewicht an den Olympischen Spielen teil.
Ze'ev Friedman wurde 1944 im sibirischen Prokopjevsk geboren. Seine Familie
lebte ab 1958 in Polen, von wo aus sie 1960 nach Israel einwanderte. Friedman
arbeitete später als Sportlehrer und trat als Gewichtheber im Bantam-Gewicht bei
den Olympischen Spielen 1972 an.
Yossef Gutfreund wurde 1931 in Rumänien geboren. 1948 emigrierte er nach
Israel und betrieb in Jerusalem ein Elektrogeschäft. Zu den Spielen in München
reiste er als Ringer-Kampfrichter an und zog es vor, anders als die anderen
Kampfrichter, bei seiner Mannschaft in der Connollystraße zu wohnen.
Eliezer Halfin wurde 1948 in Riga geboren. Bereits 1963 beantragte die Familie
ihre Ausreise aus der Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik, konnte aber erst
1969 das Land verlassen. Kurz vor seiner Abreise nach München beendete er
seine Lehre als Automechaniker. In München trat er als Freistil-Ringer im
Leichtfliegengewicht an.
Joseph Romano wurde 1940 in Bengasi (Libyen) geboren. Sechs Jahre später
– 13 –verließen er und seine Familie Libyen und wanderten nach Palästina aus. Er
machte eine Lehre zum Innenausstatter und arbeitete gleichzeitig als Trainer.
Romano reiste als Gewichtheber im Mittelgewicht nach München.
Amitzur Shapira wurde 1932 in Tel Aviv geboren. Nach einer Karriere als
Kurzstreckenläufer arbeitete er als Trainer und Dozent am Wingate Institute in
Netanja. Er war der Trainer von Esther Roth (geborene Shahamorov), der
erfolgreichsten Leichtathletin Israels. Shapira reiste als Leichtathletik-Trainer
gemeinsam mit Esther Roth nach München.
Jacob Springer wurde 1921 in Polen geboren. Im Alter von 18 Jahren floh er vor
den Nationalsozialisten in die Sowjetunion. Seine Eltern und Geschwister fielen
alle der Schoa zum Opfer. 1946 kehrte er nach Polen zurück, wo er elf Jahre
lebte, bevor er mit Frau und Kindern die Aliya antrat. Zu den Sommerspielen
reiste Springer als Kampfrichter an und zog es wie Gutfreund vor, bei seiner
Mannschaft in der Connollystraße zu wohnen, statt außerhalb des Olympischen
Dorfes.
Kehat Shorr wurde 1919 in Rumänien geboren. Er überlebte als Partisan in den
Karpaten die Schoa. 1963 machte er Aliya und führte in Israel den Schießsport
ein. Shorr arbeitete im israelischen Verteidigungsministerium und bildete
nebenher zahlreiche Sportschützen aus. Nach München reiste er als
Sportschützen-Trainer.
Mark Slavin wurde 1954 in Minsk geboren. In der Sowjetunion wurde er
inhaftiert, nachdem er sich gegen Repressalien aufgrund seiner jüdischen
Herkunft zur Wehr setzte. Erst dreieinhalb Monate vor der Olympiade konnte er
nach Israel ausreisen und trat als Ringer im griechisch-römischen Stil an.
André Spitzer wurde 1945 in Rumänien geboren. 1964 trat er gemeinsam mit
seiner Mutter die Aliya an. Nach seinem Militärdienst arbeitete er als Fechttrainer
in den Niederlanden. Zurück in Israel wurde er Trainer im Wingate Institute in
Netanja. Als Fechttrainer reiste er auch nach München, gemeinsam mit seiner
Frau Ankie.
Moshe Weinberg wurde 1939 in Palästina geboren. Am Wingate Institute
absolvierte er eine Ausbildung zum Ringer-Trainer und stieg später zum Direktor
auf. Zu den Sommerspielen in München reiste er als Trainer der Ringer-
– 14 –Mannschaft.
Ausgehend von den Biographien der Sportler wird auch ein Einblick in die israelische
Gesellschaft seinerzeit gegeben und damit auch das – bis heute gültige – plurale
gesellschaftliche Profil Israels abgebildet. Die Biographien der Sportler spiegeln
beeindruckend die heterogene israelische Gesellschaft wider, die auch heute noch
vorwiegend aus Einwanderern besteht und die Fragen nach Identität und
Zusammenleben immer wieder neu verhandeln muss.
3.3 Kontextualisierung
3.3.1 Die politische Dimension Olympias
Die Idee der Olympischen Spiele der Neuzeit wurde getragen von dem Gedanken der
Überwindung nationaler Egoismen im Geiste internationaler Verständigung. Die
Olympischen Spiele präsentieren sich ohnedies seit ihrer Gründung als ein
Gegenentwurf zu den der geschichtlichen Welt inhärenten Gesetzmäßigkeiten. Dieser
Gedanke hält sich bis heute und – neben dem sportlichen Ereignis – kann die
Bedeutung für die Imagepflege des jeweiligen Austragungsortes kaum hoch genug
eingeschätzt werden.
Auf internationaler Ebene boten die Olympischen Sommerspiele für die Bundesrepublik
Deutschland eine Chance, international kulturelles Kapital als weltoffenes, freiheitliches
Land zu generieren. Bis 1972 war die internationale Bedeutung und Wahrnehmung der
Bundesrepublik nicht besonders stark ausgeprägt bzw. der Einordnung in klare
außenpolitische Festlegungen unterworfen. Dabei stand das politische Handeln der
Bundesrepublik stets unter dem Aspekt der Bewährung nach dem Zivilisationsbruch
durch den Nationalsozialismus.
Für Westdeutschland waren die Sommerspiele 1972 unter diesem Gesichtspunkt von
größter Bedeutung: Der NS-Vergangenheit und im Besonderen den Olympischen
Spielen von Berlin 1936 stellte man eine moderne Bundesrepublik im Rahmen heiterer
und friedlicher Spiele gegenüber.
Für die Entwicklung der Stadt München hatte die Entscheidung für den Standort eine
beschleunigende Wirkung. Olympia löste in München einen Modernisierungsschub
aus, der zwar schon vor der Entscheidung, die Sommerspiele hier zu veranstalten,
– 15 –spürbar war, jedoch nach der Entscheidung nochmals an Dynamik gewann. Der
Zuschlag für die Olympischen Spiele 1972 führte beispielsweise zu einer Verkürzung
des Münchner Stadtentwicklungsplanes von 30 auf sechs Jahre.
Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Tragweite des Attentates von und für München;
deshalb soll die Idee der Heiteren Spiele besonders beschrieben werden. Sie
konnotierten sowohl das Selbstbild einer splendid isolation als auch den Versuch eines
Abschlusses der Nachkriegsära. München stellte sich offen und modern dar, die
Veranstalter wollten ein neues, demokratisches Deutschland präsentieren. Das
Sicherheitskonzept der Spiele sollte in keinem Fall an die Vergangenheit erinnern und
– etwa mit offensiver Präsenz der Sicherheitsbehörden – polizeistaatliche
Assoziationen evozieren. Dieser gute Wille hat sich als fatale Fehleinschätzung der
realen Koordinaten erwiesen.
3.3.2 Die deutsch-israelischen Beziehungen
Das im Zentrum stehende Ereignis des Überfalls bzw. des Attentats stellt eine Zäsur in
der jüngeren Geschichte der internationalen Politik dar. Terror wird erstmals zu einem
globalen Medienereignis, mediale Vermittlung ist eine seiner Funktionen.
Nachkriegsdeutschland wird nunmehr offenkundig zu einem Akteur im Geflecht
international ausgetragener Konflikte und gleichzeitig im eigenen Land mit einem
neuen Antisemitismus konfrontiert, der zu Neudefinitionen der eigenen Rolle zwingt.
Das Attentat verwickelte Deutschland von Neuem in grundsätzliche
Verantwortlichkeiten.
Mit der Darstellung dieser Ausgangssituation soll hier vor allem zentral die besondere
Beziehung zu Israel beschrieben werden. Erst seit 1965 gab es offiziell diplomatische
Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Israel. Die Zeit bis 1972
war einerseits durch Spannungen und andererseits durch Annäherungsversuche
geprägt.
Außenpolitisch fiel das Attentat in eine Zeit zwischen den zwei wichtigsten Kriegen, die
Israel seit dem Unabhängigkeitskrieg mit seinen arabischen Nachbarn ausfocht. Der
Sechstagekrieg 1967 stärkte das Zusammengehörigkeitsgefühl der Israelis, deren
Gesellschaft sich zuvor in einer bedrohlichen Identitätskrise befand. Israel ging aus
dem Krieg als eindeutigerSieger hervor. Die Nachbarländer waren schwer erschüttert
und umso angespannter war die Lage im Nahen Osten bis zum Jom-Kippur-Krieg
– 16 –1973. Der Sieg Israels 1967 und die Eroberung neuer Gebiete verschärfte den Konflikt
mit den Palästinensern. Hunderttausende kamen im Westjordanland, in Jerusalem und
im Gazastreifen unter israelische Besatzung und Militärverwaltung.
Der Sechstagekrieg von 1967 stellt in den Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und Israel eine deutliche Zäsur dar. Während die westdeutsche Regierung
sich während des Krieges „neutral“ verhielt, lösten die Kampfhandlungen im Nahen
Osten eine Reihe von Solidaritätsbekundungen gegenüber Israel in der deutschen
Bevölkerung aus. In Israel nahm man dies als Bewährungsprobe der deutsch-
israelischen Beziehungen wahr. Während man wirtschaftliche Beziehungen schon
länger pflegte, machte nach Ende des Krieges auch der Austausch kultureller
Beziehungen beachtliche Fortschritte.
Ende der 60er Jahre rief allerdings der Anstieg des antiisraelisch und antisemitisch
grundierten Radikalismus in Westdeutschland, sowohl von rechts als auch von links,
Besorgnis in Israel hervor und fand ein beachtliches negatives Echo in der israelischen
Öffentlichkeit. Aufgrund seiner Vergangenheit traute man Deutschland ohnehin nur
bedingt, zudem hatte Israel Sorge, dass Deutschland sich an die arabischen Länder
annähern würde.
In dieser schwierigen Gemengelage sandte Israel eine so große Delegation zu den
Olympischen Spielen nach München wie noch nie zuvor in ein anderes
Austragungsland.
3.3.3 Transnationaler Terrorismus
In dieser Kontextualisierungsebene soll erläutert werden, in welchem Zusammenhang
das Olympia-Attentat in München mit dem internationalen Terrorismus steht. Das
palästinensische Täterspektrum soll genauer beleuchtet werden, allerdings ohne die
Täter gleichwertig mit den Opferbiographien darzustellen. Die weitere Arbeit an der
Realisierung dieses Konzeptes wird sich mit der angemessenen Form des Umgangs
mit dem Täterspektrum zu befassen haben.
Nach dem Attentat auf die israelischen Teilnehmer der Olympischen Spiele sprach
Bundesinnenminister Genscher von einer „neuen Form der Kriminalität, nämlich dem
internationalen Terrorismus“. Ausgeübt wurde das Attentat durch die Organisation
Schwarzer September, die 1971 als Tochterorganisation der Fatah und der Volksfront
– 17 –zur Befreiung Palästinas (PFLP) gegründet wurde. Es ist deshalb zu zeigen, inwiefern
der Angriff auf die israelische Mannschaft eine Zäsur in der jüngeren Geschichte der
internationalen Politik darstellte.
Allerdings hatte es schon vor 1972 mehrere Anschläge transnationaler, terroristischer
Vereinigungen gegeben – auch in Deutschland. Beispielsweise wurde im September
1969 ein Handgranaten-Anschlag auf die israelische Botschaft in Bonn verübt. Im
Februar 1970 griffen palästinensische Terroristen in München Riem Passagiere und
Besatzung einer Maschine der israelischen Fluggesellschaft El-Al an, wobei ein Israeli
ermordet wurde. Knapp zwei Wochen später explodierte eine Bombe in einem
Flugzeug der Austrian Airlines von Frankfurt am Main nach Wien. Alle Insassen
überlebten. Tötlich verlief allerdings ein Anschlag auf eine Swiss Air-Maschine von
Zürich nach Tel Aviv am gleichen Tag. Nach der Explosion eines Sprengsatzes starben
alle 47 Passagiere und Besatzungsmitglieder. Zu beiden Anschlägen bekannte sich die
Volksfront zur Befreiung Palästinas (PFLP).
Vor der Folie dieser Attentate stellte das Olympia-Attentat die entscheidende Zäsur im
Blick auf die öffentliche Wahrnehmung des gesamten Verbrechenszusammenhangs
dar: Die umfassende Schockwirkung im Zusammenhang mit der medial und politisch
konstruierten wie auch öffentlich so rezipierten Präsentation der heiteren Spiele
begründete für die Bundesrepublik Deutschland wie auch international einen
fundamental neuen Bezugspunkt für die Definition und Wahrnehmung von Terrorismus.
3.3.4 Nachwirkungen
Das Attentat auf die israelischen Sportler während der Olympischen Sommerspiele
1972 hatte weitreichende, bis heute anhaltende Nachwirkungen.
Es soll hier nochmals – auch anschließend an die beschriebene Repräsentativität der
Opfer für die israelische Gesellschaft – verständlicher werden, warum dieses Attentat
bis heute eine so nachhaltige Bedeutung für Israel hat. Die wechselvolle Geschichte
des Landes seit seiner Gründung 1948 ist geprägt durch permanente kriegerische
Auseinandersetzungen mit seinen Nachbarn, die Israel mit dem Tag der
Staatsgründung angegriffen haben und seine Existenz bis heute vielfach nicht
akzeptieren. Umso größer war das Entsetzen darüber, dass ein Attentat auch
außerhalb des Nahen Ostens – und ausgerechnet in Deutschland – stattfand. Das
Entsetzen und die Trauer über die Vorkommnisse in München unmittelbar nach der Tat
waren enorm, und rasch wurden Stimmen nach Vergeltung laut. Israels damalige
– 18 –Ministerpräsidentin Golda Meir setzte eine geheime israelische Einheit ein, die den
Auftrag erhielt, die Drahtzieher und überlebenden Täter des Münchner Attentates zu
töten.
Gleichzeitig trug auch die Bundesrepublik der Tatsache Rechnung, dass sie mit einem
akribisch geplanten terroristischen Akt konfrontiert war, der mit äußerster Gewalt
durchgeführt wurde: Der damalige Bundesinnenminister Genscher veranlaßte noch im
September 1972, eine reine Anti-Terror Einheit – die Grenzschutzgruppe 9 – zu
gründen.
Das International Olympic Committee (IOC) ließ nach einem Tag Unterbrechung die
Spiele fortführen. Nach der fehlgeschlagenen Befreiungsaktion in Fürstenfeldbruck und
dem Tod aller elf Geiseln und des Polizeimeisters Anton Fliegerbauer wurde im
Olympiastadion eine Trauerfeier abgehalten. Bei dieser Trauerfeier für die Opfer
forderte der IOC-Präsident Avery Brundage: „The Games must go on!“ Bis heute sperrt
sich das IOC dagegen, diese Entscheidung in Frage zu stellen oder der Attentatsopfer
regelmäßig und angemessen öffentlich zu gedenken. Die Angehörigen der Opfer, allen
voran die Witwen Ankie Spitzer und Ilana Romano, setzen sich seither vehement dafür
ein, bei den Olympischen Spielen eine Schweigeminute zum Gedenken an die Opfer
von 1972 abzuhalten. Bisher hat sich das IOC bei den nachfolgenden Olympischen
Spielen immer dagegen entschieden.
Ausgelöst durch das Attentat 1972 und ein erneutes Attentat bei den Olympischen
Sommerspielen 1996 in Atlanta, bei dem es zwei Tote und 111 Verletzte gab, sind die
Sicherheitsvorkehrungen bei Olympia immens gestiegen. Die Olympischen
Sommerspiele in London 2012 wurden zur größten britischen Militäroperation seit dem
Koreakrieg.
– 19 –4. Standort
Abb. 6) Diskutierte Standorte für den Erinnerungsort.
Im Vorfeld der Konzepterstellung wurden bereits zwei Standorte für den Erinnerungsort
Olympia-Attentat diskutiert:
Appartement Connollystraße 31 (1)
Der Tatort der Ermordung zweier israelischer Sportler und Schauplatz der
Geiselnahme, befindet sich heute im Besitz der Max-Planck-Gesellschaft, die die
Wohnung, in der die Terroristen eindrangen, als Appartement für Gastwissenschaftler
nutzt. Eine Verwendung der Wohnung als Ausstellungs- und Erinnerungsort ist nicht
nur auf Grund der heutigen Besitzverhältnisse und der langjährigen Nutzung nicht
möglich. Sie wäre auch mit unzumutbaren Einschränkungen der Wohnqualität für die
Anwohner verbunden. Zudem müssten einer solchen Umwidmung alle rund 110
Eigentümer der Wohnanlage zustimmen; ein solches Verfahren birgt unübersehbare
Risiken für eine zügige Realisierung des Vorhabens.
– 20 –Ehemaliger S-Bahnhof Oberwiesenfeld (nicht auf der Luftaufnahme)
Der unter Denkmalschutz stehende ehemalige S-Bahnhof Oberwiesenfeld wurde in der
öffentlichen Debatte um seine künftige Nutzung ebenfalls als Standort für den
Erinnerungsort diskutiert. Wegen seiner peripheren Lage, dem fehlenden Bezug zum
Attentat und dem Fehlen von Blickachsen zu den Orten des Geschehens, ist er für den
Erinnerungsort nicht geeignet.
Beide Standortvorschläge wurden aus diesen Gründen von der Konzeptgruppe nicht
mehr weiter verfolgt.
Als weitere Standort-Alternativen wurden diskutiert:
Kusocinski-Damm (2)
Auf Höhe der Anlagen des Zentralen Hochschulsports (ZHS) liegt dieser Standort
genau zwischen den beiden Denkmälern an der Hanns-Braun-Brücke und vor dem
Gebäude Connollystraße 31. Allerdings befindet er sich nicht an einer der
Haupterschließungsachsen und ermöglicht wegen der starken Abschattung keine
Einbeziehung von Sichtachsen in die Connollystraße und zum Stadion.
Olympia-Busbahnhof (3)
Diskutiert wurde auch dieser Standort, der durch seine Lage an einem der
Hauptzugänge der Besucherinnen und Besucher des Olympiaparks Vorteile hat. Die
ungeklärte künftige Nutzung des unter Denkmalschutz stehenden Busbahnhofs und
Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit Plänen für einen Hotelbau im Bereich
zwischen Busbahnhof und Olympiapark (und der damit verbundenen Gefahr,
Sichtachsen zu verlieren), machen diese Standortalternative zu einem Risiko in
Hinblick auf den Zeitplan und die räumlichen Bezüge zu den Orten des Geschehens.
Zudem befindet sich diese Liegenschaft nicht im Besitz des Freistaats.
Während der einjährigen Konzeptphase und zahlreichen Begehungen des Geländes
zu unterschiedlichen Jahreszeiten rückte ein Standort am Kolehmainenweg immer
mehr ins Blickfeld:
Kolehmainenweg (4)
Die Anhöhe südlich der Connollystraße, die vom Olympia-Busbahnhof zur Hanns-
Braun-Brücke führt, ist den anderen Standortüberlegungen in allen Parametern
überlegen. Auf Höhe des Cafés „München '72“ fällt das Gelände muldenförmig zum
Olympischen Dorf hin ab. Der Standort ermöglicht einen Blick auf die Connollystraße
– 21 –31, gleichzeitig sind die ikonenhaften Hauptbauwerke des Olympiaparks (Stadion,
Olympiaturm und Olympiahalle) zu sehen. Des weiteren besteht ein räumlicher Bezug
zu dem 1998 von Fritz König geschaffenen Denkmal auf dem der Hanns-Braun-Brücke
nördlich vorgelagerten Platz. Die Nähe zur U-Bahnstation und zur BMW-Welt sowie die
Lage an einem Hauptzugang zum Olympiapark, der auch von vielen der 2.500
Sportstudenten auf ihrem Weg zum ZHS genutzt wird, sprechen ebenfalls für diesen
Standort.
Die Konzeptautoren empfehlen deshalb nachdrücklich, den Standort
Kolehmainenweg für die Umsetzung des Erinnerungsortes auszuwählen.
– 22 –5. Perspektive Fürstenfeldbruck
In einer gemeinsamen Pressekonferenz im alten Tower des Fliegerhorstes
Fürstenfeldbruck erklärten am 17. Januar 2013 Staatsminister Dr. Ludwig Spaenle,
Landrat Thomas Karmasin (Landkreis Fürstenfeldbruck) und Oberbürgermeister Sepp
Kellerer (Stadt Fürstenfeldbruck) die Absicht, die Errichtung eines Erinnerungsortes
Olympia-Attentat 1972 voranzutreiben.
Um eine Realisierung der Vorhaben im Bereich des Fliegerhorstes Fürstenfeldbruck
abzusichern, strebt das Staatsministerium für Unterricht und Kultus an, im Benehmen
mit Stadt und Landkreis Fürstenfeldbruck wie auch mit dem Bund eine
Rahmenkonstruktion zu institutionalisieren, an der die genannten
Gebietskörperschaften jeweils substanziell zu beteiligen sind. Ziel ist es dabei, eine
Trägergesellschaft für die Ausstellung bzw. den Erinnerungsort zu schaffen, bei der die
Liegenschaft selbst im Eigentum des Bundes verbleibt.
Derzeit wird der Schauplatz der in der Nacht vom 5. auf den 6. September 1972
gescheiterten Geiselbefreiung – der alte Tower und das Rollbahnvorfeld – von der
Bundeswehr genutzt. Nach Abzug der Bundeswehr, der voraussichtlich 2018
abgeschlossen sein wird, können Teile des alten Towers für einen solchen
Erinnerungsort genutzt werden.
Sollten diese Voraussetzungen erfüllt werden, empfehlen die Konzeptautoren
folgende konzeptionellen Grundlagen:
• Für eine Ausstellung zur Erinnerung an das Olympia-Attentat soll im alten Tower
– vorzugsweise in einem der oberen Geschosse – eine Fläche von ca. 200 qm
vorgesehen werden.
• Jene Teile des Rollbahnvorfelds, auf dem die Hubschrauber mit den Geiseln
landeten, sollen als authentischer Ort erhalten werden und unverbaut bleiben.
• Die Erstellung eines Ausstellungskonzeptes soll in enger Abstimmung mit dem
Münchner Projekt durchgeführt werden. Die Angehörigen der Opfer sollen in
den Planungsprozess eingeschlossen werden. Inhaltlicher Schwerpunkt sollen
neben einem Überblick zum gesamten Vorgang die Ereignisse in
– 23 –Fürstenfeldbruck und ihre Folgen (Aufbau von Antiterror-Einheiten,
Erinnerungskultur zum Olympia-Attentat, Engagement der örtlichen Akteure)
sein.
• Die Geschichte des alten Towers (architektonische Bedeutung als spätes Werk
der Architekten der Bayerischen Postbauschule, Nutzung während des
Nationalsozialismus, durch die US-Army und durch die Bundeswehr) soll in
einem räumlich abgetrennten Bereich (z.B. Eingangsbereich) thematisiert
werden.
• Die an verschiedenen Stellen (Einfahrtsbereich des Fliegerhorstes, Außenwand
des alten Towers) angebrachten Gedenk- und Erläuterungstafeln sowie das
1999 nach Entwürfen von Hannes L. Götz errichtete Denkmal sollen von ihren
bisherigen Standorten entfernt und als Zeugnisse des Gedenkens an das
Olympia-Attentat in die Ausstellung zur Erinnerung an das Olympia-Attentat
integriert werden.
• Im Bereich des ehemaligen Rollbahnvorfelds soll im Rahmen eines
künstlerischen Wettbewerbs im Dialog mit den Kurator/innen der Ausstellung
ein Erinnerungszeichen mit Denkmalcharakter realisiert werden.
– 24 –Literatur (Auswahl)
Ben Natan Asher, Niels Hansen: Israel und Deutschland. Dorniger Weg zur
Partnerschaft. Die Botschafter berichten über vier Jahrzehnte diplomatische
Beziehungen, Köln 2005.
Tobias Blasius: Olympische Bewegung, Kalter Krieg und Deutschlandpolitik,
Frankfurt am Main 2001.
Evamaria Brockhoff, Ferdinand Kramer (Red.): München '72 (= Edition Bayern,
Sonderheft #02), Regensburg 2012.
John K. Cooley: Green March, Black September: The Story of the Palastinian Arabs,
London 1973
Matthias Dahlke: Demokratischer Staat und transnationaler Terrorismus. Drei Wege zur
Unnachgiebigkeit in Westeuropa 1972-1975, München 2011.
Matthias Dahlke: Der Anschlag auf Olympia '72. Die politischen Reaktionen auf den
internationalen Terrorismus, München 2006.
Matthias Hell: München '72. Olympia-Architektur damals und heute, München 2012.
Aaron J Klein; Arye Hashavia: Ḥeshbon patuaḥ. mediniyut ha-ḥisulim shel Yiśraʼel be-
ʻiḳvot ṭevaḥ ha-sporṭaʼim be-Minkhen, Tel Aviv 2006 [hebr.].
Ferdinand Kramer: München und die olympischen Spiele von 1972, In: Christian Koller
(Hrsg.): Sport als städtisches Ereignis, Ostfildern 2008, S. 239-252.
Wolfgang Kraushaar: „Wann endlich beginnt bei Euch der Kamp gegen die heilige Kuh
Israel? München 1970: über die antisemitischen Wurzeln des deutschen
Terrors, Reinbek bei Hamburg 2013.
Shaul Ladany: King of the Road. The Autobiography of an Israeli Scientist and a World
Record-Holding Race Walker, o.O. 2010.
– 25 –David Clay Large: Munich 1972. Tragedy, Terror, and Triumph at the Olympic Games,
Lanham-Boulder-New York-Toronto-Plymouth 2012.
Holger Nitsch: Terrorismus und Internationale Politik am Ende des 20. Jahrhunderts,
München 2001.
Eva Oberloskamp: Das Olympia-Attentat 1972. Politische Lernprozesse im Umgang
mit dem transnationalen Terrorismus, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte,
Bd. 60 (2012), S.320-352.
Galilah Ron-Feder-ʻAmit; Yonat Yizreʼeli: Olimpiʼadat Minkhen (= Minheret ha-zeman,
47), Ben Shemen 2009 [hebr.].
Simon Reeve: One Day in September. The Story of the 1972 Munich Olympics
Massacre, a Government Cover-up and a Covert Revenge Mission,
London 2000.
Referat für Stadtplanung und Raumordnung: Perspektiven für den Olympiapark
München. Landschafts- und stadtplanerische Rahmenplanung, München 2011.
Kay Schiller, Christopher Young: München 1972. Olympische Spiele im Zeichen des
modernen Deutschland, Göttingen 2012.
Angelika Schuster-Fox: 5. September 1972. Das Ende der heiteren Spiele,
Fürstenfeldbruck 2012.
Paul Taylor: Jews and the Olympic Games. The Clash between Sport and Politics,
Brighton-Portland 2004.
Michael Wolffsohn: Zeitfragen. Deutsch-Israelische Beziehungen. Umfragen und
Interpretationen 1952-1983, München 1986.
Michael Wolffsohn: München 1972. Was damals geschah, warum es geschah und was
sich bis heute (nicht) geändert hat, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung,
5. September 2012.
– 26 –Sie können auch lesen