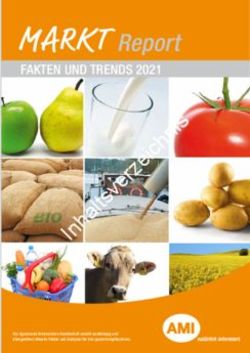"Es wird viel einfacher, CO2-frei zu leben" - SystemIQ
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Montag, 20.09.2021, Tagesspiegel / Wirtschaft
„Es wird viel einfacher, CO2-frei zu
leben“
Maja Göpel und Martin Stuchtey über die Vorschläge einer
neuen Initiative aus Wissenschaftlern und Unternehmern
für mehr Klimaschutz
© Patrick Pleul/dpa/pa
Windkraft statt Kohle. Deutschland steigt aus der Braunkohle, hier das Braunkohle‐
kraftwerk Jänschwalde, aus.
Ein Zusammenschluss prominenter Unternehmenslenker und Profes-
soren hat Maßnahmen für ein nachhaltigeres Deutschland entworfen.Tiefgreifende Reformen sollen den Treibhausgasausstoß und Natur- verlust in Deutschland auf netto null reduzieren und gleichzeitig die soziale Sicherung erhalten. In der Initiative haben sich unter anderem Hypovereinsbank-Chef Michael Diederich, Goldbeck-Geschäftsführer Jan-Hendrik Goldbeck, Deutsche-Post-Aufsichtsrätin Simone Menne und der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, Jo- han Rockström, zusammengeschlossen. Ihr „Kompass für Deutsch- land“, der diese Woche veröffentlicht werden soll und dem Tagesspie- gel vorab vorliegt, enthält Handlungsempfehlungen für die neue Bundesregierung. Das Steuersystem will die Initiative so ändern, dass Ressourcenver- brauch belastet und Arbeitseinkommen entlastet werden. Schädliche Anreize wie Dieselprivileg, Pendlerpauschale und Steuerbefreiung von Flugzeugkerosin sollen abgeschafft, Kohlendioxid-Emissionen hingegen besteuert und die Einnahmen daraus an die Bürger zurück- gezahlt werden. Eine „gesetzliche Aktienrente“ soll Altersvorsorgetöpfe für nachhalti- ge Investitionen bereitstellen. Staatliche Investitionen, Beteiligungen und Fördermittel sollen ebenfalls dafür dienen. Zudem will die Initia- tive vorschreiben, dass Vorstände und Aufsichtsräte über Sachver- stand in Nachhaltigkeit verfügen und ihre Bezahlung an nachhaltige Entwicklungen geknüpft wird. Auch Bilanzierungsvorschriften für Unternehmen sollen sich ändern: Bislang nämlich könnten Nachhal- tigkeitsmaßnahmen oft nur als Aufwand verbucht werden, was Finan- zierungen erschwere. Weitere Vorschläge: Emissionsarme Schlüsseltechnologien sollen durch staatliche Nachfrage schneller zur Marktreife gebracht werden. Neue Handelsplätze sollen Recycling von Rohstoffen umfassend er- möglichen. Der Werterhalt von Produkten soll durch ein Recht auf Re- paratur gefördert werden. Frau Göpel, Herr Stuchtey, Sie haben hochkarätige Managerinnen und Manager mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu-
sammengebracht, um daraus so etwas wie einen Masterplan für den Umbau Europas in Richtung Klimaneutralität zu entwickeln. Hätten das die EU-Kommission und die Mitgliedsstaaten nicht auch selbst hingekriegt? STUCHTEY: Wir sind mit dem Club of Rome 2020 in eine Diskussion mit der EU-Kommission gekommen, in der uns die Frage gestellt wur- de: Was haltet Ihr vom European Green Deal? Die Antwort fiel uns leicht: Wir finden ihn gut. Schließlich handelt es sich um einen Para- digmenwechsel, wenn wir nach einem Modell suchen, das soziale, ökonomische und ökologische Ziele gemeinsam verfolgt. Dann wurde uns eine zweite Frage von der EU-Kommission gestellt: Kann das auch funktionieren? Ihre Antwort? STUCHTEY: Die fiel verhaltener aus: Wohl kaum, solange nicht eine Reihe von systemischen Voraussetzungen vorhanden sind. Welche zum Beispiel? STUCHTEY: Jene Dinge, die man anders machen müsste, damit man aus den heutigen Zielkonflikten zwischen Sozialem, Ökologischem und Ökonomischem herauskommt. Wie messen wir Wohlstand? Wie kann Wohlstand definiert werden mit begrenzten Ressourcen, mit an- deren Worten: Wie können wir eher nutzen- als produktorientiert sein? Wie müssen Märkte gestaltet sein, damit diejenigen belohnt werden, die positive Nebeneffekte erzeugen, und jene bestraft, die für negative Nebeneffekte sorgen? Und? Wie geht das? STUCHTEY: Wir brauchen eine systemische Modernisierung von In- dustrie, Wirtschaft und Gesellschaft. Damit wir das hinkriegen, fehlt uns aber noch ein Mut machender Impuls. Den wollen wir mit dem „Kompass“ liefern. Insbesondere wäre es hilfreich, wenn in der Wirt-
schaft, in der normalerweise vor allem ihre Partikularinteressen ver- teidigt werden, ans große Ganze gedacht wird. Sie kann der Politik Hinweise darauf geben, was machbar ist, wenn diese sich nur an ein paar richtig große Themen herantraut. GÖPEL: Krisenmomente sind schließlich immer auch Fenster der Möglichkeit: Die Bereitschaft in der Gesellschaft ist in Krisenzeiten sehr viel stärker ausgeprägt, sich mit Fehlentwicklungen auch wirk- lich auseinander zu setzen und grundsätzlichere Fragen zu stellen. Die Herausforderungen des Klimawandels sind schon seit mehr als 40 Jahren bekannt. Was macht Sie denn so optimistisch, dass sich jetzt etwas ändern wird? STUCHTEY: Es kommt eine Menge in Bewegung. Einerseits kann man in vielen Staaten sehen, dass in Teilbereichen mittlerweile ein Wett- lauf stattfindet, wer der Grünste aller Grünen ist. Beispiel dafür ist die britische Regierung, die angekündigt hat, nun 78 Prozent Emissions- reduktion bis 2035 realisieren zu wollen. Oder nehmen Sie die EU, die ihre Klimaziele nach oben korrigiert hat. Es gibt auch eine Menge Mutmacher, wenn man auf die Rechtsprechung schaut. So hat unser Bundesverfassungsgericht die Debatte vom Kopf auf die Füße gestellt: Es sind nämlich nicht die Umweltschützer, die unsere Freiheitsrechte bedrohen. Sondern es ist unser Unwillen, klimapolitisch rigoroser zu handeln, welcher der nächsten Generation Freiheitsrechte nehmen wird. Die Gesellschaft hört es nicht gerne, wenn ihr schnell große Opfer abverlangt werden. STUCHTEY: Wir wissen mittlerweile, dass wir technologisch in der Lage sind, das Klimaproblem zu lösen. Und zwar ohne massive Wohl- standsverluste. Aber wir haben keine Zeitreserven mehr. GÖPEL: Wir müssen uns erst einmal ehrlich machen. Wir fahren in vielen Bereichen der Wirtschaft auf blinde Sicht: Das fängt bei der
Wohlstandsmessung an und geht bei der unternehmerischen Bilan- zierung weiter. Unternehmen können nur schwerlich nachhaltig in- vestieren, weil der kurzfristige Erfolg des Geschäftsmodells und die finanzielle Rendite alles ist, was zählt. Das könnte man auch über die staatliche Haushaltsplanung sagen. GÖPEL: Stimmt. Nehmen wir unsere Schuldenbremse: Sie gilt vielen als Sakrileg. Aber wenn genau hingesehen wird, was wir durch die Aufnahme von neuen Krediten finanzieren können, ist eine differen- zierte Auslegung sinnvoll: Denn es handelt sich in vielen Bereichen nicht nur um eine Verschuldung, sondern auch um eine Investition in das Volksvermögen. Es entstehen ja auch Werte. Und wenn das Infra- strukturen sind, durch die eine Energieversorgung künftig viel kos- tengünstiger erfolgen kann, weil ich keine Brennstoffe mehr bezahlen muss, ist es nicht sinnvoll, nur Schulden auf einer Seite zu buchen, ohne dass die Aktiva auf der anderen Seite erscheinen. Dann wollen Sie also auch die seit Hunderten von Jahren beste- hende Kameralistik, die einfache Einnahmen-Ausgaben-Rechnung des Staates, abschaffen? GÖPEL: Erweitern. Wir nutzen heute Kennzahlen, die uns gerade nicht darüber aufklären, in welche Richtung Ausgaben und unsere Handlungen wirken, und was dadurch in Zukunft möglich sein wird. Deutschland kann aktuell durch Kreditaufnahme Geld einnehmen, und gleichzeitig sind alle besorgt darüber, wie sie in unseren aktuel- len Infrastrukturen etwa von Energie und Verkehr ohne hohe Zusatz- kosten CO2-frei leben sollen. Aber das ist vor allem eine temporäre Herausforderung: Es geht ja schließlich darum, dass wir ganz andere Infrastrukturen und Alltags- routinen haben werden, wenn die neu entwickelten Lösungen, an de- nen die Industrie längst arbeitet, schnell auf den Markt kommen. In zehn Jahren, da bin ich mir sicher, werden ganz andere Lebensstile
möglich. Es wird viel einfacher sein, CO2-neutral zu leben. Dagegen werden sich aber all diejenigen zur Wehr setzen, die viel zu verlieren haben. GÖPEL: Entscheidend ist, dass nicht nur Besitzstandswahrer und or- ganisierte Interessensvertretungen in der gesellschaftlichen und poli- tischen Diskussion angehört werden, und wir damit den üblichen Mi- nimalkonsens fortsetzen, sondern dass Pionierinnen und Pioniere als die Wirtschaft der Zukunft auftreten. Wenn sich mehr und mehr Füh- rungspersönlichkeiten anschließen, dann wird es auch immer schwieriger, zu sagen: „Die“ Wirtschaft wird darunter leiden. Es wird sehr viel deutlicher, wer mit einer Verhinderungslogik operiert. Und andererseits auch, wer die Zukunft gerne sehr viel schneller erschaf- fen würde. Es geht um Corporate Political Responsibility. Das Interview führten Friedrich Geiger und Thomas Wendel.
Sie können auch lesen