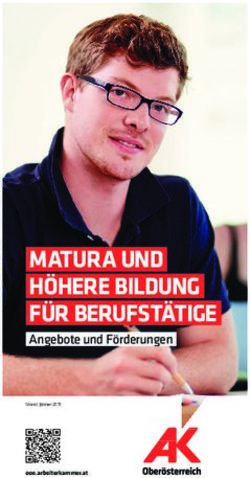Barrierefreie Sprache in der digitalen Kommunikation für Öffentlichkeit, Institutionen und Unternehmen Gerhard Edelmann Gebrauchsanleitung für ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
11. Barrierefreie Sprache in der digitalen
Kommunikation für Öffentlichkeit,
Institutionen und Unternehmen
Gerhard Edelmann
Gebrauchsanleitung für den Zugang zum Recht1. EINLEITUNG • Staatsbürger: Adressat der vom Staat erlassenen Normen und somit Träger von Rechten und Pflichten • Es ist wichtig, dass er ihm zustehende Rechte auch durchsetzen kann. • Zivilverfahren: Dispositionsgrundsatz
2. ZIVILRECHTLICHES VERFAHREN
• Zuständigkeit
Amtsgericht/Bezirksgericht
Wertzuständigkeit
Eigenzuständigkeit
• Anwaltszwang
vor Amtsgericht/Bezirksgericht
Grenze 5.000 €
• Inhalt und Struktur der Klage
In ZPO geregelt: Deutschland § 253 dZPO in Verbindung
mit § 130 dZPO; Österreich in § 75 öZPO2. ZIVILRECHTLICHES VERFAHREN
• Mahnverfahren
in vielen europäischen Staaten, auch Deutschland und
Österreich
• Zusammenfassung
Sowohl in Österreich als auch in Deutschland ist die
Grenze für das selbständige Auftreten des Bürgers vor
Gericht sehr niedrig.
Der Zugang zum Recht wird also vor allem wegen des
Kostenrisikos erheblich erschwert.3. VERSTEHEN UND VERSTÄNDLICHKEIT • Verständlichkeit durch kontrollierte Sprache Kontrolle von Wortgebrauch und Grammatik durch Regeln keine langen Sätze einfache Zeitformen kein oder kaum Passiv Absätze umfassen maximal 6–7 Sätze. • Verstehen Wissen und Wissensrahmen
3. VERSTEHEN UND VERSTÄNDLICHKEIT
• Wissen und Verstehen im Recht
Untersuchungen zur Rechtssprache:
o Die bessere Gestaltung des Textes allein genügt nicht.
o Eine Reihe anderer Maßnahmen ist erforderlich. Nur dann werden die
besseren Texte auch von mehr Menschen verstanden werden.
o Der Bürger kann ein Rechtsproblem, das ihn betrifft, an Hand der
Rechtsordnung ohne juristische Vorkenntnisse nicht lösen.
• Unterscheidung von Verstehen und Verständlichkeit
(Christmann)
Die syntaktischen-stilistischen Oberflächenmerkmale von
Texten erlauben keine Vorhersagen darüber, ob ein Text
verstanden wird oder nicht.
Einbeziehung des Rezipienten
Verstehensprozess: Wechselwirkung zwischen
vorgegebenem Text und der Kognitionsstruktur des Lesers3. VERSTEHEN UND VERSTÄNDLICHKEIT
• Schlussfolgerungen
Der juristische Laie ist in aller Regel nicht in der Lage, die
Klageschrift selbständig korrekt zu formulieren.
Problem kann also durch kontrollierte Sprache nicht
befriedigend gelöst werden.
Es muss ein anderer Ansatz gesucht werden.4. TÄTIGKEITSLEITENDE TEXTE
• Merkmale der Tätigkeitsleitenden Texte (TLT)
Instruktionstexte: auf einzelne Arbeitsaufgaben bzw. auf
ein spezielles Gerät bezogen
Nicht auf das Aneignen komplexer Wissensgebiete
bezogen
Keine vollständige analytische Tätigkeitsbeschreibung
• Bedienungsanleitung für eine singuläre Aufgabe
Explizite Handlungsschrittanleitungen
Gebrauchsorientierte Darstellung4. TÄTIGKEITSLEITENDE TEXTE
• Logik in der sprachlichen Darstellung
Unterstützende graphische Gliederung
Sequenzierung anhand des Handlungsablaufs
• Didaktische Visualisierung
Erhöhung der Informativität durch die Verwendung
nonverbaler Informationsträger5. DAS EUROPÄISCHE MAHNVERFAHREN
• Allgemein
Das Europäische Mahnverfahren zeigt, dass sich TLT in
hervorragender Weise eignen, in einem eingeschränkten
Bereich Bürgern den Zugang zum Recht zu erleichtern.
• Europäische Kommission: Zugang zum Recht für alle
Im heutigen Europa mit offenen Grenzen ist es keineswegs
selten, dass sich Bürger mit Verfahren vor dem Gericht
eines anderen Mitgliedstaates konfrontieren müssen.
Kosten: Anwälte, Übersetzungen, Reisen
Eines der Mittel, den europäischen Bürgern den Zugang
zum Recht zu verschaffen, ist der europäische Zahlungs-
befehl.5. DAS EUROPÄISCHE MAHNVERFAHREN
• Europäischer Zahlungsbefehl
Ergeht im Falle grenzüberschreitender Geldforderungen,
die der Antragsgegner nicht bestreitet, in einem
vereinfachten Verfahren.
Für den Antrag werden Formblätter verwendet.
Für die Durchführung des Europäischen Mahnverfahrens
ist ein Gericht im Wohnsitzstaat des Klägers zuständig.
Formblätter: Europäisches Justizportal, Link im Internet.5. DAS EUROPÄISCHE MAHNVERFAHREN
• Anleitung zum Ausfüllen des Antrags auf Erlass eines
Europäischen Zahlungsbefehls
Tätigkeitsleitender Text
Mit Hilfe spezifischer Codes, die in die entsprechenden
Felder einzutragen sind, wird der Kläger in die Lage ver-
setzt, den Antrag auszufüllen, ohne juristische Kenntnisse
zu haben.
Im Gegensatz zu den Gesetzes- oder Lehrbuchtexten
enthält das Formular auch bildhaft gestaltete Elemente,
die das Verständnis erleichtern.
• Fiktiver Fall
Deutscher/österreichischer Kläger, der in Spanien klagen
will, und vice versa.6. HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN
• Allgemeine Hinweise
Sprache
o Formblatt ist in allen Amtssprachen der Europäischen Union
erhältlich
Einspruch
o Legt der Antragsgegner Einspruch gegen die Forderung ein, so wird
das Verfahren vor den zuständigen Gerichten gemäß den Regeln
eines ordentlichen Zivilprozesses weitergeführt. Wird dies nicht
gewünscht, ist Anlage 2 zum Formblatt zu unterschreiben.6. HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN • Leitlinien Bei jedem Abschnitt sind spezifische Codes aufgeführt, die gegebenenfalls in die entsprechenden Felder einzutragen sind. 1. Gericht. 2. Parteien und ihre Vertreter 3. Begründung der gerichtlichen Zuständigkeit 4. Grenzüberschreitende Bezüge der Rechtssache 5. Bankverbindung (fakultativ) 6. Hauptforderung 7. Zinsen 8. Vertragsstrafe (falls zutreffend) 9. Kosten (gegebenenfalls)
6. HINWEISE ZUM AUSFÜLLEN
• Leitlinien
10. Vorhandene Beweismittel, auf die sich die Forderung
stützt
11. Zusätzliche Erklärungen und weitere Angaben (falls
erforderlich)
Anlage 1: Kreditkarten- oder Bankkontoverbindung zur
Bezahlung der Gerichtsgebühren
Anlage 2: Erklärung für den Fall eines Einspruchs7. FALLBEISPIEL
• Parteien
Juan López Fernández, E-37710 Candelario, Plaza de Béjar 5
Josef Maier, D-35037 Marburg, Pilgrimstein 2
Johann Müller, A-3841 Windigsteig, Landstraße 24
• Beginn
https://e-
justice.europa.eu/content_european_payment_order_for
ms-156-de.do
Dynamische Formulare/ Formulare „Europäischer
Zahlungsbefehl“
Formular online ausfüllen/Cumplimentar formulario online
Sprachwahl: Deutsch/Spanisch7. FALLBEISPIEL • Wahl des Mitgliedsstaates
7. FALLBEISPIEL
7. FALLBEISPIEL
• Begründung der gerichtlichen Zuständigkeit
z. B. Wohnsitz des Beklagten, Erfüllungsort.
• Hauptforderung; z.B.
Kaufvertrag
ausgebliebene Zahlung
• Gericht
Link Eingabe der Adresse des Beklagten; System nennt
Gericht mit Adresse:
o Juzgado de Primera Instancia/Instrucción, C/ Cordel de Merinas,
4; 37700 Béjar
o Amtsgericht Berlin-Wedding, Brunnenplatz 1, D-13357 Berlin
o Bezirksgericht für Handelssachen Wien, Justizzentrum Wien Mitte
Marxergasse 1a, A-1030 Wien7. FALLBEISPIEL
• Senden
in Sprache des Gerichtes
• Ausdruck
Bitte wählen Sie die Sprache, in der Sie das PDF-Formular
erstellen möchten.8. VORTEILE UND GRENZEN
• Vorteile
Durch den TLT kann auch der Nichtjurist ohne Beratungs-
aufwand und kostensparend sein Recht geltend machen.
Voraussetzung sind natürlich organisatorische Maßnahmen
der Behörden, z.B. Schaffung eines eigenen Gerichts in
Österreich und Deutschland.8. VORTEILE UND GRENZEN
• Grenzen
Das System funktioniert natürlich nur für einfache
Rechtsfälle. Beispiele:
Es wurde eine Ware einwandfrei geliefert oder eine
Dienstleistung einwandfrei erbracht. Es gibt keine
Mängel, die gegebenenfalls durch Sachverständige zu
ermitteln wären. Ebenso wenig gibt es Gegen-
forderungen etc.
Es ist zu beachten, dass ein großer Teil der Rechts-
streitigkeiten in diese Kategorie fällt. Neben der
Erleichterung des Zugangs zum Recht führt dieses
System auch zur Entlastung der Gerichte.9. SCHLUSSFOLGERUNGEN • Zugang zum Recht: Bürger muss seine Rechte durch- setzen können. • Betragliche Grenze für das selbständige Auftreten des Bürgers vor Gericht ist sehr niedrig. Der Zugang zum Recht vor allem wegen des Kostenrisikos erheblich erschwert. • Das Problem kann durch kontrollierte Sprache nicht befriedigend gelöst werden. • Erfolgversprechender erscheint der Ansatz unter Ver- wendung Tätigkeitsleitender Texte, die an und für sich nicht für die Verwendung im Rechtssystem entwickelt wurden.
9. SCHLUSSFOLGERUNGEN • Am Beispiel des Europäischen Mahnverfahrens kann gezeigt werden, dass Tätigkeitsleitende Texte sich in hervorragender Weise eignen, in einem eingeschränkten Bereich Bürgern den Zugang zum Recht zu erleichtern. • Freilich sind der Anwendung Grenzen gesetzt, weil das System nur für einfache Rechtsfälle funktioniert. Jedoch fällt ein großer Teil der Rechtsstreitigkeiten in diese Kategorie.
10. LITERATUR Busse, Dietrich (2004): “Verstehen und Auslegung von Rechtstexten – institutionelle Bedingungen”. In: Lerch, Kent D. (2004): Die Sprache des Rechts, Band I, Recht verstehen – Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht. Berlin: Walter de Gruyter. 7–20. Christmann, Ursula (2004): “Verstehens- und Verständlichkeitsmessung; Methodische Ansätze in der Anwendungsforschung.” In: Lerch, Kent D. (2004): Die Sprache des Rechts, Band I, Recht verstehen – Verständlichkeit, Missverständlichkeit und Unverständlichkeit von Recht. Berlin: Walter de Gruyter. 33–62. Deixler-Hübner, Astrid / Klicka, Thomas (2011) . Zivilverfahren. 7., neu bearbeitete Auflage. Wien: LexisNexis. Liehr, Willibald (1986): “Verständliche Gesetzestexte – Ein Beitrag zur Bürgernähe der Verwaltung.“. In: Öhlinger, Theo (1986): Recht und Sprache, Fritz Schönherr – Gedächtnissymposium 1985. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien. 155–176.
10. LITERATUR Roth, Marianne / Holzhammer, Richard (2012), Zivilprozessrecht. 1. Auflage. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung. Stolze, Radegundis (2013): Fachübersetzen – Ein Lehrbuch für Theorie und Praxis. 3. Auflage. Berlin: Frank & Timme. Wodak, Ruth (1986): “Bürgernahe Gesetzestexte. Soziolinguistische Bemer- kungen zur Verständlichkeit von Gesetzestexten.“ In: Öhlinger, Theo (1986): Recht und Sprache, Fritz Schönherr – Gedächtnissymposium 1985. Wien: Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung Wien. 115–128. Ziem, Alexander (2008): Frames und sprachliches Wissen. Berlin: Walter de Gruyter.
Sie können auch lesen