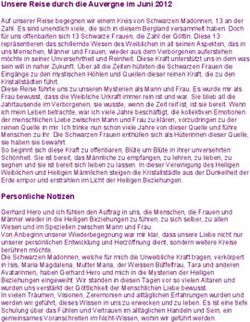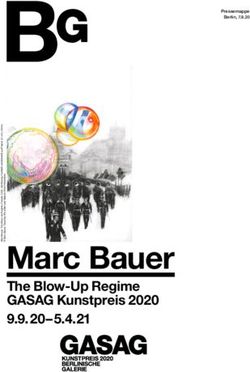Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge Gemeinnützige GmbH
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Evangelisches Krankenhaus
Königin Elisabeth Herzberge
Gemeinnützige GmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus
der Charité
Evangelisches Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge gGmbH – Herzbergstr. 79 – 10365 B Abteilung für Psychiatrie,
Psychotherapie und
Psychosomatik
Prof. Dr. Albert Diefenbacher, MBA
FA für Neurologie, Psychiatrie und
Psychotherapeutische Medizin,
Geriatrie
Telefon 5472 4801
Telefax 5472 2912
E-mail: e.heinrich@keh-Berlin.de
Berlin, den 15.06.09
Sitzung des Ausschusses für Gesundheit Umwelt Verbraucherschutz des
Abgeordnetenhauses von Berlin am Montag, 15.06.2009 – 12.00 Uhr
Abgeordnetenhaus von Berlin Niederkirchnerstr. 5, Bernhard-Letterhaus-Saal
Stellungnahme von Professor Dr. Albert Diefenbacher zum Tagesordnungspunkt Absatz
2a Besprechung gemäß § 21 Abs. 3 GO Abgeordnetenhausprobleme bei der
psychiatrischen Versorgung der Berliner Bevölkerung (Auf Antrag der Fraktion der CDU)
In Berlin hat das Psychiatrieentwicklungsprogramm (PEP) seit den 90er Jahren zu einer
positiven Entwicklung in der Versorgung psychisch kranker Menschen in Berlin geführt.
Die differenzierte psychiatrische Versorgungsstruktur im Land Berlin wird im 2. Abschnitt
„Bestandteile psychiatrischer Versorgung“ der Drucksache 16/1650 des
Abgeordnetenhauses Berlin überblicksartig zusammengefasst. Es handelt sich dabei um
eine Darstellung des psychiatrischen Hilfesystems „an sich“ welches überwiegend als
Stärke der Berliner psychiatrischen Versorgung betrachtet werden kann.
In meiner folgenden Stellungnahme werde ich dem gegenüber, zugespitzt formuliert, auf
die „psychiatrische Versorgung außerhalb des psychiatrischen Hilfesystems“ eingehen,
wobei Schnittstellen zum eigentlichen psychiatrischen Hilfesystem beleuchtet werden,
deren Optimierung insgesamt zu einer weiteren Verbesserung psychisch kranker
Menschen in Berlin beitragen könnte.
1. Psychiatrisch-psychotherapeutische Versorgung von Senioren
Der Anteil über 70-jähriger Patienten in den Allgemeinkrankenhäusern (Innere,
chirurgische Abteilungen etc.) ist hoch und wird auf Grund der demographischen
Entwicklung in den folgenden Jahren weiter zunehmen (Anteil über 70-jähriger
Patienten im KEH in 2008 über
30 %). Es handelt sich dabei um eine Patientengruppe, die häufig an mehreren
Krankheiten leidet, schwerer erkrankt ist und länger Krankenhausverweildauern
aufweist.-2-
Ein mit dem Alter zunehmender Anteil dieser Patienten leidet an einer Demenz,
welche einen Risikofaktor darstellt für die Entwicklung von (z. B. postoperativen)
akuten Verwirrtheitszuständen während der stationären Krankenhausbehandlung mit
einem Folgerisiko z.B. Stürzen und noch weiter verlängerten
Krankenhausliegedauern.
Es ist bei Ärzten und Pflegekräften auf den somatischen Stationen der
Allgemeinkrankenhäuser noch zu wenig bekannt, dass demenzkranke Patienten
zusätzlich akute Verwirrtheitszustände entwickeln können (Delir bei Demenz), so dass
diese Komplikation nicht ausreichend erkannt und entsprechend nicht hinreichend
behandelt wird. Ein bei einer Demenz auftretendes Delir (akuter Verwirrtheitszustand,
der durch vielfältige Ursachen bedingt sein kann, wie z. B. durch unerwünschte
Wirkungen von Medikamenten) ist eine so genannte psychiatrische Komorbidität bei
einer gleichzeitig vorliegenden körperlichen Grunderkrankung (somatopsychische
Komorbidität).
In den Vorschlägen für den Krankenhausplan Berlin 2010 bis 2015 hat die
Senatsverwaltung für Gesundheit diesem Umstand Rechnung getragen und die
Möglichkeit der Einrichtung neuer geriatrischer Abteilungen (vorrangig durch
Bettenumwidmungen) in Betracht gezogen. Die deutsche Alzheimer Gesellschaft hat
ebenfalls Aktivitäten zur Verbesserung der Situation von demenzkranken Menschen
auf den somatischen Abteilungen der Allgemeinkrankenhäuser entwickelt, wobei als
eine der Ursachen der unbefriedigenden Versorgung das mangelnde Wissen des
Krankenhauspersonals über aufgenommene Demenzkranke benannt wird. Um dieses
mangelnde Wissen zu verbessern wurde von der Deutschen Alzheimergesellschaft ein
„Informationsbogen für Patienten mit einer Demenz bei Aufnahme ins Krankenhaus“
entwickelt (www.deutsche-alzheimer.de/indes?id=37).
Aus (geronto-)psychiatrischer Sicht ist es als ausgesprochen problematisch zu
betrachten, wenn ältere Menschen auf Grund eines zu spät erkannten akuten
Verwirrtheitszustandes während der Behandlung einer körperlichen Grunderkrankung
auf einer internistischen oder chirurgischen Station dort als „nicht mehr führbar“
eingestuft werden und in Folge dessen auf eine (Geronto-)psychiatrische Abteilung
verlegt werden sollen. Da gerade demenzkranke Patienten auf Grund ihrer
eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten sehr empfindlich auf Ortswechsel reagieren,
wodurch sie noch zusätzlich verwirrter werden können, so kann dies im schlechtesten
Falle zu einem „Hin und Her“ zwischen psychiatrischer und z. B. internistischer
Station führen, wenn nämlich die psychiatrische Station wiederum nicht in der Lage
ist, eine gleichzeitig vorliegende körperliche Grunderkrankung adäquat zu behandeln.
Folgende Verbesserungsmöglichkeiten für diesen nicht günstigen Zustand sollten ins
Auge gefasst werden:
- die Neueinrichtung geriatrischer Angebote sollte bevorzugt an solchen
Krankenhäusern stattfinden, die bereits über (geronto-)psychiatrische
Abteilungen verfügen;
- geriatrische Solitärstandorte sollten angeregt werden, einen
psychiatrischen Liaisondienst (hierzu vgl. Punkt 2 weiter unten)
vorzuhalten.
Grundsätzlich sollte dafür Sorge getragen werden, dass auf Grund der
demographischen Entwicklung die Allgemeinkrankenhäuser sich im Sinne von
„demenzfreundlichen Krankenhäusern“ entwickeln. Entsprechende Initiativen im
Rahmen von Modellprojekten klingen viel versprechend (vergleiche das Projekt
Blickwechsel, Demenz als Nebendiagnose im Allgemeinkrankenhaus
(www.sozialeprojekte.de).
A. Diefenbacher Seite 2 von 8-3-
Schnittstellen im stationär-ambulanten Bereich sind gerade bei dieser Klientel zu
optimieren, wobei eine kompetente Haus- und nervenärztliche Versorgung von in
Seniorenheimen lebenden Menschen von zentraler Bedeutung erscheint, um
Krankenhauseinweisungen bei dieser sensiblen Klientel wenn möglich überhaupt zu
vermeiden. Die Entwicklung von Verbundsystemen, wie dies z. B. im Bezirk
Lichtenberg durch den im Jahre 2000 gegründeten Geriatrisch-
Gerontopsychiatrischen Verbund (GGV) geschehen ist, sind hierbei hilfreich
(Diefenbacher & Gaebel 2008).
2. Konsiliar-Liaisonpsychiatrie im Allgemeinkrankenhaus
Was in Punkt 1) am Beispiel von demenzkranken Patienten, die z. B. wegen einer
Oberschenkelhalsfraktur in einer chirurgischen Abteilung aufgenommen worden sind,
dargestellt wurde, nämlich ihre erhöhte Empfindlichkeit, eine psychiatrische
Komorbidität, in diesem Falle einen akuten Verwirrtheitszustand zusätzlich zu ihrer
körperlichen Grunderkrankung zu entwickeln (Delir bei Demenz) gilt generell für
mindestens 20 % aller wegen einer akuten körperlichen Grunderkrankung im
Allgemeinkrankenhaus behandelten Patienten: sie entwickeln zusätzlich zu dieser
körperlichen Grunderkrankung eine psychische Erkrankung, die auch in ca. 10 % der
Fälle nach Expertenschätzungen gleichzeitig mit der körperlichen Grunderkrankung
behandelt werden sollte, um kompliziertere und längere Behandlungsverläufe im
Allgemeinkrankenhaus zu vermeiden.
Die drei hier am häufigsten zu nennenden Komorbiditäten mit psychiatrischen
Erkrankungen sind die so genannten
- hirnorganischen Psychosyndrome (Demenz, Delir bei Demenz),
- Alkoholkrankheit und
- depressive und Angsterkrankungen bzw. Anpassungsstörungen.
Eine Verlegung der überwiegenden Mehrzahl dieser Patienten in psychiatrische
Abteilungen ist nicht nur auf Grund der beschränkten Kapazitäten der letzteren nicht
möglich, sondern auch deswegen nicht sinnvoll, da ja körperliche Erkrankungen die
Einweisung auf einer internistischen oder chirurgischen Station erforderlich gemacht
hat. Daher werden diese Patienten von psychiatrischen Konsiliar- Liaisondiensten auf
diesen Stationen mitbehandelt.
Das Konsiliarmodell bedeutet dabei, dass ein Patient üblicherweise ein oder zwei Mal
vom Psychiater gesehen wird, und die Behandlung vom internistischen oder
chirurgischen Stationsarzt durchgeführt wird. Bei komplexeren Problemen wie sie z.
B. in der Onkologie oder bei der Behandlung von chronischen Schmerzpatienten
erforderlich sind, ist häufiger ein höherer Zeitaufwand für die Behandlung
erforderlich, so dass der Psychiater (oder auch auf vielen onkologischen Stationen
bereits eingeführt, ein Psychologe) intensiver und zeitaufwendiger in eine
gemeinsame Behandlungsstrategie integriert ist.
Empirische Untersuchungen weisen darauf hin, dass bis zu 2/3 der Patienten, die im
Allgemeinkrankenhaus einem psychiatrischen Konsiliar- zugewiesen werden, bis
dahin noch nicht in fachspezifischer psychiatrisch-psychotherapeutischer Behandlung
sich befunden haben, was je nach dem zu einer Chronifizierung von
Krankheitsverläufen und zur Entstehung von unnötigen Kosten geführt hat, wie dies
z. B. bei Patienten der Fall ist, die wegen Herzbeschwerden im Rahmen von
Panikattacken viele Jahre lang zunächst in Notaufnahmen immer wieder beruhigt
werden, dass kein Herzinfarkt vorläge, und somit erst viel zu spät in eine effiziente
psychiatrisch-psychotherapeutische Behandlung ihrer psychiatrischen Erkrankung,
nämlich der Panikatacken, gelangen.
A. Diefenbacher Seite 3 von 8-4-
Entgegen der genannten Expertenschätzung (vgl. weiter oben) werden tatsächlich
weltweit im Durchschnitt nur 1 bis 2% der Patienten eines Allgemeinkrankenhauses
an einen Konsiliarpsychiater überwiesen.
Die internationale Forschung geht davon aus, dass die Integration von
psychiatrischen Konsiliar-Liaisondiensten in die Allgemeinkrankenhäuser zu einer
Verbesserung der Versorgung der Patienten mit somato-psychischer Komorbidität
führt.
Hierbei wird seit vielen Jahren insbesondere gefordert:
- Optimierung von Entdeckung und Behandlung von akuten
Verwirrtheitszuständen (z. B. postoperativen Delirien,
"Durchgangssyndromen“), sowie
- besondere Angebote in Form von „Alkohol-Liaisondiensten“, da sich
mittlerweile durch mehrere Studien (mit hohen Evidenzgrad,
Evidenzlevel I) belegen lässt, dass so genannte motivationale
Frühinterventionen insbesondere riskanten Alkoholkonsum reduzieren
helfen: bei Patienten, die wegen einer körperlichen Erkrankung, die
im Zusammenhang mit riskantem Alkoholgenuss steht (Unfälle,
gasteroenterologische Probleme), findet eine entsprechende
Frühintervention einen fruchtbaren Boden.
Im Rahmen der Entwicklung des Berliner psychiatrischen Versorgungssystems ist, auf
Grund der Bezirksgebundenheit, auch davon die Rede, dass ein Bezirk einem
Versorgungssektor entspreche, für den, auf Grund der zu erwartenden Häufigkeit an
psychiatrischen Erkrankungen, ein bestimmter Umfang an entsprechenden Hilfen zur
Verfügung gestellt werden muss.
Auf Grund der beschriebenen hohen psychiatrischen Komorbidität von körperlich
kranken Patienten im Allgemeinkrankenhaus, die sich gewissermaßen dort auf
kleinstem Raum verdichtet, sollte, in Anlehnung an entsprechende Überlegungen in
Großbritannien, das Allgemeinkrankenhaus durchaus als „virtueller psychiatrischer
Sektor“ betrachtet werden, für dessen adäquate Versorgung die Vorhaltung von
psychiatrischen Konsiliar-Liaison-Diensten bzw. die Zusammenarbeit mit derartigen
externen Diensten, so sie nicht vorgehalten werden können, im Sinne eines
Qualitätsindikators für eine adäquate Patientenversorgung zu fordern sind
(Diefenbacher et al 2008).
3. Psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung
Häufig werden psychiatrische, aber auch somatische Krankheiten bei Menschen mit
geistiger Behinderung, insbesondere bei denjenigen, die sich nicht ausreichend
körperlich verständigen können, nicht erkannt und Verhaltensauffälligkeiten
fälschlicherweise der geistigen Behinderung „an sich“ zugeschrieben.
Die Berliner Situation ist hier einerseits, spätestens seit der Einrichtung des
Behandlungszentrums für psychisch kranke Menschen mit geistiger Behinderung
(Erwachsene) an der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
des ev. Krankenhauses Königin Elisabeth Herzberge mit nunmehr ergänzender
Spezialambulanz (seit 2005) auf dem richtigen Weg.
Andererseits zeigt sich gerade bei dieser Klientel, die auf Grund der mangelnden
sprachlichen Verständigungsmöglichkeit auf Informationsbeschaffung über
Familienangehörige, Betreuer u. a. m. angewiesen ist, dass die ambulante
Versorgung durch Nerven- oder Hausärzte, so engagiert diese auch vorgenommen
wird, auf Grund des hohen Zeitaufwandes durch die zur Verfügung stehenden
Budgets nicht gedeckt ist.
A. Diefenbacher Seite 4 von 8-5-
Des weiteren gilt auch hier, dass ein wesentlicher Anteil der Verhaltensauffälligkeiten,
die zu einer Einweisung in eine psychiatrische Abteilung führen, letztlich eine
körperliche Ursache hat und somit einer internistisch- oder chirurgischen Behandlung
zugeführt werden muss (Anteil der Patienten mit einer signifikanten körperlichen
Diagnose als Ursache für Verhaltensauffälligkeiten in unserem Behandlungszentrum
in 2008: 15 %) (Voß et al 2005).
4. Notaufnahme und/oder Rettungsstelle im Allgemeinkrankenhaus – weitere
Schnittstelle zu psychiatrischen Versorgungssystemen.
Die Rettungsstellen bzw. Notaufnahmen der Allgemeinkrankenhäuser sind häufig
erste Anlaufstellen für Menschen mit psychischen Problemen, die sich in ihrer Not
nicht anders helfen zu wissen und für die unter Umständen die Wartezeiten auf einen
Termin in der Praxis eines Hausarztes oder Nervenarztes zu lange sind. Gleichfalls ist
es möglich, dass Angesichts der nach wie vor bestehenden Stigmatisierung von
psychischen Erkrankungen eine Notaufnahme oder Rettungsstelle einen „neutraleren
Ort“ darstellt, wo Patienten zunächst ihre Beschwerden vorbringen wollen, um zu
vermeiden, als „verrückt“ abgestempelt zu werden.
Gerade wenn körperliche Symptome im Vordergrund bei einer psychischen
Erkrankung stehen (z. B. Panikattacken bei Angsterkrankungen, oder Müdigkeit,
Schwächegefühle und Kopfschmerzen bei einer Depression, oder vielfältige, eher
diffuse körperliche Beschwerden bei einer somatoformen Störung) wird ohnehin
zunächst der Kontakt nicht zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten, sondern zu
einem „körpermedinischen“ Arzt gesucht. Im Folgenden sollen drei Aspekte dieser
Schnittstelle diskutiert werden:
- Migranten: gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund kann es sein, dass
psychische Störungen oder auch die Institution
„Psychiatrie“ mit einem erheblichen Stigma verbunden sind. Die
Begründungen können sehr vielfältig sein: häufig trifft man auf die
Angst, für „verrückt erklärt“ zu werden, da in Abhängigkeit von
Bildungsgrad und Ursprungskultur psychische Störungen mit
schweren Psychosen gleichgesetzt werden. Die Folgen reichen von
Schamgefühlen bis zur Angst vor Ausgrenzung und Entwertung
nicht nur der eigenen Person, sondern auch der ganzen Familie.
Aber auch die Befürchtung, „weggesperrt“ und entrechtet zu
werden, wie es in Ländern totalitärer Regime passieren kann, ruft
unter Umständen ein tiefes Misstrauen gegenüber psychiatrischen
Behandlungsangeboten hervor. Was weiter oben allgemein für die
Rolle des Allgemeinkrankenhauses gesagt wurde, gilt hier erst
recht für Notaufnahme oder Rettungsstellen: sie stellen einen
„Filter“ dar, wo Menschen mit zunächst unerkannten psychischen
Erkrankungen über die Kontaktaufnahme mit einer „somatischen
Behandlungseinheit“ als psychiatrisch-psychotherapeutisch
hilfebedürftig erkannt werden können und in der folge an
fachspezifische Dienst weiter vermittelt werden sollten.
Dies heißt, dass gerade in Notaufnahme und Rettungsstellen die
unter Punkt 2 bereits erwähnten Konsiliar-Liaisondienste integriert
sein sollten. (Burian und Diefenbacher, im Druck.)
- Auch die Beschäftigung mit der psychischen Gesundheit von Frauen hat in den
letzten Jahren zugenommen, angeregt auch durch vom Berliner Senat initiierte
Hearings. Hier ist es in den letzten Jahren auch zur Einrichtung so genannter
geschützter Frauenbereiche bzw. frauenspezifischer Therapieangebote in einzelnen
psychiatrischen Abteilungen gekommen. An dieser Stelle sei allerdings auf einen,
möglicherweise noch nicht ausreichend ins Bewusstsein gedrungenen Aspekt
A. Diefenbacher Seite 5 von 8-6-
hingewiesen, nämlich der Möglichkeit, Frauen die Opfer häuslicher Gewalt geworden
sind und sich auf Grund körperlicher Verletzungen primär in Notaufnahmen/
Rettungsstellen vorzustellen, spezifische Unterstützung anzubieten. Dies hat
zunächst nichts mit der Aufnahme einer fachspezifischen psychiatrisch-
psychotherapeutischen Behandlung zu tun, kann aber mittelbar, nachdem
überhaupt erst einmal die Möglichkeit der Identifikation einer solchen Problematik
und der Vermittlung von basalen Hilfeangeboten (z.B. Adressen von Frauenhäusern)
geleistet worden ist, anschließend erfolgen. Ein wichtiges Projekt in Berlin stellen
hier die Initiativen von S.I.G.N.A.L dar, wo versucht wird, den in den
Notaufnahmen/Rettungsstellen tätigen Ärzten und Pflegekräften Grundkenntnisse im
Umgang mit traumatisierten Frauen zu vermitteln.
- Schließlich sei darauf hingewiesen, dass die Abnahme der Versorgungsdichte
mit Psychiatern und/oder Nervenärzten in einigen östlichen Berliner
Bezirken, z.B. Marzahn-Hellersdorf und Lichtenberg, dazu führen könnte, dass
Menschen wegen psychischer Probleme eine Notaufnahme aufsuchen, weil die
Wartezeiten für einen Termin bei einem niedergelassenen Arzt zu lang geworden
sind. Hierbei handelt es sich aber nicht im eigentlichen Sinne um Notfallpatienten.
Eine Stabilisierung der nervenärztlich-psychiatrischen Versorgung in betroffenen
Bezirken wäre hilfreich, um eine Fehlallokation von Ressourcen zu vermeiden.
Zwar verfügen die psychiatrischen Abteilungen in den entsprechenden Bezirken auch
über psychiatrische Institutsambulanzen. Hier wird allerdings von den Krankenkassen
sehr deutlich darauf hingewiesen, dass eine PIA nur für schwerkranke psychiatrische
Patienten, die einer komplexen Behandlung bedürfen, zur Verfügung steht, und
keinesfalls als Ersatz für eine nervenärztliche Praxis gebraucht werden dürfte.
5. Gemeindepsychiatrische Verbünde und Zusammenarbeit mit Bezirksämtern
– weitere Vernetzungsmöglichkeiten in den Bezirken.
Die Wichtigkeit von Verbundsystemen bei der Optimierung von
Schnittstellenproblematiken wurde am Beispiel des geriatrisch-gerontopsychiatrischen
Verbunds (GGV) Lichtenberg bereits unter Punkt 1) erwähnt.
Auch für die allgemeinpsychiatrischen Versorgung haben sich in den letzten Jahren in
den Berliner Bezirken Verbünde entwickelt, die als so genannte
„Gemeindepsychiatrische Verbünde“ (GPV) für eine Verbesserung der Koordinierung
der vorhandenen differenzierten Angebote Sorge tragen (in der Anlage findet sich als
Beispiel eine Übersicht der Gremien der psychosozialen Versorgung in Lichtenberg).
Aus solchen Zusammenschlüssen können sich weitere Initiativen ergeben, die
ebenfalls zu einer Verbesserung von Zusammenarbeit führen. So hat sich ein im
letzten Jahr begonnenes Projekt, das gemeinsam vom Bezirksamt Lichtenberg, dem
GPV und der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des KEH
veranstaltet wurde, als sehr hilfreich sowohl mit Blick auf Entstigmatisierung, aber
auch konkret unter dem Aspekt des Abbaus bürokratischer Hürden: in 11
Veranstaltungen, veranstaltet von der VHS Lichtenberg, wurden in Vorträgen, die
gemeinsam von Ärzten der psychiatrischen Abteilung des KEH und Vertretern der
komplementären psychiatrischen Angebote im Bezirk Lichtenberg bestritten wurden,
ca. 50 Fallmanager der Jobcenter u.a. darin geschult, auf psychiatrische
Erkrankungen hinweisende Warnzeichen bei ihren Klienten wahrzunehmen. Dies hat
unter anderem zu einem verbesserten Verständnis und beschleunigter
Zusammenarbeit zwischen Sozialarbeitern des Krankenhauses bzw. den Jobcentern in
der Betreuung von psychisch kranken Arbeitslosen geführt.
A. Diefenbacher Seite 6 von 8-7- Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der psychiatrisch- psychotherapeutischen Versorgung im Land Berlin „im engeren Sinne“ viele Stärken aufweist. Im Bereich der Schnittstellen von stationären und ambulanten, bzw. psychiatrischen und somatischen Versorgungsstrukturen zeigt sich allerdings Optimierungsbedarf. Gerade die nicht hinreichend erkannte und damit zu wenig einer spezifischen Therapie zugeführte psychiatrische Komorbidität bei Patienten mit Demenz und Alkoholkrankheit, die wegen körperlicher Erkrankungen auf den internistischen und chirurgischen Stationen der Allgemeinkrankenhäuser behandelt werden, also die „Psychiatrie außerhalb der Psychiatrie“ kann dabei als verbesserungsfähig eingeschätzt werden. Professor Dr. Albert Diefenbacher MBA A. Diefenbacher Seite 7 von 8
-8- Literatur 1. Burian R, Diefenbacher A: Konsiliarpsychiatrie. In Machleidt W, Heinz A (Hrsg.) Praxis der interkulturellen Psychiatrie und Psychotherapie – Migration und psychische Gesundheit. Elsevier Urban & Fischer Verlag, München, in Druck 2. Diefenbacher A: Wenn körperlich Kranke psychisch gestört sind. Berliner Ärzte 9/2008: S. 26-27 3. Diefenbacher A, Burian R, Klesse C, Härter M (2009): Konsiliar- und Liaisondienste für psychische Störungen. In: Berger M (Hrsg.) Psychische Erkrankungen Klinik und Therapie, 3. Auflage, Urban- & Fischer Verlag, S. 1026-1050 4. Voß T, Böhm M, Diefenbacher A: Psychische Erkrankungen bei Intelligenzminderung oft unzureichend diagnostiziert. Berliner Ärzte, 11/2005: S. 24-25 A. Diefenbacher Seite 8 von 8
Sie können auch lesen