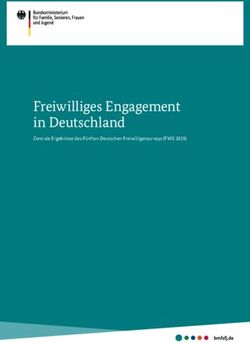Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden - BAG
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gesundheit von
Sozialhilfebeziehenden
Analysen zu Gesundheitszustand, -verhalten, -leistungsinanspruchnahme und
Erwerbsreintegration
Schlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit
Bern und Winterthur, Juli 2021
Berner Fachhochschule
Departement Soziale Arbeit
Hallerstrasse 8
CH-3012 Bern
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
Gertrudstrasse 15
CH-8401 WinterthurSchlussbericht zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit, Direktionsbereich Gesund-
heitspolitik, Sektion Gesundheitliche Chancengleichheit.
Begleitgruppe: Sabina Hösli (BAG), Karin Gasser (BAG), Markus Kaufmann (SKOS),
Corinne Hutmacher-Perret (SKOS), Phillip Dubach (BSV), Luzius von Gunten (BFS),
Robin Rieser (FMH), Cordula Ruf-Sieber (Paraplegiker-Zentrum Nottwil)
Bericht zitieren als:
Dorian Kessler, Marc Höglinger, Sarah Heiniger, Jodok Läser und Oliver Hümbelin
(2021). Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden – Analysen zu Gesundheitszustand, -
Verhalten, -Leistungsinanspruchnahme und Erwerbsreintegration. Schlussbericht zu-
handen Bundesamt für Gesundheit. Bern/Winterthur: Berner Fachhochschule und Zür-
cher Hochschule für angewandte Wissenschaften.
Kontakt:
Dorian Kessler
Berner Fachhochschule
Departement Soziale Arbeit
Hallerstrasse 8 CH-3012 Bern
Tel: +41 31 848 36 97
E-Mail: dorian.kessler@bfh.ch
Marc Höglinger
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Winterthurer Institut für Gesundheitsökonomie
Gertrudstrasse 15
CH-8401 Winterthur
Tel. +41 58 934 49 80
E-Mail: marc.hoeglinger@zhaw.ch
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
2Inhaltsverzeichnis
1. Zusammenfassung 7
1.1 Gesundheitsprofil 7
1.2 Gesundheitsverlauf 8
1.3 Gesundheitsleistungen 8
1.4 Erwerbsreintegration 8
1.5 Schlussfolgerungen für Politik und Praxis 9
2 Einleitung 10
2.1 Ausgangslage 10
2.2 Fragestellungen 10
2.3 Struktur des Berichtes 11
3 Forschungsstand: Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden 11
3.1 Gesundheitszustand 11
3.2 Gesundheitsversorgung 13
3.3 Erwerbstätigkeit 14
4 Methodik 14
4.1 Datenbasis 14
4.2 Grundgesamtheit und Stichproben 16
4.3 Gewichtung zur Reduktion von Non-response Bias 18
4.4 Operationalisierung 21
4.4.1 Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten ........................................................ 21
4.4.2 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ........................................................... 25
4.4.3 Erwerbsreintegration..................................................................................................... 26
4.4.4 Sozialhilfebezug ............................................................................................................ 26
4.4.5 Vergleichsgruppen ........................................................................................................ 27
4.4.6 Subgruppen ................................................................................................................... 29
4.4.7 Erschöpfen der ALV-Taggelder («Aussteuerung») ...................................................... 30
4.5 Analysestrategie 30
4.5.1 Gesundheitsprofil .......................................................................................................... 30
4.5.2 Gesundheitsverlauf ....................................................................................................... 31
4.5.3 Gesundheitsleistungen ................................................................................................. 32
4.5.4 Erwerbsreintegration..................................................................................................... 32
5 Resultate 33
5.1 Gesundheitsprofil 33
5.1.1 Allgemeiner Gesundheitszustand ................................................................................ 33
5.1.2 Diskussion ..................................................................................................................... 38
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
35.1.3 Gesundheitsverhalten ................................................................................................... 39
5.1.4 Diskussion ..................................................................................................................... 41
5.2 Gesundheitsverlauf 42
5.2.1 Eintritt in die Sozialhilfe ............................................................................................... 42
5.2.2 Übergang Aussteuerung vor Sozialhilfe ...................................................................... 44
5.2.3 Gesundheitsverlauf während Bezugsperioden ............................................................ 46
5.2.4 Übergangsanalyse Austritt ........................................................................................... 47
5.2.5 Diskussion ..................................................................................................................... 50
5.3 Gesundheitsleistungen 51
5.3.1 Generalistinnen-/Generalisten- und Spezialistinnen-/Spezialistenbesuche ............. 51
5.3.2 Inanspruchnahme Gesundheitsleistungen .................................................................. 52
5.3.3 Nichtinanspruchnahme medizinische Untersuchungen und Zahnarzt ..................... 54
5.3.4 Diskussion ..................................................................................................................... 56
5.4 Erwerbsreintegration 57
5.4.1 Verlaufsanalyse ............................................................................................................. 57
5.4.2 Gesundheitszustand nicht-erwerbstätige Sozialhilfebeziehende .............................. 62
5.4.3 Diskussion ..................................................................................................................... 65
6 Schlussfolgerungen 66
6.1 Interpretation der Ergebnisse 66
6.2 Limitationen und weitere Forschung 67
6.3 Implikationen für Politik und Praxis 68
7 Literaturverzeichnis 69
8 Anhang 72
8.1 Aussteuerung 72
8.2 Dauer Bezugsperioden 72
8.3 Übersicht zu den Indikatoren 74
8.3.1 Allgemeiner Gesundheitszustand ................................................................................ 74
8.3.2 Wohlbefinden und psychische Gesundheit ................................................................. 74
8.3.3 Nichtübertragbare Krankheiten und Multimorbidität ................................................. 75
8.3.4 Gesundheitsverhalten ................................................................................................... 78
8.3.5 Medikamenteneinnahme und Suchtmittelkonsum ..................................................... 79
8.3.6 Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen ........................................................... 80
8.3.7 Nichtinanspruchnahme medizinischer Leistungen..................................................... 82
8.4 Gesundheitsprofil 84
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
4Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Überblick über Beobachtungszeitraum und Erhebungsfrequenz der verwendeten
Datenquellen ........................................................................................................................................ 15
Abbildung 2: Allgemeiner Gesundheitszustand ................................................................................ 34
Abbildung 3: Wohlbefinden und psychische Gesundheit ................................................................. 35
Abbildung 4: Chronische Krankheiten (NCDs) und Multimorbidität ................................................ 37
Abbildung 5: Starke Gesundheitsbeschwerden in den letzten 4 Wochen ....................................... 38
Abbildung 6: Gesundheitsverhalten ................................................................................................... 40
Abbildung 7: Medikamenteneinnahme und Suchtmittelkonsum ..................................................... 41
Abbildung 8: Gesundheitsverlauf Eintritt Sozialhilfe ........................................................................ 43
Abbildung 9: Gesundheitsverlauf Aussteuerung vor Sozialhilfebezug ............................................ 45
Abbildung 10: Gesundheitsverlauf Eintritt, Langzeitbeziehende ..................................................... 47
Abbildung 11: Gesundheitsverlauf Austritt aus Sozialhilfe .............................................................. 47
Abbildung 12: Gesundheitsverlauf Austritt Sozialhilfe, Langzeitbeziehende ................................. 50
Abbildung 13: Generalistinnen-/Generalisten- und Spezialistinnen-/Spezialistenbesuche ........... 52
Abbildung 14: Inanspruchnahme Gesundheitsleistungen ................................................................ 54
Abbildung 15: Nichtinanspruchnahme medizinische Untersuchung und Zahnarzt ....................... 56
Abbildung 16: Erwerb nach Beginn Sozialhilfebezug ....................................................................... 59
Abbildung 17: Erwerb über CHF 3000/Monat nach Beginn Sozialhilfebezug ................................. 61
Abbildung 18: Allgemeiner Gesundheitszustand erwerbstätige und nicht-erwerbstätige
Sozialhilfebeziehende .......................................................................................................................... 63
Abbildung 19 Wohlbefinden und psychische Gesundheit erwerbstätige und nicht-erwerbstätige
Sozialhilfebeziehende .......................................................................................................................... 64
Abbildung 20 Chronische Krankheiten (NCD) und Multimorbidität erwerbstätige und nicht-
erwerbstätige Sozialhilfebeziehende .................................................................................................. 65
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
5Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Eigenschaften der verwendeten Datenquellen ................................................................. 15
Tabelle 2 : Fallzahlen Sozialhilfe und Bezugsquoten in der Gesamtpopulation (Bevölkerungs-
/Sozialhilfestatistik) und gemäss Umfragedaten (SAKE/SESAM, SILC, SGB) .................................... 17
Tabelle 3: Vergleich Eigenschaften Sozialhilfebeziehende Gesamtpopulationen 2017/2018 versus
Befragungsteilnehmer/-innen SAKE, SILC und SGB, vor und nach Gewichtung .............................. 19
Tabelle 4: Überblick der Indikatoren zum Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten. Alles
dichotome Indikatoren (Ja/Nein)......................................................................................................... 21
Tabelle 5: Übersicht zu den sechs NCD-Gruppen und deren Berücksichtigung in der SGB (2012,
2017) ..................................................................................................................................................... 24
Tabelle 6: Überblick der Indikatoren zu Inanspruchnahme bzw. Nicht-Inanspruchnahme von
Gesundheitsleistungen. Alles dichotome Indikatoren (ja/nein), ausser bei Anzahl Generalistinnen-
/Generalisten- und Spezialistinnen-/Spezialistenbesuche. ............................................................... 26
Tabelle 7: Eigenschaften Sozialhilfebeziehende und Vergleichsgruppen ....................................... 28
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
61. Zusammenfassung
Eine Reihe von internationalen Studien hat aufgezeigt, dass Personen, die für ihre Existenzsiche-
rung auf Leistungen von Sozialhilfeprogrammen angewiesen sind, überdurchschnittlich häufig ge-
sundheitliche Beeinträchtigungen aufweisen. Dieses Phänomen ist in der Schweizer Sozialhilfepra-
xis ebenfalls bekannt (Reich et al., 2015). Für eine evidenzbasierte Entwicklung geeigneter Kompe-
tenzen und Angebote in Sozialdiensten besteht bisher jedoch eine beschränkte Faktenlage. Vor-
handene Studien bestätigen das Bild einer schlechteren Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden für
einzelne städtische Sozialdienste, erlauben jedoch keine verlässlichen Aussagen zur gesamt-
schweizerischen Situation. Bisher fehlen zudem Vergleiche mit anderen Gruppen in besonderen
sozioökonomischen Lagen und Erkenntnisse zur Entwicklung des Gesundheitszustandes von So-
zialhilfebeziehenden im Verlauf von Bezugsperioden. Ebenfalls unklar ist die Angemessenheit der
Gesundheitsversorgung von Sozialhilfebeziehenden und der Zusammenhang zwischen der ge-
sundheitlichen Situation von Sozialhilfebeziehenden und ihrer Erwerbsreintegration.
Die vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) in Auftrag gegebene Studie «Gesundheit von Sozialhil-
febeziehenden» hat zum Ziel, Wissen zum Gesundheitszustand, zur Gesundheitsversorgung und
zur Bedeutung der Gesundheit für die Erwerbsreintegration von Sozialhilfebeziehenden zu erar-
beiten. Sie stützt sich dafür auf eine einzigartige Datenbasis: eine Verknüpfung längsschnittlicher
Gesamtbevölkerungsdaten aus der Sozialhilfeempfängerstatistik, den Individualkonten der AHV
und dem IV-Rentenregister mit Befragungsdaten der Schweizerischen Gesundheitsbefragung, der
Erhebung zu den Einkommen und Lebensbedingungen und der Schweizerischen Arbeitskräfteer-
hebung. Es stehen dadurch – je nach Indikator – bis zu einer halben Million Beobachtungen über
den Zeitraum von 2007 bis 2018 zur Verfügung. Auf dieser Basis werden vier Fragestellungen
beantwortet:
- Im Modul «Gesundheitsprofil» fragen wir, wie sich der Gesundheitszustand und das Ge-
sundheitsverhalten von Sozialhilfebeziehenden von demjenigen von IV-Rentenbeziehen-
den, Personen in prekären finanziellen Verhältnissen ohne Bezug von Sozialhilfe oder einer
IV-Rente sowie der Restbevölkerung unterscheidet. Dabei betrachten wir auch, inwiefern
sich allenfalls besonders akzentuierte Unterschiede für bestimmte Subgruppen zeigen (u.a.
Junge, Frauen, Stadtbevölkerung).
- Im Modul «Gesundheitsverlauf» fragen wir, ob sich der Gesundheitszustand von Sozialhil-
febeziehenden bei relevanten Übergängen (Aussteuerung, Ein- und Austritt aus der Sozial-
hilfe) und im Verlauf von Sozialhilfebezugsperioden verändert.
- Im Modul «Gesundheitsleistungen» fragen wir, wie häufig Sozialhilfebeziehende Gesund-
heitsleistungen beanspruchen und inwiefern es Hinweise für eine Fehl- oder Unterversor-
gung gibt.
- Im Modul «Erwerbsreintegration» fragen wir, wie sich der Gesundheitszustand auf die Er-
werbstätigkeit von Sozialhilfebeziehenden auswirkt. Wir zeigen, inwiefern gesundheitliche
Beeinträchtigungen eine Erwerbsaufnahme erschweren, in welchem Umfang nicht-erwerbs-
tätige Sozialhilfebeziehende an gesundheitlichen Beschwerden leiden und welche Arten
von Beschwerden und Erkrankungen bei dieser Gruppe besonders häufig auftreten.
Folgende zentrale Erkenntnisse konnten aus den Analysen gewonnen werden:
1.1 Gesundheitsprofil
Sozialhilfebeziehende verfügen über einen deutlich schlechteren Gesundheitszustand als die Rest-
bevölkerung und auch als Personen in prekären finanziellen Verhältnissen. Sowohl hinsichtlich der
subjektiven Gesundheitseinschätzung als auch bei «objektiven» Indikatoren wie chronischen
Krankheiten oder Multimorbidität zeigt sich klar ein schlechterer Gesundheitszustand der Sozial-
hilfebeziehenden. Am ausgeprägtesten sind die Unterschiede bei der Lebenszufriedenheit/Lebens-
qualität, der psychischen Belastung und bei Depressionssymptomen. Von überdurchschnittlich
häufigen Depressionssymptomen sind Sozialhilfebeziehende aller Altersgruppen betroffen, wäh-
rend andere Erkrankungen und Beschwerden insbesondere bei älteren Sozialhilfebeziehenden häu-
figer als in der Restbevölkerung vorkommen. Symptomatisch zeigt sich der schlechtere Gesund-
heitszustand vor allem darin, dass Sozialhilfebeziehende viel häufiger unter starken Schmerzen
irgendwelcher Art als die Restbevölkerung und als Personen in prekären finanziellen Verhältnissen
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
7leiden. Es zeigt sich auch eine erhöhte Medikamenteneinnahme (Schlaf-, Beruhigungs- und
Schmerzmittel), welche weitgehend Ausdruck des schlechteren Gesundheitszustandes sein dürfte.
Insgesamt weisen Sozialhilfebeziehende bezüglich der betrachteten Indikatoren eine nur gering-
fügig weniger belastete Situation als IV-Rentenbeziehende auf.
Sozialhilfebeziehende zeigen auch ein deutlich schlechteres beziehungsweise risikoreicheres Ge-
sundheitsverhalten als die Restbevölkerung. Sowohl beim Ernährungs- und Bewegungsverhalten
als auch beim täglichen Rauchen zeigen sich relativ deutliche Unterschiede zwischen Sozialhilfe-
beziehenden und der Restbevölkerung. Auch hier akzentuieren sich die Unterschiede mit zuneh-
mendem Alter. Cannabiskonsum ist bei Sozialhilfebeziehenden etwa doppelt so verbreitet wie bei
der Restbevölkerung. Für risikoreichen Alkoholkonsum zeigen sich dagegen keine Unterschiede.
1.2 Gesundheitsverlauf
Der schlechtere Gesundheitszustand von Sozialhilfebeziehenden steht in engem Zusammenhang
mit dem Ein- und Austritt aus der Sozialhilfe. Der Anteil Personen mit schlechter subjektiver Ge-
sundheit, chronischen Krankheiten und gesundheitlichen Einschränkungen im Alltag ist zwar
schon drei Jahre vor Beginn einer Sozialhilfebezugsperiode höher als in der Restbevölkerung, steigt
jedoch noch weiter bis zum Eintritt in die Sozialhilfe an. Das Maximum der Gesundheitsverschlech-
terung wird im Durchschnitt bei Beginn der Bezugsperiode erreicht. Beim Austritt aus der Sozial-
hilfe können wiederum deutliche Verbesserungen des Gesundheitszustandes festgestellt werden.
Die Vermutung, dass rund um die Aussteuerungen vor dem Sozialhilfebezug besondere Ver-
schlechterungen des Gesundheitszustandes vorkommen, hat sich nicht bestätigt. Werden Perso-
nen mit mehrjährigen Bezugsperioden betrachtet, zeigen sich zudem weder generelle Verschlech-
terungen noch Verbesserungen des Gesundheitszustandes über den Verlauf von Bezugsperioden
hinweg. Mögliche Erklärungen für die beobachteten Muster sind a) der hemmende Einfluss ge-
sundheitlicher Einschränkungen auf die Fähigkeit, ein existenzsicherndes Einkommen zu erzielen,
b) das Zusammenfallen von Ereignissen, welche sowohl zu Gesundheitsverschlechterungen als
auch zum Bezug von Sozialhilfe führen (z.B. Scheidungen) oder c) negative gesundheitliche Aus-
wirkungen der finanziellen und administrativen Belastungen, welche mit dem Sozialhilfebezug ein-
hergehen.
1.3 Gesundheitsleistungen
Sozialhilfebeziehende beanspruchen Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte mit durchschnittlich
vier Konsultationen pro Jahr rund doppelt und Spezialistinnen und Spezialisten mit ebenfalls
durchschnittlich vier Konsultationen etwa viermal so häufig wie die Restbevölkerung und wie Per-
sonen in prekärer finanzieller Lage. Sie sind zudem etwa doppelt so häufig auf Notfallstationen
oder stationär im Spital und beanspruchen fast fünfmal häufiger eine Behandlung aufgrund eines
psychischen Problems. Die Prävalenzen der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen liegen
damit für Sozialhilfebeziehende auf ähnlichem Niveau wie für IV-Rentenbeziehende. Dagegen be-
anspruchen Sozialhilfebeziehende weniger oft Zahnarztleistungen als die Restbevölkerung. Der
Anteil der Sozialhilfebezügerinnen ohne Gebärmutterhalsabstrich (PAP-Test) ist im Lauf der letzten
drei Jahre doppelt so hoch wie bei der Restbevölkerung. Obwohl Sozialhilfebeziehende gesamthaft
im Schnitt mehr Gesundheitsleistungen beziehen, verzichtet ein deutlich grösserer Anteil auf eine
notwendige medizinische beziehungsweise zahnärztliche Untersuchung oder Behandlung als IV-
Rentenbeziehenden, Personen in prekären finanziellen Verhältnissen oder die Restbevölkerung. Es
stellt sich hier die Frage, inwiefern für Sozialhilfebeziehende bei der Inanspruchnahme gesund-
heitlicher Dienstleistungen finanzielle (bspw. die formalen Voraussetzungen für die Finanzierung
von Arzt-/Zahnarztbesuchen) und nicht-finanzielle Hürden bestehen (Gesundheitskompetenz,
Scham, kulturelle Faktoren, Sprachbarrieren).
1.4 Erwerbsreintegration
Die Verlaufsanalyse zur Erwerbsreintegration gibt Hinweise darauf, dass ein schlechter Gesund-
heitszustand die Wahrscheinlichkeit einer Erwerbsreintegration empfindlich vermindert. Sowohl
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
8bei Personen mit schlechtem Gesundheitszustand als auch bei sozioökonomisch und soziodemo-
graphisch vergleichbaren Personen ohne schlechten Gesundheitszustand sind zu Beginn einer So-
zialhilfebezugsperiode nur ein sehr geringer Anteil erwerbstätig. (Rund 20 Prozent haben eine
Erwerbstätigkeit mit einem Einkommen von mindestens CHF 2300/Jahr.) Die Unterschiede zwi-
schen den beiden Gruppen nehmen jedoch mit zeitlicher Distanz zu Beginn der Bezugsperiode
deutlich zu. Fünf Jahre nach Bezugsbeginn hat von den Personen ohne schlechten Gesundheitszu-
stand ein deutlich höherer Anteil eine (Wieder-)Aufnahme der Erwerbstätigkeit geschafft (41 Pro-
zent vs. 25Prozent). Im Vergleich zu erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden weisen nicht-erwerbs-
tätige Sozialhilfebeziehende insbesondere in den Bereichen subjektives Wohlbefinden und Depres-
sionen erhöhte Belastungen auf, wobei nicht beurteilt werden kann, inwiefern diese gesundheitli-
chen Belastungen Ursache oder Folge der Nichterwerbstätigkeit sind. Andere Erkrankungen wie
zum Beispiel chronische Atemwegserkrankungen oder muskuloskelettale Erkrankungen kommen
bei erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden etwa gleich häufig vor.
1.5 Schlussfolgerungen für Politik und Praxis
Dass Personen, die Leistungen der Sozialhilfe beziehen, deutliche gesundheitliche Beeinträchti-
gungen aufweisen, unterstreicht deren Bedeutung als Zielgruppe gesundheitspolitischer Massnah-
men. Die Ergebnisse legen zudem nahe, dass auch die Situation von Personen in prekären finan-
ziellen Verhältnissen, die kurz vor einem Bezug von Sozialhilfe stehen, in den Blick genommen
werden sollte. Eine frühzeitige und adäquate Versorgung mit Gesundheitsleistungen kann die fest-
gestellten Verschlechterungen des Gesundheitszustandes und die Abhängigkeit von Sozialhilfe
möglicherweise abschwächen.
Aus Sicht der Sozialhilfepraxis unterstreichen die Resultate die Zweckmässigkeit eines weiteren
Ausbaus des Gesundheitsmanagements in der Sozialhilfe. Das hier festgestellte Risiko einer Un-
terversorgung und deren Ursachen sollte noch genauer untersucht werden und allenfalls Anpas-
sungen der Angebote und formalen Prozesse in den Sozialdiensten vorgenommen werden. Die
Resultate sind mit der Annahme vereinbar, dass insbesondere eine frühzeitige und erfolgreiche
Behandlung psychischer Probleme die Erwerbsreintegrationschancen erhöhen und Sozialhilfeab-
hängigkeit reduziert. Potenzial für Verhaltensinterventionen besteht auch in den Bereichen Ernäh-
rung, Bewegung und Rauchen. Angebote zur Verbesserung der Gesundheit von Sozialhilfebezie-
henden sollten idealerweise sorgfältig evaluiert und nach wissenschaftlich bestätigter Wirksamkeit
flächendeckend eingeführt werden.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
92 Einleitung
2.1 Ausgangslage
Armutsbetroffene sind häufiger von gesundheitlichen Problemen betroffen als Personen, die finan-
ziell gut abgesichert sind. Dieser Zusammenhang besteht, weil einerseits gesundheitliche Prob-
leme eine Erwerbstätigkeit und die Vermögensbildung erschweren und weil andererseits Armut
und ihre Begleiterscheinungen negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben (Marmot & Wilkin-
son, 2005). Folglich weisen Personen, die für ihre Existenzsicherung auf Leistungen der Sozialhilfe
angewiesen sind, überdurchschnittlich häufig gesundheitliche Beeinträchtigungen auf (Shahidi et al.,
2019).
Gesundheitsprobleme von Sozialhilfebeziehenden stellen Sozialdienste vor besondere Herausfor-
derungen. Frühzeitige Interventionen können bei besonders betroffenen Klientinnen und Klienten
Negativspiralen und Langzeitabhängigkeit verhindern. Das Fachpersonal und die bestehenden An-
gebote der Sozialdienste sind für diese Aufgabe bisher aber nur begrenzt vorbereitet. Für einen
evidenzbasierten Aufbau entsprechender Kompetenzen und Angebote (vgl. Direktion für Bildung, Sozi-
ales und Sport Stadt Bern, 2020) kann die Praxis bis anhin nur auf eine beschränkte Studienlage zurück-
greifen.
Für ausgewählte städtische Sozialdienste in der Schweiz ist bekannt, dass Sozialhilfebeziehende
überdurchschnittliche Beeinträchtigungen der Gesundheit aufweisen. Im Vergleich zur Restbevöl-
kerung sind sie signifikant häufiger von Schmerzen und von rheumatischen und psychischen Er-
krankungen betroffen (Reich et al., 2015). Bei Langzeitbeziehenden sind gesundheitliche Belastungen
besonders ausgeprägt (Salzgeber, 2014). Sozialhilfebeziehende nehmen zudem mehr Gesundheits-
leistungen in Anspruch als die Restbevölkerung (Reich et al., 2015).
Unklar ist, ob sich diese lokalen Befunde auf die gesamte Schweiz übertragen lassen, das heisst,
inwiefern zum Beispiel auch in ländlichen Gebieten ähnliche Unterschiede feststellbar sind. Die
Gesundheitssituation von Sozialhilfebeziehenden wurde zudem bisher nicht mit der Situation von
anderen vulnerablen Gruppen wie Beziehenden von IV-Renten (fortan IV-Rentenbeziehende) oder
Personen in prekären finanziellen Verhältnissen ohne Sozialhilfebezug oder IV-Rente in Relation
gesetzt. Eine weitere wichtige Forschungslücke betrifft das Interventionspotenzial von Sozialdiens-
ten. Unbekannt ist, ob der schlechte Gesundheitszustand von «neuen» Sozialhilfebeziehenden
schon vor dem Bezug von Sozialhilfe besteht (bspw. als Folge von Belastungen im Zusammenhang
mit Aussteuerungen) oder ob nach dem Beginn von Bezugsperioden noch deutliche Verschlechte-
rungen des Gesundheitszustandes stattfinden (Wolffers & Reich, 2015). Auch offen ist, ob die hohe
Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen dem tatsächlichen Bedarf der Sozialhilfebeziehen-
den entspricht oder ob eine Über-, Unter- oder Fehlversorgung besteht. Schliesslich ist der Zusam-
menhang zwischen Gesundheitsproblemen und Erwerbsreintegration wenig untersucht. Aufgrund
internationaler Studien kann generell von einem negativen Einfluss von gesundheitlichen Beein-
trächtigungen auf die Erwerbsreintegration ausgegangen werden (Løyland et al., 2020). Nicht bekannt
ist aber, welche Art von Gesundheitsproblemen besondere Hindernisse für die Erwerbsreintegra-
tion darstellen.
Vor diesem Hintergrund hat das Bundesamt für Gesundheit (BAG), die Berner Fachhochschule (BFH)
und die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) beauftragt, basierend auf ei-
ner Machbarkeitsanalyse von 2019 (Fluder et al., 2019) die Studie «Gesundheit von Sozialhilfebezie-
henden» durchzuführen.
2.2 Fragestellungen
Die Studie gliedert sich in vier Fragestellungen, welche zur Schliessung der erwähnten Forschungs-
lücken beitragen.
Im ersten Modul «Gesundheitsprofil» fragen wir, wie sehr sich der Gesundheitszustand und das
Gesundheitsverhalten von Sozialhilfebeziehenden in der Schweiz von relevanten Vergleichsgrup-
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
10pen unterscheidet: der Restbevölkerung, IV-Rentner/-innen sowie Personen in prekären finanziel-
len Verhältnissen (ohne Bezug von Sozialhilfe oder IV-Rente). Die Analysen zeigen auf, welche Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen wie häufig vorkommen und ob bestimmte Subgruppen von Sozial-
hilfebeziehenden (Frauen vs. Männer, Jüngere vs. Ältere, mit/ohne Kinder/Partner, in städtischen
und intermediär/ländlichen Regionen Wohnhafte, Grossregionen, Personen mit schweizeri-
scher/nicht-schweizerischer Nationalität) besondere Gesundheitsbeeinträchtigungen aufweisen.
Im zweiten Modul «Gesundheitsverlauf» untersuchen wir die Frage, ob bei Aussteuerung vor dem
Sozialhilfebezug, beim Übergang in die Sozialhilfe, im Laufe des Sozialhilfebezugs und beim Aus-
tritt aus der Sozialhilfe Veränderungen im Gesundheitszustand stattfinden.
Im dritten Modul «Gesundheitsleistungen» fragen wir, wie sehr Sozialhilfebeziehende Gesundheits-
leistungen in Anspruch nehmen und ob sich im Vergleich zu den Vergleichsgruppen Unterschiede
zeigen. Zudem wird untersucht, ob sich Hinweise für Unter-, Über- oder Fehlversorgung ergeben.
Im vierten Modul «Erwerbsreintegration» fragen wir, wie sich der Gesundheitszustand auf die Er-
werbstätigkeit von Sozialhilfebeziehenden auswirkt. Wir verdeutlichen, inwiefern gesundheitliche
Beeinträchtigungen eine Erwerbsaufnahme erschweren, in welchem Umfang nicht-erwerbstätige
Sozialhilfebeziehende an gesundheitlichen Beschwerden leiden und welche Arten von Beschwer-
den und Erkrankungen bei dieser Gruppe besonders häufig auftreten.
2.3 Struktur des Berichtes
Der Bericht fasst zuerst den Forschungsstand zu Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden zusam-
men, wodurch bestehende Forschungslücken beleuchtet werden. Zweitens beschreiben wir die
Methodik der Studie. Dort zeigen wir die Eigenschaften der Datengrundlage, präsentieren die ver-
wendeten Indikatoren und analytische Vorgehensweise in den Modulen. Im Kapitel «Resultate»
präsentieren und diskutieren wir die Ergebnisse der Analysen in den vier Modulen. Im Schlussfol-
gerungsteil fassen wir die wichtigsten Resultate zusammen und zeigen weiteren Forschungsbedarf
zur Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden und die Bedeutung der Resultate für Politik und Praxis
auf.
3 Forschungsstand: Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden
Für ein gesundes Lebens ist der Zugang zu finanziellen Ressourcen von grosser Bedeutung. Nur
mit ausreichenden Mitteln ist es möglich, den Lebensalltag gut zu bestreiten und für das Wohler-
gehen notwendige Güter zu beschaffen. In wohlhabenden Gesellschaften bestehen dabei deutliche
gesundheitliche Ungleichheiten aufgrund der Einkommensklassen (Bartley, 2017) und anderen Un-
gleichheitsdimensionen (Mackenbach et al., 2016). Das Risiko chronisch zu erkranken bis hin zur
Sterblichkeit unterscheidet sich erheblich je nach Einkommen und Vermögen (Bleich et al., 2012). Eine
gute Gesundheit ist einerseits eine wichtige Voraussetzung für eine Teilnahme am Erwerbsleben.
Andererseits beeinflusst die Ausstattung mit finanziellen Ressourcen die Möglichkeiten, die Ge-
sundheit zu pflegen und zu erhalten (Marmot & Wilkinson, 2005). Auch in der Schweiz sind wechsel-
seitige Abhängigkeiten zwischen sozioökonomischem Status und der Gesundheit zu beobachten
(OBSAN, 2019). Besonders prekär ist die Situation für Menschen mit tiefen oder keinem Einkommen.
Diesbezüglich hat die Sozialhilfe eine wichtige Funktion. Als letztes Netz der Existenzsicherung
schützt sie vor Armut und deren Folgen. Sie leistet damit einen zentralen Beitrag zum Erhalt der
Gesundheit von Menschen mit wenig oder keinem Einkommen (Sun et al., 2021).
Ausgehend von den Fragestellungen dieses Projektes ist der Forschungstand zum Gesundheitszu-
stand und zur Gesundheitsversorgung von Sozialhilfebeziehenden in der Schweiz von Bedeutung.
Ebenso ist es relevant, wie sich die Gesundheit auf die Erwerbsreintegration auswirkt. Falls Rück-
schlüsse auf die Schweiz möglich sind, wird auch auf die internationale Literatur verwiesen.
3.1 Gesundheitszustand
Mehrere neuere Studien geben einen Überblick bezüglich des Wissenstandes zur Gesundheit von
Sozialhilfebeziehenden in wohlhabenden Ländern (Shahidi et al., 2019). Im Rahmen einer Metastudie
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
11identifizierten Shahidi et al. (2019) 17 peer-reviewte Studien, die für Sozialhilfebeziehende einen
schlechteren Gesundheitszustand im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung konstatieren. Dabei
handelt es sich um ein robustes Resultat, das in allen untersuchten Ländern auftritt 1. Allerdings
können die Gründe für den schlechteren Gesundheitszustand von Sozialhilfebeziehenden nicht
abschliessend beurteilt werden. Einerseits ist dies ein Ausdruck davon, dass Menschen wegen ihres
schlechten Gesundheitszustands in eine finanzielle Notlage geraten. Einige Studien deuten darauf
hin, dass besonders Menschen mit psychischen Beschwerden ein höheres Risiko eines Stellenver-
lustes und damit auch ein erhöhtes Risiko einer Sozialhilfeabhängigkeit haben (Andreeva et al., 2015;
Callander & Schofield, 2015; Kiely & Butterworth, 2014). Andererseits sind Sozialhilfeempfänger wie alle
Armutsbetroffenen aufgrund ihrer prekären Lage häufiger ungünstigen Lebensbedingungen aus-
gesetzt, wie zum Beispiel einer belastenden Wohnsituation, ungesunder Ernährung, Stress und
psychischer Belastung. Diese Risikofaktoren erhöhen die Wahrscheinlichkeit zu erkranken (Marmot
& Wilkinson, 2005; Ridley et al., 2020). Eine weitere Erklärung der Unterschiede sehen Shahidi et al. (2019)
in der Verschärfung der Zugangsbedingungen zu Sozialleistungen, die in vielen westlichen Län-
dern in den letzten Jahren zu beobachten war (Deeming, 2016; Peck, 2001). Diese fördert prekäre Ar-
beitsbedingungen mit negativen gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen (Butterworth et al.,
2013). Einige Studien konnten eine Verschlechterung der Gesundheit von Sozialhilfebeziehenden
als Folge der Kürzung von Unterstützungsgeldern mit experimentellen und quasi-experimentellen
Designs feststellen (Basu et al., 2016; Muennig et al., 2013; Narain et al., 2017; Sun et al., 2021; Wilde et al., 2014).
Die vorhandenen Studien erlauben allerdings keine eindeutige Aussage darüber, welche Effekte
überwiegen oder ob das eine oder andere Muster zur Erklärung der schlechten Gesundheit von
Sozialhilfebeziehenden besser geeignet ist. Shahidi et al. (2019) sehen grossen Forschungsbedarf
und regen Längsschnittanalysen sowie Vergleiche von Sozialhilfebeziehenden mit ähnlichen Bevöl-
kerungsgruppen an.
Zwar war die Schweiz nicht Gegenstand der erwähnten Meta-Analyse, es liegen aber ebenfalls Stu-
dien vor, welche von einem deutlich schlechteren Gesundheitszustand von Sozialhilfebeziehenden
in der Schweiz berichten. Lätsch et al. (2011) befragten erwerbslose Sozialhilfebeziehende der Stadt
Bern. Die Befragten fühlten sich markant weniger gesund als der Durchschnitt der schweizerischen
Bevölkerung, sie berichteten von deutlich mehr gesundheitlichen Problemen und beanspruchten
überdurchschnittlich häufig ärztliche und/oder psychotherapeutische Behandlungen. Junge Er-
wachsene (Altersgruppe 18-25 Jahre) waren die am wenigsten beeinträchtige Altersgruppe, aller-
dings konsumierte diese Gruppe am häufigsten Suchtmittel und war besonders gefährdet für lang-
fristige psychische Beeinträchtigungen. Klientinnen und Klienten mittleren und fortgeschrittenen
Alters sind in ähnlichem Ausmass von gesundheitlichen Einschränkungen betroffen, wobei es Hin-
weise darauf gab, dass sich letztere durch den Status der Langzeitarbeitslosigkeit weniger belastet
fühlen. Salzgeber (2014) analysierte Sozialhilfedossiers von je 50 bis 70 Langzeitfällen ausgewähl-
ter Schweizer Städte 2. Rund zwei Drittel der untersuchten Fälle hatten gesundheitliche Beeinträch-
tigungen. Physische Einschränkungen aufgrund eines Unfalles oder Krankheit (40 Prozent der Fälle
mit dokumentierten Gesundheitsproblemen) und psychische Erkrankungen oder attestierte De-
pressionen (40 Prozent) waren ähnlich häufig. Eine dritte relevante Gruppe kämpfte mit Suchtprob-
lemen und deren Folgen (20 Prozent). Zu ähnlichen Befunden kamen Wolffers und Reich (2015). Sie
verknüpften Daten von 391 Sozialhilfebeziehenden der Stadt Bern mit Leistungsdaten der Helsana
und verglichen sie mit Daten der restlichen in Bern lebenden Versicherten bei Helsana. Damit lies-
sen sich Erkenntnisse zur Gesundheitssituation von Sozialhilfebeziehenden im Jahr 2012 generie-
ren. Sozialhilfebeziehende hatten deutlich häufiger chronische Erkrankungen. Besonders auffällig
waren Schmerzerkrankungen und rheumatische Beschwerden sowie Magenprobleme. Im Vergleich
zur Bevölkerung ohne Sozialhilfebezug wiesen sie eine doppelt so hohe Prävalenz von psychischen
Erkrankungen auf.
Die erwähnten Studien beziehen sich alle auf Klientinnen und Klienten von ausgewählten städti-
schen Sozialdiensten. Unklar bleibt dabei insbesondere die Situation von Sozialhilfebeziehenden
in ländlichen Regionen. Ebenso ist offen, wie sich die Gesundheitssituation während und vor des
1
Schweden, USA, Australien, UK, Norwegen, Deutschland und Kanada sind Gegenstand der Meta-Studie.
2
Dazu gehörten Zürich, Basel, Lausanne, Bern, Winterthur, Luzern, Biel, Schaffhausen, Uster, Zug und Schlieren.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
12Sozialhilfebezuges verändert und welche Rolle die Sozialhilfe hinsichtlich der Gesundheit ihrer Kli-
entinnen und Klienten einnimmt.
3.2 Gesundheitsversorgung
Damit stellt sich die Frage, ob Armutsbetroffene und Sozialhilfebeziehende ausreichend Zugang
zur Gesundheitsversorgung haben oder ob eine Unter- oder Fehlversorgung vorliegt. Diesbezüg-
lich gibt es Anzeichen, dass der Zugang zum Gesundheitssystem nicht für alle gleichermassen
gesichert ist, trotz des in der Schweiz seit 1994 bestehenden Krankenversicherungsobligatoriums.
Grundsätzlich garantiert dieses den Zugang zu einer guten medizinischen Versorgung für alle in
der Schweiz lebenden Personen. Remund et al. (2019) hinterfragen den Erfolg dieser Zielsetzung
allerdings kritisch, stellen sie doch eine Zunahme der Unterschiede in der Lebenserwartung zwi-
schen sozioökonomischen Gruppen fest. Die Autoren verweisen darauf, dass die Kostenbeteili-
gung in der Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern hoch ist und Menschen mit tiefem sozio-
ökonomischem Status deswegen eher auf Arztbesuche verzichten. Dies führe dazu, dass bei dieser
Gruppe seltener präventive Gesundheitsmassnahmen getroffen werden. Kilchenmann, Reding, Kai-
ser, Gerfin & Zimmermann (2017) bestätigten, dass die Höhe der Franchise tatsächlich einen Effekt
auf die Inanspruchnahme von medizinischen Leistungen habe. Personen mit geringem Einkom-
men, schlechter Zahlungsfähigkeit und hohen Franchisen verzichteten häufiger aus finanziellen
Gründen auf Leistungen. Die Autoren schätzen, dass rund ein Prozent der Bevölkerung in der
Schweiz aus finanziellen Motiven auf notwendige ärztliche Leistungen verzichte. Gemäss den
Schätzungen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums (OBSAN, 2021) ist der Anteil der
Schweizer Bevölkerung, der aus finanziellen Gründen notwendige Gesundheitsleistungen nicht in
Anspruch nimmt mit drei bis fünf Prozent sogar höher. Andere Studien bestätigen, dass insbeson-
dere Menschen mit geringem Einkommen häufig aus finanziellen Gründen auf Gesundheitsleistun-
gen verzichten (Wolff et al., 2011) und dies hauptsächlich bei zahnärztlichen Leistungen (GEF, 2015).
Wie stark Sozialhilfebeziehende davon betroffen sind, ist aus diesen Studien nicht ersichtlich.
Die wenigen bestehenden Studien deuten darauf hin, dass bei Sozialhilfebezug der Zugang zur
Gesundheitsversorgung gesichert ist und nicht per se eine Unterversorgung vorliegt. Aus der Ana-
lyse von Krankenversicherungsdaten (Reich et al., 2015) geht hervor, dass Sozialhilfeempfänger deut-
lich mehr Arztkonsultationen aufweisen als die allgemeine Bevölkerung und dass die Hospitalisie-
rungsrate rund doppelt so hoch ist. Auch gemäss einer durch Gerber et al. (2020) durchgeführten
Befragung von Fachpersonen der Sozialdienste scheinen keine allgemeinen Versorgungsschwie-
rigkeiten vorzuliegen. Sozialdienste arbeiten intensiv mit dem Gesundheitssystem zusammen.
Grosse Herausforderung sehen die befragten Fachpersonen allerdings in der Arbeit mit Klientinnen
und Klienten mit psychischen Erkrankungen, bei Gesundheitsbeschwerden ohne Sozialversiche-
rungsanspruch und bei Suchterkrankungen. Dazu bieten Sozialdienste nur begrenzte Unterstüt-
zung. Zur optimalen Begleitung von Fällen mit oben genannten Problematiken müssten die Kapa-
zitäten der Sozialhilfe gestärkt werden (OECD, 2014). Wenn Sozialhilfebeziehende ihre Krankenkas-
senprämien nicht bezahlen, kann dies für Sozialdienste zur Herausforderung werden. Für die Be-
troffenen kann daraus ein Leistungsaufschub resultieren. Die Dienste sind in diesem Fall gefordert,
die Situation zu bereinigen, damit die Krankenversicherer die Kosten für Gesundheitsleistungen
(wieder) übernehmen und Betroffene uneingeschränkt Zugang zum Gesundheitssystem haben.
Es wäre allerdings voreilig, aufgrund der aktuellen Studienlage ein abschliessendes Fazit zur An-
gemessenheit der Gesundheitsversorgung von Sozialhilfebeziehenden zu ziehen. Reich et al. (2015)
und Gerber et al. (2020) erlauben keine repräsentativen Aussagen zur gesamtschweizerischen Situ-
ation. Zudem wurde in den Studien keine explizite Gegenüberstellung des Bedarfs an Gesundheits-
leistungen und der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen vorgenommen. Erwartet werden
könnte eine Unterversorgung aufgrund eines verhängten Leistungsaufschubs zur Abstrafung von
Zahlungsverzögerungen. Betroffene Personen haben nämlich nur noch Anspruch auf Notfallbe-
handlungen. Welche gesundheitlichen Folgen ein Leistungsaufschub für Betroffene hat, ist bisher
nicht systematisch analysiert worden.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
133.3 Erwerbstätigkeit
Eine schlechte Gesundheit kann nicht nur in Bezug auf die Chance einer Reintegration in den Ar-
beitsmarkt, sondern auch in Bezug auf die Qualität einer erneuten Anstellung ein Hindernis dar-
stellen. Eine kürzlich veröffentlichte norwegische Studie hat aufgezeigt, dass die Erwerbsreintegra-
tion von Sozialhilfebeziehenden mit Schmerzen und psychischen Erkrankungen gegenüber Sozial-
hilfebeziehenden ohne solche Einschränkungen deutlich geringer ist (Løyland et al., 2020). Auch in
der Schweiz sind schon seit längerem insbesondere psychische Erkrankungen als wichtige Heraus-
forderung der Sozial- und Arbeitsmarktpolitik von Entscheidungsträgern der Politik und Wirtschaft
erkannt (OECD, 2014). Bekannt ist, dass Personen mit einer Teilinvalidenrente oder starken gesund-
heitlichen Einschränkungen deutlich tiefere Löhne als Menschen ohne gesundheitliche Einschrän-
kungen erhalten (Guggisberg et al., 2021). Festgestellt wurde auch, dass nicht-erwerbstätige Sozialhil-
febeziehende (Lätsch et al., 2011) und langzeitbeziehende Sozialhilfebeziehende überdurchschnittli-
che gesundheitliche Belastungen aufweisen (Salzgeber 2014). Haller und Hümbelin (2013) stellen in
einer Langzeitstudie mittels einer 4-Jahres-Kohorte von Sozialhilfebeziehenden eines grossen
schweizerischen Sozialdienstes fest, dass Langzeitverläufe insbesondere bei Personen mit mittle-
ren gesundheitlichen Einschränkungen gehäuft auftreten. Diese Gruppe ist zu krank für den Ar-
beitsmarkt, aber zu gesund, um eine IV-Rente zu erhalten.
Bisher bestehen jedoch keine Studien, welche explizite Aussagen zum Einfluss gesundheitlicher
Einschränkungen auf die Erwerbsintegration und das Erwerbseinkommen von Sozialhilfebeziehen-
den in der Schweiz zulassen. Unklar ist, wie sehr Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen
geringere Chancen einer Reintegration in den Arbeitsmarkt aufweisen als Personen ohne gesund-
heitliche Einschränkungen. Bisher wurde zudem noch kein Vergleich des Gesundheitszustandes
von erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Sozialhilfebeziehenden vorgenommen. Unterschiede
in der Häufigkeit bestimmter Erkrankungen und Einschränkungen zwischen den beiden Gruppen
liessen Rückschlüsse zu, welche Art gesundheitlicher Einschränkungen eine Erwerbsintegration im
Wege stehen.
4 Methodik
Der in der Studie verfolgte Forschungsansatz stützt sich auf die Ergebnisse der Pilotstudie von
Fluder et al. (2019). In der erwähnten Studie wurden verschiedene mögliche Datenquellen hinsicht-
lich ihres Potenzials untersucht, die Gesundheit von Sozialhilfehilfebeziehenden im Sinne des Ge-
sundheitsmodelles der Weltgesundheitsorganisation (WHO, 1986) zu erfassen und die oben be-
schriebenen Fragestellungen zu beantworten. Berücksichtigt wurden mit Administrativ- und Sozi-
alhilfedaten verknüpfte Befragungsdaten, Daten von Krankenversicherern sowie Sozialhilfedos-
siers. Die Autoren haben verknüpfte Befragungsdaten bezüglich ihrer Verfügbarkeit und inhaltli-
cher Qualität für vorliegende Zwecke am geeignetsten eingestuft, weshalb dieser Ansatz hier wei-
terverfolgt wurde. Im Folgenden werden die verwendeten Datengrundlagen, die wichtigsten Da-
tenaufbereitungsschritte, der Umfang und die Repräsentativität der Analysestichproben, die ver-
wendeten Messinstrumente (Operationalisierung) sowie die zur Beantwortung der Teilfragestellun-
gen berechneten Kennzahlen (Analysestrategie) beschrieben.
4.1 Datenbasis
Die verwendete Datenbasis basiert auf einer Verknüpfung der Schweizerischen Gesundheitsbefra-
gung (SGB), der Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) und der Schweize-
rischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) mit Daten der Gesamtbevölkerung (Sozialhilfestatistik (SHS),
Individualkonten (IK-Daten) und Rentenregister der AHV (IV-Daten)). Es stehen dadurch bis zu einer
halben Million Beobachtungen über den Zeitraum 2007 bis 2018 zur Verfügung (vgl. Tabelle 4).
Die Verknüpfung dieser Datenquellen wurde mittels der individuellen AHV-Nummer (Sozialversi-
cherungsnummer) vorgenommen. Um den Datenschutz zu gewährleisten, erhielt das For-
schungsteam lediglich eine pseudonymisierte Version der AHV-Nummer. Die Bereitstellung der
Daten und die Pseudonymisierung der AHV-Nummer wurde durch das Bundesamt für Statistik vor-
genommen. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die verwendeten Datenquellen, Abbildung 1 über
den jeweiligen Beobachtungszeitraum.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
14TABELLE 1: E IGENSCHAFTEN DER VERWENDETEN D ATENQUELLEN
Datenquelle Eigenschaften Beobach- Verwendungszweck Benötigt für
tungsjahre Module
Schweizerische Telefonische und schriftliche 2012, 2017 Differenzierte Messung von Gesund- «Gesund-
Gesundheitsbe- Querschnittsbefragung der heitszustand, Gesundheitsverhalten heitsprofil»
fragung (SGB) schweizerischen Wohnbevöl- und Leistungsbeanspruchung, Zusatz- und «Ge-
(BFS, 2017a) kerung ab 15 Jahren alle 5 sampling der Migrationsbevölkerung, sundheitsleis-
Jahre, Stichprobe von gute Repräsentativität der Sozialhilfe- tungen»
N≈22'000/Erhebung beziehenden
Erhebung zu Rotierende jährliche Panel- 2007-2018 Hohe Anzahl Beobachtungen, be- Alle Module
den Einkom- befragung der Haushalte in schränkte Informationen zum Ge-
men und Le- der Schweiz, Stichprobe von sundheitszustand, Gesundheitsverhal-
bensbedingun- N≈15’000-18’000/Jahr ten und Leistungsinanspruchnahme
gen (SILC) (BFS,
2020a)
Schweizerische Rotierende jährliche Panel- 2010-2018 Hohe Anzahl Beobachtungen, be- «Gesund-
Arbeitskräfteer- befragung der schweizeri- schränkte Informationen zum Ge- heitsprofil»,
hebung (SAKE) schen Wohnbevölkerung ab sundheitszustand «Gesund-
(BFS, 2020b) 15 Jahren, Stichprobe von. heitsverlauf»,
N≈60’000/Jahr «Erwerbs-
reintegra-
tion»
BFS - Sozialhil- Jährliche Vollerhebung aller 2005-2018 Bezug von wirtschaftlicher Sozialhilfe, Alle Module
feempfänger- Personen in Haushalten mit Bezugsdauer, sozioökonomische und
statistik (SHS) Bezug wirtschaftlicher Sozial- soziodemographische Merkmale der
(BFS, 2019) hilfe Sozialhilfebeziehenden
Individualkon- Kontinuierliche Administra- 2002-2018 Erwerbs- und Sozialversicherungsein- «Erwerbs-
ten der AHV (IK- tivdaten kommen reintegra-
Daten) (ZAS, tion»
2019)
Invaliditätsren- Kontinuierliche Administra- 2007-2018 Bezug von IV-Renten «Gesund-
tenregister (IV- tivdaten heitsprofil»
Daten) (ZAS, und «Ge-
2021) sundheitsleis-
tungen»
A BBILDUNG 1: Ü BERBLICK ÜBER B EOBACHTUNGSZEITRAUM UND E RHEBUNGSFREQUENZ DER VER-
WENDETEN D ATENQUELLEN
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
154.2 Grundgesamtheit und Stichproben
Die Analysen beschränken sich auf Beobachtungen von Personen der ständigen Wohnbevölkerung
in Privathaushalten ab 16 Jahren 3 und vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters (Frauen 63,
Männer 64). Personen, welche in Alters- und Pflegeheimen oder Institutionen für Behinderte woh-
nen, werden in der SGB, der SILC und in der SAKE nicht oder nur marginal erfasst und können
deshalb nicht berücksichtigt werden.
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Fallzahlen in den Jahren 2007 bis 2018. Sie zeigt die ab-
soluten und relativen Häufigkeiten von Sozialhilfebeziehenden im Beobachtungsjahr, Befragten in
SAKE, SILC und SGB und Befragten in SAKE, SILC und SGB mit Sozialhilfebezug im Beobachtungs-
jahr. Aus dem Vergleich der Anteil Personen mit Sozialhilfebezug in der Bevölkerung und den
entsprechenden Anteilen in den Umfragestichproben – letztere sind nur rund halb so gross – geht
hervor, dass Sozialhilfebeziehende an allen drei Umfragen eine deutlich reduzierte Teilnahmebe-
reitschaft hatten. Die Bezugsquoten in SAKE und SGB sind in etwa gleich, in SILC liegen sie gering-
fügig tiefer. Die Anteile vor 2010 liegen insgesamt etwas tiefer, da bis dann nur antragstellende
Sozialhilfebeziehende in die SHS einflossen 4.
3
16 ergibt sich aus der unteren Altersgrenze in der SILC Stichprobe (SGB und SAKE/SESAM enthalten Informationen von
Personen ab 15 Jahren).
4
Wir verwenden Informationen vor 2010 dennoch, um möglichst viele Beobachtungen in die Analysen einfliessen lassen
zu können. Aufgrund der geringen insgesamten Bedeutung der Beobachtungen vor 2010 können wir davon ausgehen,
dass unsere Ergebnisse nicht wesentlich durch die Überrepräsentierung von Antragstellenden vor 2010 beeinflusst sind.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
16Tabelle 2 : Fallzahlen Sozialhilfe und Bezugsquoten in der Gesamtpopulation (Bevölkerungs-/Sozialhilfestatistik) und gemäss Umfragedaten (SAKE/SE-
SAM, SILC, SGB)
Bevölkerung SAKE SILC SGB
N (mit Be- Anteil Sozi- N N (mit Be- Anteil Sozi- N N (mit Be- Anteil Sozi- N N (mit Be- Anteil Sozi-
zug) alhilfebe- zug) alhilfebe- zug) alhilfebe- zug) alhilfebe-
ziehende ziehende ziehende ziehende
2007 135'158 2.68 10'087 102 1.01
2008 140'885 2.75 10'051 117 1.16
2009 156'598 3.03 11'196 175 1.56
2010 163'648 3.14 46'120 877 1.9 11'410 177 1.55
2011 173'074 3.29 50'171 1'079 2.15 11'109 198 1.78
2012 177'951 3.35 51'896 1'039 2 10'856 177 1.63 16'446 284 1.73
2013 183'598 3.42 50'167 1'012 2.02 10'464 146 1.4
2014 187'518 3.46 50'044 1'098 2.19 9'739 152 1.56
2015 189'856 3.47 50'767 1'023 2.02 10'810 189 1.75
2016 194'253 3.52 48'377 930 1.92 11'387 194 1.7
2017 194'808 3.52 48'708 970 1.99 13'273 221 1.67 16'651 332 1.99
2018 181'234 3.26 48'252 731 1.51 8'012 115 1.44
Bemerkungen: Bezug wird definiert als mindestens einmonatiger Erhalt von monetärer Sozialhilfe im Beobachtungsjahr (Männer 16-64; Frauen: 16-
63). Die Quoten vor 2010 sind reduziert, da nur Antragsteller und keine weiteren Personen in den Unterstützungseinheiten identifiziert werden
können. Quellen: SAKE, SILC, SGB, BFS -Sozialhilfeempfängerstatistik.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences4.3 Gewichtung zur Reduktion von Non-response Bias
Die tiefe Befragungsteilnahmebereitschaft von Sozialhilfebeziehenden hat möglicherweise Konse-
quenzen für die Repräsentativität der vorliegenden Analysen. Die Machbarkeitsstudie hat aufge-
zeigt, dass an Befragungen teilnehmende Sozialhilfebeziehende sich hinsichtlich soziodemogra-
phischer und sozioökonomischer Charakteristika systematisch von nicht an Befragungen teilneh-
menden Sozialhilfebeziehenden unterscheiden (Fluder et al. 2019). Eine plausible These ist, dass
Sozialhilfebeziehende mit besonders schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen weniger häu-
fig an Befragungen teilnehmen. Dies würde dazu führen, dass die gesundheitliche Situation von
Sozialhilfebeziehenden mit der vorliegenden Datenbasis zu positiv eingeschätzt würde. Allerdings
dürfte dies auch für andere Bevölkerungsgruppen zutreffen und deshalb bei Gruppenvergleichen
weniger ein Problem darstellen.
Zur besseren Einschätzung der Repräsentativität der Ergebnisse haben wir anhand der SHS-, IK-
und IV-Daten einen Vergleich der Eigenschaften von an Befragungen Teilnehmenden und der Ge-
samtheit der Sozialhilfebeziehenden vorgenommen. Tabelle 3 zeigt, dass jeweils für mindestens
eine Umfrage für alle berücksichtigten sozioökonomischen, soziodemographischen und gesund-
heitsrelevanten Merkmale signifikante Unterschiede zwischen den beiden Gruppen bestehen. Rich-
tung und Ausmass der Abweichungen variieren jedoch stark zwischen den Befragungen. Konsis-
tent über alle Befragungen hinweg ist die Tendenz einer Unterrepräsentation männlicher Sozialhil-
febeziehender und von Sozialhilfebeziehenden mit Aufenthaltsstatus «Vorläufige Aufnahme F, An-
erkannte Flüchtlinge B, Anderes». Ebenso zeigt sich eine Überrepräsentation älterer Sozialhilfebe-
ziehender. Für die vorliegende Studie relevant ist der Befund, dass wir keine systematische Unter-
repräsentation bezüglich Indikatoren feststellen, welche mit dem Gesundheitszustand (Bezug ei-
ner IV-Rente, Bezug von Krankentaggeldern) oder der Erwerbsreintegration korrelieren dürften (Bil-
dung, Beschäftigungsstatus und Einkommen). Erwähnenswert ist zudem die festgestellte, leichte
Unterrepräsentation von Sozialhilfebeziehenden mit Schweizer Nationalität in SAKE und SGB. Diese
ist auf das Stichprobendesign zurückzuführen, in denen Personen mit nicht-schweizerischer Nati-
onalität überrepräsentiert werden (Ausländerstichproben respektive Zusatzstichproben für die
Migrationsbevölkerung) (BFS, 2017a, 2020b). Diese Dateneigenschaften reduzieren das Risiko einer
Unterrepräsentation der Migrationsbevölkerung in der Sozialhilfe aufgrund von Sprachproblemen
oder anderen migrationsbedingten Teilnahmehindernissen.
Die vom BFS mitgelieferten Umfragegewichte der SGB und der SILC korrigieren Umfrageausfälle
nur für grundlegende soziodemographische Merkmale (z.B. Alter, Geschlecht, Wohnort, Nationali-
tät) 5 und nicht speziell für Sozialhilfebeziehende. Um Verzerrungen der Resultate aufgrund der
(leichten) Selektivität der Stichproben von Sozialhilfebeziehenden zu reduzieren, berechneten wir
spezifische Gewichte für Sozialhilfebeziehende, welche auf die SHS, die IK-Daten und die IV-Daten
zurückgreifen. Dafür setzen wir – separat für jedes Befragungsjahr und für jede Umfrage - die
Charakteristika der Stichprobe der befragten Sozialhilfebeziehenden den Charakteristika aller So-
zialhilfebeziehenden des jeweiligen Kalenderjahres gleich. Dies geschieht durch eine spezielle Ge-
wichtung, welche auf dem Entropy-Balancing-Ansatz (Hainmueller, 2012) beruht. Wir berücksichtigten
dafür soziodemographische (Alter, Geschlecht, Nationalität, Aufenthaltsstatus), sozioökonomi-
sche (Erwerbsbeteiligung, Bildungsniveau, Einkommen) und gesundheitsbezogene Informationen
(Bezug von IV-Rente im Beobachtungsjahr, Bezug von Krankentaggeldern). Diesbezügliche Verzer-
rungen bei den befragten Sozialhilfebeziehenden werden so bestmöglich korrigiert und die Reprä-
sentativität der Ergebnisse für Sozialhilfebeziehende verbessert. Tabelle 3 zeigt beispielhaft für
die jüngsten Befragungsjahre aller Umfragen, dass die Verteilungseigenschaften der berücksichti-
gen Merkmale in der Befragtenstichprobe nach Anwendung der Gewichte exakt den Verteilungen
der Gesamtpopulationen entsprechen. Für die Vergleichsgruppen (IV-Rentenbeziehende, Personen
in prekären finanziellen Verhältnissen und Restbevölkerung) verwenden wir die mit den Umfragen
mitgelieferten Gewichte des BFS.
5
In der SAKE wird auch das Einkommen verwendet.
Berner Fachhochschule | Haute école spécialisée bernoise | Bern University of Applied Sciences
18Sie können auch lesen