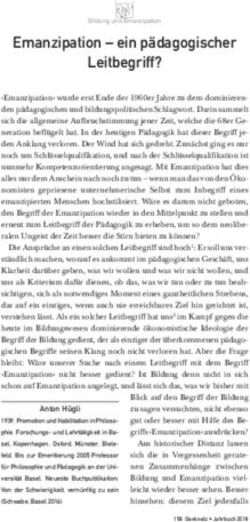Harmonisierte Bildungsrahmenpläne in Werkstätten für behinderte Men-schen und ihre wissenschaftliche Evaluation
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
NDV Januar 2020
ABHANDLUNGEN
Roland Stein, Hans-Walter Kranert, Anna Riedl und Guido Schmidt
Harmonisierte Bildungsrahmenpläne
in Werkstätten für behinderte Men-
schen und ihre wissenschaftliche
Evaluation
Beiträge der BAG WfbM und der Universität Würzburg
Das diesem Bericht zugrundeliegende Vorhaben
wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung unter dem Förderkennzeichen
EVABI gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt
dieser Veröffentlichung liegt beim Autor.
© BAG WfbM | S. Holtzem
Roland Stein Hans-Walter Kranert Anna Riedl Guido Schmidt
I. Hintergrundinformationen zum Forschungs Evaluationsprojekts EvaBi und erste Forschungserkenntnis-
projekt „Evaluation harmonisierter Bildungs se berichten die Vertreter/innen der Universität Würzburg
rahmenpläne (EvaBi)“ der BAG WfbM1 im zweiten Teil dieses Beitrags.
Der Abschluss des zweijährigen Forschungsprojekts EvaBi Die (Berufliche) Bildung von Menschen mit Behinderungen
steht kurz bevor. Das vom Bundesministerium für Bildung ist seit jeher eine von Werkstätten erbrachte, anerkann-
und Forschung (BMBF) seit Anfang 2018 finanzierte te Leistung im gesetzlichen Rahmen der Teilhabe am
Forschungsprojekt bietet die Möglichkeit, grundlegende Arbeitsleben. Zentrales Ziel der Beruflichen Bildung in
Kenntnisse aus einem bisher kaum erforschten Feld zu Werkstätten ist es, die Leistungs- oder Erwerbsfähigkeit
erhalten: der Beruflichen Bildung von Menschen mit Be- der Menschen mit Behinderungen zu entwickeln, zu ver-
hinderungen im Berufsbildungsbereich der Werkstätten. bessern oder wiederherzustellen. Die Berufliche Bildung
Das mit dem Forschungsprojekt verbundene Anliegen der
BAG WfbM besteht darin, die Berufliche Bildung als eine 1) Dieser Abschnitt wurde von Guido Schmidt verfasst.
der zentralen Leistungen von Werkstätten zu stärken, das
Instrument harmonisierter Bildungsrahmenpläne (hBRP)
noch passgenauer auf die Ansprüche einer sehr hetero- Prof. Dr. phil. habil. Roland Stein ist Inhaber des Lehr-
genen Zielgruppe im Berufsbildungsbereich auszurichten stuhls für Sonderpädagogik V der Universität Würz-
und Werkstätten als Teil eines inklusiven Arbeitsmarktes burg und leitet die wissenschaftliche Begleitung des
weiterzuentwickeln. Auch soll EvaBi zu einer angemesse- Forschungsprojekts EvaBi; Hans-Walter Kranert ist
nen gesellschaftlichen und rechtlichen Aufmerksamkeit für Akademischer Oberrat am Lehrstuhl für Sonderpäda-
die (Berufliche) Bildung dieses Personenkreises beitragen. gogik V der Universität Würzburg und ist stellvertreten-
der Projektleiter des Forschungsprojekts EvaBi; Anna
Ein forschender Blick von außen erscheint der BAG WfbM Riedl ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl
für das Erreichen dieser Absichten als erfolgversprechend. für Sonderpädagogik V der Universität Würzburg und
Der Evaluationsaufgabe angenommen hat sich ein Team begleitet das Forschungsprojekt EvaBi; Guido Schmidt
des Lehrstuhls für Sonderpädagogik V der Julius-Maximili- ist Referent Bildung der Bundesarbeitsgemeinschaft
ans-Universität Würzburg. Über die Forschungsfragen des Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM).
22Januar 2020 NDV
in Werkstätten ist nicht als Teil des Berufsbildungssystems Berufsbildungsbereich der Werkstätten und bei der konti-
in Deutschland anerkannt. Die Leistungen der Beruflichen nuierlichen Weiterentwicklung der Werkstattleistung.
Bildung erfolgen innerhalb eines ausdifferenzierten und
verbindlichen Gesamtkonzepts. Die Grundlagen hierfür II. Harmonisierte Bildungsrahmenpläne und ih
regelt das 2010 von der Bundesagentur für Arbeit (BA) re Umsetzung – E
rfordernisse zur Gestaltung
veröffentlichte „Fachkonzept für Eingangsverfahren und passgenauer Beruflicher Bildung2
Berufsbildungsbereich in Werkstätten für behinderte Men-
schen (WfbM)“. Das Fachkonzept der BA fordert Werk- 1. Harmonisierte Bildungsrahmenpläne
stätten u.a. dazu auf, durch Binnendifferenzierung und
Personenorientierung eine Ausrichtung an anerkannten Harmonisierte Bildungsrahmenpläne (hBRP) sind in ein
Berufsausbildungen herzustellen. komplexes Spannungsfeld zu verschiedenen Kernaspek-
ten Beruflicher Bildung eingebettet (siehe Abbildung 1).
HBRP wurden als inhaltliche Ergänzung und Konkretisie- Ausgehend von den Anforderungen des Leistungsträgers
rung zum Fachkonzept der BA von Bildungsexpert/innen sowie den Bedarfen der Teilnehmenden der beruflichen
aus Werkstätten zahlreicher Bundesländer gemeinsam ent- Rehabilitation steht die Organisation Werkstatt für be-
wickelt. Als eine Art übergreifender Rahmen erleichtern hinderte Menschen (WfbM) stets in einem Zielkonflikt
hBRP die Arbeit der Fachkräfte in den Werkstätten und zwischen Bildung/Pädagogik und Arbeit/Produktion. In
professionalisieren ihre Arbeit beispielsweise in Bereichen diesem Kontext sind methodische und didaktische Frage-
der Systematisierung Beruflicher Bildung und Dokumen- stellungen im Hinblick auf hBRP zu klären, ebenso wie die
tation sowie der Anwendung von Lernstrategien. Eine damit verbundenen Qualifikationsanforderungen an die
personenzentrierte Leistung wird durch hBRP erbracht und Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung. Aber auch die
die Angebotsvielfalt der Werkstätten bleibt erhalten. HBRP Kontinuität von Bildung im Sinne lebenslangen Lernens wie
basieren auf den Ausbildungsrahmenplänen anerkannter auch Bildungsergebnisse und die damit verbundene Zertifi-
Ausbildungsberufe und bieten so eine Anbindung an katsorientierung in der Beruflichen Bildung sind hierbei von
vorhandene Standards. Werkstätten erhöhen dadurch die erheblicher Relevanz.
Anschlussfähigkeit ihrer Bildungsangebote an den Arbeits-
bereich der Werkstatt, an anerkannte Ausbildungsberufe 2. Evaluation harmonisierter Bildungsrahmen
und an den allgemeinen Arbeitsmarkt. Binnendifferenzie- pläne (EvaBi)
rung ermöglicht dabei individuelle Bildungspläne sowie
inhaltliche, zeitliche und niveauorientierte Anpassungen. Seit März 2018 untersuchen Forschende des Lehrstuhls
Lernmaterialien, Methoden und Didaktik werden an den für Sonderpädagogik V der Julius-Maximilians-Universität
persönlichen Interessen und den spezifischen Hilfebedar- Würzburg die Realisierung Beruflicher Bildung auf Basis
fen unterschiedlicher Formen von Behinderungen ausge- hBRP. An der Evaluation sind 20 WfbMs beteiligt. Wäh-
richtet. rend 15 Werkstätten bereits in unterschiedlichen Stadien
mit hBRP arbeiten, setzen die übrigen Werkstätten al-
Die Entscheidung zur Verwendung von hBRP liegt bei den ternative Qualifizierungs- und Bildungskonzepte ein und
Werkstätten. Auf dem Mitgliederportal der BAG WfbM bilden dementsprechend eine Vergleichsgruppe. Ziel des
stehen den Werkstätten derzeit 19 hBRP zur Verfügung. Vorhabens ist, neben der Evaluierung der Heterogenität
Das Spektrum der angebotenen hBRP ist breit angelegt: der Zielgruppe die Analyse der Prozess- sowie der Ergeb-
Eine berufliche Qualifizierung zum Medientechnologen/ nisqualität von Bildungsangeboten auf Basis hBRP. Nach-
zur Medientechnologin oder zum Koch/zur Köchin ist folgende Überlegungen zur Gestaltung einer passgenauen
ebenso möglich wie eine berufliche Qualifizierung zum/zur Beruflichen Bildung in Werkstätten stützen sich einerseits
Buchbinder/in oder zum/zur Landwirt/in. auf eine Sichtung des Forschungsstandes und andererseits
auf erste Erkenntnisse aus dem noch bis Februar 2020
Harmonisierte Bildungsrahmenpläne sind innerhalb eines laufenden Forschungsprojekt.
ganzheitlichen Bildungskonzepts im Berufsbildungsbereich
ein Instrument, das es Werkstätten ermöglicht, ihrem 3. Erfordernisse zur Gestaltung passgenauer
gesetzlichen Auftrag noch besser gerecht zu werden, Beruflicher Bildung
Menschen mit Behinderungen, die nicht, noch nicht oder
noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 3.1 Anforderungen des Leistungsträgers
beschäftigt werden können, eine angemessene berufliche Der Berufsbildungsbereich der WfbM stellt sich über einen
Bildung anzubieten und sie in ihrer Persönlichkeitsentwick- Zeitraum von zwei Jahren der Aufgabe, Menschen mit
lung zu stärken. Behinderung individuelle Berufliche Bildung zu ermögli-
chen und sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu unter-
Aufgrund einer sich im Wandel befindlichen Arbeitswelt stützen. Mit der Veröffentlichung des Fachkonzeptes der
(Digitalisierung, Arbeit 4.0, Akademisierung der Arbeits- Bundesagentur für Arbeit im Jahr 2010 bekamen das Ein-
welt etc.) ergeben sich auch für die Berufliche Bildung in gangsverfahren und der Berufsbildungsbereich der W fbM
Werkstätten Herausforderungen. Das Forschungsprojekt eine neue inhaltliche Ausrichtung bzw. Akzentuierung:
EvaBi spielt vor diesem Hintergrund eine wichtige Rolle Inhalte der anerkannten Ausbildungsberufe sollen berück-
bei der Förderung von Menschen mit Behinderungen im 2) Dieser Abschnitt wurde von Roland Stein, Hans-Walter Kranert und Anna Riedl ver-
fasst.
23NDV Januar 2020
Abb. 1: Harmonisierte Bildungsrahmenpläne im Spannungsfeld
sichtigt werden; binnendifferenzierte Bildungsrahmenplä- b) Erwerb bzw. Vertiefung bereits erworbener beruflicher
ne sollen Anwendung finden. Gefordert wird zudem eine Fachkompetenzen, ggf. im Umfang eines anerkannten
Vergleichbarkeit von Bildungsleistungen. Ausbildungsberufes,
3.2 Teilnehmende der beruflichen Rehabilitation c) Persönlichkeitsentwicklung, wobei der Erwerb allge-
Neben den formalen Anforderungen des Leistungsträgers meiner Grundkompetenzen im Vordergrund steht.
hat die Zusammensetzung der Rehabilitand/innen Einfluss
darauf, in welcher Form und mit welchen Zielvorgaben Gestützt wird die Annahme dieser Grundausrichtungen
Berufliche Bildung umgesetzt werden kann. durch die Erhebung biografischer Aspekte im Forschungs-
projekt.3 Menschen mit geistiger Behinderung, welche mit
3.2.1 Unterschiedliche Zielorientierungen n = 90 Projektteilnehmenden der Untersuchungsgruppe
Hinsichtlich der Zielorientierung beruflicher Bildungspro- (UG) und n = 17 Teilnehmenden der Vergleichsgruppe
zesse lassen sich mindestens drei verschiedene Grundaus- (VG) in der betrachteten Gruppe den größten Anteil der
richtungen formulieren, wobei auch Mischformen möglich Werkstattklientel ausmachen, münden meist direkt nach
sind:
3) Das Untersuchungsdesign der Studie ist auf Untersuchungs- und Vergleichsgruppe
a) berufliche Orientierung und Erprobung, ausgelegt; von daher werden im Folgenden die Ergebnisse entsprechend separat
dargestellt.
24Januar 2020 NDV
der Schule in den Berufsbildungsbereich einer Werkstatt Zielorientierung insbesondere die Persönlichkeitsbildung
ein. Ein weitaus geringerer Anteil dieser Personengruppe und der Erwerb von Grundkompetenzen im Vordergrund
hat im Vorfeld an einer berufsvorbereitenden Maßnahme stehen könnten.
teilgenommen. In der Regel bringen Menschen mit geis-
tiger Behinderung somit wenig berufliche Vorerfahrung Die überaus breite Heterogenität der Zielgruppe ergibt
mit, was sich auch darin zeigt, dass der Großteil der Maß- sich somit aus unterschiedlichen vorgelagerten Bildungs-
nahmeteilnehmenden über keinen beruflichen Abschluss und Berufsbiografien; in der Folge ist unter dem Fokus
verfügt. Oberstes Ziel der Bildungsmaßnahme könnte es Beruflicher Bildung ein umfassendes Handlungskonzept zu
für diese Klientel somit sein, sich beruflich zu orientieren etablieren; dabei gilt es insbesondere, den zeitlichen Rah-
und zu erproben. men von 24 bzw. 27 Monaten – verbunden mit dem Auf-
trag der Beruflichen Rehabilitation – zu berücksichtigen.
Deutlich davon abzugrenzen ist die Personengruppe der Ausgehend von diesen Überlegungen stellt sich die Frage,
Menschen mit psychischer Erkrankung (UG: n = 48; VG: inwieweit hBRP einen Beitrag zur systematischen Planung
n = 12), welcher rund ein Viertel der Projektteilnehmenden und Gestaltung von beruflichen Bildungsprozessen leisten
zuzuordnen sind. Sie haben ihre Behinderung in 50 % der können, um so den einzelnen Menschen mit seiner je indi-
Fälle erst im Erwachsenenalter erworben und kommen oft- viduellen Zielperspektive gerecht zu werden.
mals nach längeren Erkrankungsphasen sowie klinischen
Rehabilitationsmaßnahmen in den Berufsbildungsbereich 3.2.2 Spezifische Bedarfe
einer WfbM. Insgesamt sind die Zugangswege und Vorer- Auch hinsichtlich ihrer Ausgangslagen und Bedarfe dif-
fahrungen dieser Klientel sehr vielfältig. Die Schulabschlüs- ferieren die Zielgruppen stark, was ergänzend ein „spe-
se reichen von Förderschulabschlüssen über Haupt- bzw. zifisches (Sonder-)Pädagogisches Handlungsmoment“
Mittelschulabschlüsse bis hin zur allgemeinen Hochschul- erfordert.8 Demnach ist jungen Menschen mit Verhal-
reife. Abgeschlossene drei- bis dreieinhalbjährige Berufs- tensauffälligkeiten, entsprechend ihren meist in vielerlei
ausbildungen sind hier durchaus üblich. In Einzelfällen rei- Hinsicht belasteten Biografie, ein durch „Annehmen“ und
chen die Berufsabschlüsse bis zum Master bzw. Diplom. Im „Verstehen“ charakterisierter Lernort bereitzustellen. Für
Fokus könnten hier gegebenenfalls der (Wieder-)Erwerb Menschen mit geistiger Behinderung, die meist direkt aus
oder die Vertiefung von Fachkompetenzen stehen, die im der Förderschule in eine WfbM kommen, wäre dagegen
Laufe des Lebens bereits erreicht wurden. die Möglichkeit zur „Exploration“ und somit zum Sam-
meln erster beruflicher Erfahrungen zu geben; in Form
Als dritte Personengruppe lässt sich diejenige von Men- eines „adaptiven“ Lernortes müsste hier zudem besonde-
schen mit Lernbehinderung (UG: n = 18; VG: n = 15) her- rer Wert auf die Ermöglichung individueller Bildungswege
ausarbeiten. Kennzeichnend ist hier zum einen das meist gelegt werden. Menschen mit psychischer Erkrankung
junge Alter der Teilnehmenden, welches bei der UG zwi- blickten viel häufiger auf eine Erwerbsbiografie zurück.
schen 17 und 41 Jahren liegt (M = 22,72 Jahre, sd = 6,824 Hier stelle der Eintritt in die WfbM – oftmals direkt im
Jahre)4, sowie der vorangegangene Besuch einer Förder- Anschluss an eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme
schule, entweder mit dem Förderschwerpunkt Lernen oder – in der Regel den ersten Schritt zurück in ein berufliches
mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. Teilneh- Tätigsein dar. Der Lernort sollte für diese Personengruppe
mende, die bereits eine berufsvorbereitende Maßnahme insbesondere „sicher“ (z.B. durch zu bewältigende Lern-
durchlaufen haben, sind hier besonders stark vertreten und Arbeitsaufgaben) und „begleitend“ (z.B. durch Prä-
(27,8 % der UG). Doch auch abgeschlossene drei- bis drei- vention von und Intervention bei Krisen) sein.
einhalbjährige Berufsausbildungen sind insbesondere in
der VG mehrfach vorhanden (53,3 %), wobei hier auffällig Diese kurz skizzierten Überlegungen sind als idealtypisch
ist, dass die Personengruppe insgesamt etwas älter ist zu charakterisieren und bedürfen im Einzelfall unbedingt
(M = 34,4 Jahre, sd = 9,869 Jahre). Möglicherweise handelt der Adaption. Dennoch zeigt dieser Versuch der Systema-
es sich bei Menschen mit Lernbehinderung um einen Per- tisierung deutlich auf, dass je nach Zielgruppe unterschied-
sonenkreis, der Werkstätten vor eine neue Herausforde- liche pädagogische Handlungsprozesse die Bemühungen
rung stellt; so kam eine Studie von Detmar et al.5 zu dem um Berufliche Bildung ergänzen müssen. Hinsichtlich der
Ergebnis, dass „Menschen mit einer Lernbehinderung und hBRP stellt sich die Frage, inwiefern diese bereits den
zusätzlichen Diagnosen sowie Menschen, die eine milieu- Anforderungen einer personenorientierten Förderplanung
bedingte ‚Negativkarriere‘ durchlaufen, bereits Aufnahme
in Werkstätten finden“. Eser6 zufolge besuchten junge
Menschen mit einer Lernbehinderung immer häufiger 4) M = Mittelwert; sd = Standarddeviation oder Standardabweichung.
Schulen mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung. 5) Detmar, W. et al.: Entwicklung der Zugangszahlen zu Werkstätten für behinderte
Menschen, Berlin 2008, S. 6.
Über diesen Weg sowie nach abgebrochenen beruflichen 6) Vgl. Eser, K.-H.: Zugang und Beschäftigung von Menschen mit Lernbehinderung in
Eingliederungsmaßnahmen oder Langzeitarbeitslosigkeit Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM), in: Berufliche Rehabilitation 2016,
gelangten sie zunehmend in WfbM. Nach Wüllenweber7 30 (1), 55–62, 58.
7) Vgl. Wüllenweber, E.: „So richtig behindert, wie die hier so tun, bin ich nicht, ich bin
würden dem Personenkreis seitens der Fachkräfte oftmals eigentlich normal“. Chancen und Probleme von lernbehinderten und sozial benach-
Verhaltensauffälligkeiten zugeschrieben. Aufgrund der teiligten jungen Erwachsenen im Rahmen von Werkstätten für behinderte Menschen,
kleinen Stichprobe kann hier nur eine vorsichtige Vermu- in: Zeitschrift für Heilpädagogik 2012, 63 (9), 389–395, 390.
8) Vgl. Kranert, H.-W.: Berufliche Bildung in Werkstätten – eine kritische Bestandsauf-
tung angestellt werden; teils deuten Biografien des Schei- nahme in Zeiten der Inklusion, in: Walter, J./Basener, D. (Hrsg.): Weiterentwicklung
terns der Teilnehmenden darauf hin, dass hinsichtlich der der Teilhabe am Arbeitsleben für Menschen mit Behinderung, im Druck.
25NDV Januar 2020
im Sinne eines ganzheitlichen Bildungsverständnisses ge- die wirtschaftliche Ausrichtung des Standortes dadurch
nügen. vornehmlich, in welchen Bereichen den Teilnehmenden
des Berufsbildungsbereiches Bildungsangebote offeriert
3.2.3 Psychische Belastung werden können. Auch hBRP werden in der Regel ent-
Verhalten und Erleben haben individuell bedeutsame sprechend den Wertschöpfungsbereichen des jeweiligen
Einflüsse auf Lern- und berufliche Bildungsprozesse.9 Zur WfbM-Standortes ausgewählt und eingesetzt. Dies gilt es
Beurteilung von Auffälligkeiten im Verhalten und Erleben nochmals im Hinblick auf die individuellen Zielorientierun-
wurde im Forschungsprojekt das Inventar der Adult Beha- gen der Teilnehmenden kritisch zu reflektieren.
vior Checklist (ABCL/18-59), ein Teilinstrument der Achen-
bachskalen, herangezogen. Die Einschätzung erfolgte Werden hBRP nachhaltig in Strukturen und Prozesse der
dabei durch die zuständigen Fachkräfte zur Arbeits- und Organisation implementiert, so ist dies für die Werkstätten
Berufsförderung. Das normierte und valide diagnostische zunächst mit erheblichem (Mehr-)Aufwand verbunden.
Verfahren bildet drei übergeordnete Dimensionen ab (in- Dies ergab die Befragung der Leitungsebene in Form
ternalisierende Störungen, externalisierende Störungen von Gruppeninterviews. So wies eine Führungskraft auf
und die Gesamtauffälligkeit). Die Achenbachskalen erlau- Herausforderungen hin, ausgehend vom Berufsbildungs-
ben dabei auf Basis ihrer Vergleichsdaten eine Abgrenzung bereich auch die Arbeitsbereiche der Werkstatt bei der
von „unauffälligen“ zu „grenzwertigen“ Scores – sowie Implementation mit einzubinden:
die prägnante Bestimmung von Werten als „auffällig“ im
klinischen Sinne. Die Auswertung bezieht sich hier auf die „Ich glaube, die größte Herausforderung – der stel-
Darstellung von Werten, die „jenseits von unauffällig“ len wir uns ja gerade nochmal intensiver – ist die Im-
liegen, d.h. sowohl „grenzwertige“ als auch „auffällige“ plementierung in den einzelnen Betrieben [gemeint
Ergebnisse beinhalten. Während bei der UG (n = 177 Teil- sind Standorte der WfbM].“ (Interview UG2, L2)
nehmende) hinsichtlich der Gesamtauffälligkeit 21,5 %
der Fälle „jenseits von unauffällig“ liegen, sind es bei der Des Weiteren wurde die Adaptation der hBRP an die
VG (n = 48 Teilnehmende) 16,8 %. Gegebenheiten der jeweiligen Organisation, und insbe-
sondere die hierzu notwendige fachliche Expertise sowie
Insgesamt zeigt sich somit eine deutliche Belastung der der zeitliche und personelle Aufwand, als besondere
Teilnehmenden, welche es vor dem Hintergrund der Ge- Herausforderung beschrieben. Die dargestellten Aspekte
staltung beruflicher Bildungsprozesse zu bedenken gilt. geben somit erste Hinweise auf zum Teil nicht einfach zu
Werkstätten müssen sich der Frage stellen, worauf (auch bewältigende Konstellationen, die mit der Implementation
im zeitlichen Ablauf der Maßnahmen) der Fokus gesetzt hBRP verbunden sind.
werden soll: auf die Auseinandersetzung mit dem Belas-
tungserleben bzw. den Umgang mit der Beeinträchtigung 3.4 Didaktik und Methodik
und/oder auf Berufliche Bildung. Zudem ist zu klären, Im Hinblick auf die Umsetzungsstrategien Beruflicher Bil-
ob ein erweitertes pädagogisches Setting – im pädago- dung zeigt sich im Kontext von Werkstätten noch weiterer
gisch-therapeutischen Sinne – anzubieten und wie dies Entwicklungsbedarf.12 So ist zukünftig auf didaktischer
ggf. auszugestalten wäre. Ebene systematisch zu klären, wie berufliches Lernen in
und mit heterogenen Gruppen gelingen könne. Aus wis-
3.3 WfbM als Organisation senschaftlicher Perspektive steht ebenso die Entwicklung
Rehabilitation versus Produktion lautet ein viel diskutierter eines „umfassenden didaktisch-methodischen Konzeptes“
bipolarer Zielkonflikt, der sich aus den unterschiedlichen noch aus; dieses müsste sowohl den Bedarfen der Ziel-
Rollen und damit verbundenen Aufgaben der WfbM als gruppe als auch den Anforderungen an Berufliche Bildung
Organisation ergibt. Während den Teilnehmenden der genügen.
Beruflichen Rehabilitation ein Anspruch auf Bildung und
– eben – Rehabilitation zukommt, den es mithilfe eines Diese Einschätzung findet sich in Interviews mit den Fach-
geeigneten pädagogischen Angebotes zu erfüllen gilt, kräften zur Arbeits- und Berufsförderung bestätigt. So
muss die Werkstatt gleichzeitig ihrer Rolle als Anbieter von zeigt sich häufig, dass diese sich auf klassische Unterwei-
Arbeit und als Wirtschaftsunternehmen gerecht werden. sungsmethoden beschränken:
Obgleich Möglichkeiten zur Auflösung dieses Spannungs- „Ich leite fast nur nach der Vier-Stufen-Methode an.
verhältnisses kontrovers diskutiert werden,10 muss sich Weil sich das einfach bei uns als praktikabel und (…)
die Organisation diesem Zielkonflikt stellen, wodurch sich gut erwiesen hat.“ (Interview UG8, F3)
besondere Herausforderungen ergeben. Was die wirt-
schaftliche Betätigung der Werkstätten betrifft, so erfolgt 9) Vgl. Straka, G.: Zur Bedeutung lern-lehr-theoretischer Konzepte für aktuelle didak-
diese in den Bereichen Auftragsfertigung (z.B. industrielle tische Prinzipien der beruflichen Bildung – Kritisch-konstruktive Analyse von
Fertigungsaufträge), Dienstleistungen (z.B. Garten- und „Kompetenz“, „Handlungsorientierung“ und des Stellenwerts von Wissen, in:
Berufs- und Wirtschaftspädagogik online 2013, (24), S. 1–17, 1 f.
Landschaftspflege) und Eigenproduktion (z.B. Garten- 10) Vgl. Thesing, S.: Bildung im Zielkonflikt. Umsetzungsbedingungen des gesetzlichen
möbel).11 Von Werkstatt zu Werkstatt werden Schwer- Auftrags der WfbM, Dissertation, Hamburg 2016, S. 55.
punkte dabei unterschiedlich gesetzt; abhängig ist dies 11) Vgl. Hirsch, S.: Werkstätten für behinderte Menschen, in: Stein, R. (Hrsg.): Integra-
tion in Arbeit und Beruf bei Behinderungen und Benachteiligungen, Baltmanns-
unter anderem vom Wirtschaftsraum, in welchem sich weiler 2009, S. 31–57, 47.
die jeweilige Werkstatt befindet. Letztendlich bestimmt 12) Vgl. Kranert (Fußn. 8).
26Januar 2020 NDV
Der darin zutage tretende eindimensionale Methodenein- 3.6.1 Lebenslanges Lernen
satz kann Anlass zur Weiterentwicklung der implemen- Berufliche Bildung ist zentrales Element des Berufsbil-
tierten didaktisch-methodischen Konzepte und für ihre dungsbereiches; darüber hinaus ist diese jedoch als lebens-
Einbettung in die Weiterbildung der Fachkräfte sein. langes Lernen zu verstehen, was in der Gesamtorganisati-
on zu verankern und durch konkrete Maßnahmen umzu-
3.5 Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung setzen wäre. Trotz der Verortung des Forschungsprojektes
Aus den dargestellten Befunden ergeben sich für das Fach- im Berufsbildungsbereich reicht ein enger Blick auf diese
personal mannigfaltige Problemstellungen. Besondere Her- Organisationseinheit nicht aus, um der Frage nach ange-
ausforderungen entstehen durch die Heterogenität der Ziel- messener Beruflicher Bildung gerecht zu werden. Darüber
gruppe. In dieser begründet liegen zum einen unterschied- hinaus muss Berufliche Bildung im Sinne eines lebenslan-
liche Zielorientierungen der spezifischen Personengruppen, gen Lernens begriffen werden und ist somit auch als Auf-
zum anderen lassen sich daraus spezielle pädagogische gabe der WfbM als Gesamtorganisation zu verstehen. Ein
Handlungsbedarfe ableiten. Zudem konnte festgestellt wer- Bewusstsein darüber, dass Lernen lebenslang stattfindet,
den, dass die Teilnehmenden teils in hohem Maße psychisch offenbarte sich bereits in zahlreichen Interviews mit der
belastet sind. Des Weiteren besteht eine Hauptaufgabe der Leitungsebene sowie mit den Fachkräften zur Arbeits- und
Fachkräfte in der Vermittlung (berufs-)fachlicher Inhalte Berufsförderung:
unter Einbezug binnendifferenzierter Bildungsrahmenpläne
entsprechend den Vorgaben der Bundesagentur für Arbeit. „Also ich würde es noch auf eine andere Ebene he-
Neben einer umfangreichen fachlichen Qualifizierung be- ben. Ich würde sagen, Berufliche Bildung bedeutet
darf es zudem auch eines entsprechenden didaktisch-me- auch immer Persönlichkeitsentwicklung. Das ist et-
thodischen (Handlungs-)Wissens. Für die an der Studie was, das sozusagen den Menschen ausmacht. Dass
teilnehmenden Werkstätten wurde die Qualifikation der er sich weiterbildet. Dass er lebenslanges Lernen hat,
Fachkräfte zur Arbeits- und Berufsförderung in den teilneh- dass er sich entwickelt, in seinem kleinen Umfeld
menden Berufsbildungsbereichen durch einen Fragebogen und auch für sein Leben.“ (Interview UG10, L3)
erhoben. Das Qualifikationsniveau der Fachkräfte kann
dadurch werkstattübergreifend abgebildet werden. Als Vertretung der Menschen mit Behinderung wurde
auch der jeweilige Werkstattrat befragt. Auch hier wurde,
Erste Auswertungen zeigen, dass es sich bei rund der auf die Frage nach der persönlichen Bedeutung Beruflicher
Hälfte der Fachkräfte um Facharbeiter/innen, Gesellinnen/ Bildung, lebenslanges Lernen implizit thematisiert:
Gesellen oder Meisterinnen/Meister handelt. Fachkräfte
mit pädagogischem, sozialem oder therapeutischem Hin- „Dass man immer weiter gefördert wird. Dass man
tergrund finden sich etwa zu einem Viertel, ebenso wie weitergebildet wird. Dass man immer weiter fitter
Fachkräfte mit Mehrfachqualifikationen (aus beiden Be- wird. Dass man mehr aufnehmen kann. Also, dass
reichen). Die Ausbildereignungsverordnung (AEVO) haben man mehr für sich und für die anderen umsetzen
rund ein Viertel der Fachkräfte erworben. Die Ergebnisse kann. Also denen auch noch was beibringen kann
der Untersuchungs- und Vergleichsgruppe unterscheiden oder anleiten.“ (Interview, UG15, W2)
sich dabei nur geringfügig. In Bezug auf Fort- und Wei-
terbildung wäre in jedem Fall eine offene Haltung der Da sich hBRP auf reguläre Ausbildungsrahmenpläne be-
Fachkräfte zu befördern, um den sich wandelnden Anfor- ziehen, welche wiederum den inhaltlichen „Anker“ für
derungen entsprechend zu begegnen. Auf Organisations- drei- bis dreieinhalbjährige Berufsausbildungen darstellen,
ebene stellt die weitergehende Professionalisierung des ist nicht davon auszugehen, dass ein hBRP während der
Fachpersonals eine zentrale Entwicklungslinie dar, ebenso zweijährigen Dauer des Berufsbildungsbereiches in vollem
wie Fragen der multiprofessionellen Kooperation. Daraus Umfang und auf entsprechendem Niveau abgebildet wer-
ergibt sich zugleich ein sozialpolitischer Handlungsbedarf, den kann. Eine mögliche Chance könnte darin bestehen,
die vorhandenen Rechtsvorschriften und Finanzierungs- den Bildungsrahmenplan auch im Arbeitsbereich weiter
konzepte den aufgezeigten Bedarfen anzupassen. einzusetzen und kontinuierlich neue Inhalte zu bearbeiten
sowie Niveauerweiterungen zu realisieren, um die Person
3.6 Berufliche Bildung zu möglichst umfassender „beruflicher Tüchtigkeit“ und
Unser Berufsbildungssystem wird maßgebend durch das „beruflicher Mündigkeit“ zu befähigen.14 Einige Werkstät-
Berufskonzept beeinflusst,13 welches als „zentrale Ord- ten haben diese Chance bereits erkannt:
nungskategorie für das Bildungs-, aber auch für unser
Beschäftigungssystem“ fungiert. (Berufliche) Bildung ist „Natürlich könnte man sich jetzt vorstellen, […] die
jedoch nicht auf Ausbildung beschränkt, sie ist mehr als Pläne dann im Arbeitsbereich fortzuführen. Das ist
das. Es geht um eine selbsttätige Auseinandersetzung mit jetzt noch nicht Pflicht in dem Sinne.“ (Interview
sich selbst und mit der Welt, einer Aneignung von Wissen UG10, L1)
und schließlich auch einer umfassenden Gestaltung eben
dieser Bereiche. Die Diskussion um Berufliche Bildung
ist dabei dichotom – einer verstärkten „Outcome-Orien- 13) Vgl. Kranert (Fußn. 8).
tierung“ mit dem übergeordneten Ziel der „Beruflichen 14) Vgl. Reinisch, H.: Bildung, Qualifikation und Kompetenz in berufspädagogischen
Programmatiken – zur normativen Theorie der Berufsbildung, in: Seifried, J./Bonz,
Handlungsfähigkeit“ (§ 1 BBiG) steht die Forderung einer B. (Hrsg.): Berufs- und Wirtschaftspädagogik. Handlungsfelder und Grundproble-
ganzheitlichen Bildung gegenüber. me, Baltmannsweiler 2015, S. 37.
27NDV Januar 2020
Eine andere Werkstatt hat sich, laut Leitungsebene, in einen Arbeitgeber jetzt nicht, ob das alle Werkstät-
dieser Hinsicht bereits auf den Weg gemacht und erprobt ten machen.“ (Interview UG3, L1)
die Anwendung der hBRP im Arbeitsbereich in Form eines
Pilotprojektes. 4. Diskussion und Ausblick
3.6.2 Zertifizierung von Bildungsleistungen Das Forschungsprojekt EvaBi endet im Februar 2020 mit
Die Frage der Zertifikatsorientierung wurde bei einem einer Abschlusstagung sowie mit einem umfassenden
Projekttreffen mit Vertreterinnen und Vertretern der Werk- Ergebnisbericht. Es zeigt sich aber bereits zum jetzigen
stätten diskutiert. Dabei wurden auch offene Fragen zur Zeitpunkt die Komplexität des Spannungsfeldes, in wel-
Diskussion gestellt. Während sich die Diskussionsteilneh- ches hBRP innerhalb der Werkstätten eingebettet sind.
menden hinsichtlich der individuellen Relevanz und des Den damit verbundenen Herausforderungen stehen aber
Beitrags zur Normalisierung einig waren, stellten sie die auch zahlreiche Chancen zur Weiterentwicklung eines
Frage nach der Wertigkeit und Anerkennung sowie die möglichst breiten Angebotes zur Beruflichen Bildung für
Frage der Vergleichbarkeit in den Raum. Der Beitrag zur Menschen mit Behinderung gegenüber. Mit Blick auf die
Normalisierung von Bildungsleistungen, aufgrund der durchaus heterogene und teils in hohem Maße psychisch
Nähe zur regulären Ausbildung, wurde auch von einigen belastete Zielgruppe gilt es, die Anforderungen des Leis-
Führungskräften als wichtiger Vorteil der hBRP angeführt. tungsträgers zu erfüllen. Hierzu sollte ein möglichst pass-
Der Begriff der „Harmonisierung“ stieß dabei in einzelnen genaues Bildungsangebot bereitgestellt werden, um den
Fällen auch auf Kritik: spezifischen Bedarfen sowie den unterschiedlichen Ziel
orientierungen der Rehabilitandinnen und Rehabilitanden
„Wenn man praktisch den Hauptvorteil, was wir vor- unter Einbezug einer entsprechenden (Sonder-)Pädagogik
her auch gesagt haben, die Anschlussfähigkeit be- gerecht zu werden. Dies erfordert wiederum eine entspre-
züglich aber dem Arbeitsmarkt, da wäre ‚standardi- chende Qualifikation der Fachkräfte, wobei hier besonders
siert‘ oder ‚vereinheitlicht‘ irgendwie verständlicher. der didaktisch-methodische Bereich Potenzial zur Weiter-
‚Harmonisiert‘ ist ‚Werkstattsprache‘ und insofern entwicklung birgt. Insgesamt gilt es, Berufliche Bildung im
‚Werkstattblick‘, da geht es darum, dass Werkstätten Sinne eines lebenslangen Lernens zu verstehen und in der
alle das gleiche anwenden. Aber das interessiert ja Werkstatt als „Ganzes“ zu realisieren.
Anzeige
Soziale arbeit
Jetzt auch mit
Campuslizenz
!
für Hochschulen,
bibliotheken und Die renommierte
Fachzeitschrift
organisationen Unabhängig,
kritisch, innovativ
11x jährlich
bestellung
1. 2020 beim Deutschen
zentralinstitut
für soziale Fragen
bernadottestr. 94
Netzwerk-
Der Familienrat als 14195 berlin
raum | 2
potenzial im Sozial e-Mail:
tum und
zwischen experten sozialinfo@dzi.de
ziehung | 9
Verantwortungsbe www.dzi.de
Wann ist Ki ok? | 16
interaktion und
GrafikBüro 12/2019
themenzentrierte
e im Dialog | 22
Positive Psychologi
28Sie können auch lesen