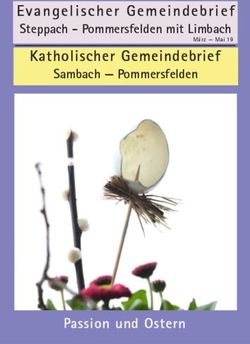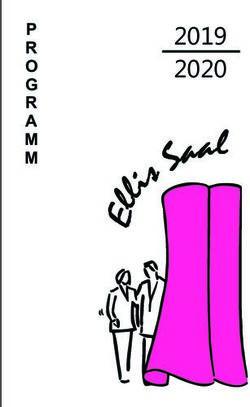Harry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Harry Potter, die Insel und die schwierige Idee
der Universität
Über alte Wahrheiten und deren Aktualität
I.
Sie fragen1 nach meinem Bild, meiner Metapher für das Wesen der Wis-
senschaft. Ihre Frage beschäftigt mich seit einiger Zeit, aber mir fallen nur
Antworten und Vorstellungen ein, die mich nicht überzeugen. – Also ver-
suche ich es einmal umgekehrt, auf dem alten Königsweg der sokratischen
Philosophie, per negationem: Warum ist Wissenschaft etwas grundsätzlich
anderes als – meinetwegen «weisse» – Magie?
Weshalb liefern Harry Potter, seine Freunde und die Lehrer auf Hog-
warts Castle kein passendes Bild für das, was die moderne Wissenschaft ist,
und keine fruchtbare Metapher für die Art, wie sie in der Gesellschaft
wirkt? – Man erwidert (und ich habe den Verdacht, dass das fast automa-
tisch, also ziemlich unbedacht geschieht), weil Wissenschaft eben etwas
Rationales, methodisch Verständliches, ganz und gar vernünftig Durch-
schaubares ist. Wissenschaft will Licht, Klarheit für jeden, Überprüfbarkeit
durch nüchternen Verstand, während Hexerei, Alchemie und Geisterbe-
schwörung nur Veranstaltungen in jenem Dunkel sind, wo Aberglauben,
Wahn und Verstörung hausen.
Doch machen wir es uns damit nicht allzu einfach? Schliesslich geht
auch Harry Potter auf eine hoch angesehene «Zaubertechnische Hoch-
Georg Kohler, Prof. Dr. phil. und lic. iur: Nach dem Studium der Philosophie und der
Rechtswissenschaft in Zürich und Basel, einigen Assistenzjahren während des Dokto-
rats und der Vorbereitung der Habilitation, war er von 1983 bis 1991 in der Leitung
eines Familienunternehmens in Wien tätig und arbeitete ausserdem als freier Publizist
(v.a. für die «Neue Zürcher Zeitung»). 1992–1994 lehrte er Politische Philosophie und
Theorie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Seit 1994 ist er ordentli-
cher Professor für Philosophie an der Universität Zürich.100 Georg Kohler
schule (ZTH)», lernt wiederholbare Formeln und den Umgang mit ihren
Effekten, experimentiert und sinniert über den Unterschied zwischen der
Empirie und seinen theoretischen Erwartungen hinsichtlich der Gültigkeit
von Zaubersprüchen.
Aus magischem, nur den wenigen Eingeweihten zugänglichem Wissen
resultieren Dinge, die für den Alltagsverstand unmöglich erscheinen. Doch
das ist allerdings auch bei dem Wissen der Fall, das in und hinter all den
technischen Geräten steckt, die wir so selbstverständlich wie verständnis-
los benutzen; ohne Sinn für die Naturzusammenhänge und mathemati-
schen Wahrheiten, die ihr Funktionieren sichern. Ausserdem bleiben selbst
(oder gerade) den nachdenklichsten (Natur-)Wissenschaftlern elementare
Fakten und Kräfte (von der Gravitation über die Elektrizität bis zur Inter-
pretation der quantentheoretischen Gleichungen2, wenn sie ehrlich sind,
ganz und gar rätselhaft. Die Grundformen und -tendenzen der so genannt
«objektiven» Natur begegnen uns daher immer noch als etwas, das seinem
tieferen Wesen nach undurchdringlich ist und bloss in seinem Verhalten
berechnet und dadurch für menschliche Absichten und Wünsche nutzbar
gemacht werden kann.
Nicht anders ergeht es Harry, Ron und Hermine, wenn sie von Profes-
sor Dumbledore, Professor McGonagall, Gilderoy Lockhart und all den an-
deren gelehrt bekommen, wie man beispielsweise junge Alraunen umtopft,
deren Zauberkraft nicht zuletzt darin besteht, Verrücktgewordene («Ver-
wandelte und Verfluchte», wie sich Professor Sprout ausdrückt) in ihren ur-
sprünglichen und gesunden Zustand zurückzubringen, um also etwas
Ähnliches zu produzieren wie das, was uns Roche, Novartis und Life scien-
ces mit Hilfe von Psychopharmaka zu erzielen versprechen. Wo also ist die
Differenz?
Je länger ich mir die Sache in dieser Weise zurechtlege, desto eher muss
ich gestehen: nirgends! Womit ich, zu meiner Verblüffung und obwohl ich
gerade das Gegenteil ereichen wollte, bei einem ersten Sinnbild für Wis-
senschaft und wissenschaftliche Technik angelangt wäre, nämlich beim
Bild der «weissen Hexe». (Allerdings, das zu Ihrer Beruhigung, werde ich
seine Triftigkeit auch wieder in Frage stellen.)102 Georg Kohler
II.
Die Wissenschaft ist die weisse Hexe; die Magierin der Vernunft, Nutrition
Ivy, die gute Schwester von der bösen Poison Ivy3, weil sie ihre Dominanz
über Naturvorgänge und die Gesetze der Realität nicht verwendet, um je-
mandem zu schaden oder um persönliche Machtgelüste zu befriedigen,
sondern weil sie ihre Kräfte einsetzt zum Nutzen der Sterblichen und zur
Verbesserung von deren Lebensumständen. Wem sie die nötige Intelligenz
und die moralische Qualität zutraut, dem gibt sie ihr Wissen weiter und zu-
gleich die Methoden, mit deren Hilfe das Wissen sich vergrössern lässt.
Die weisse Magierin Wissenschaft begründet keinen Geheimbund ar-
roganter Weltverbesserer. – Klingt ganz schön und plausibel, nicht? (Aber
natürlich bin ich, wie man bald sehen wird, nicht der Meinung, dass wir da-
mit schon zufrieden sein dürfen.) Immerhin hat unser Bild von Nutrition
Ivy den Vorteil, im Einklang zu stehen mit der berühmtesten und einfluss-
reichsten Metapher, die die neuzeitliche Philosophie für die Funktion und
das Selbstverständnis der modernen (Natur-)Wissenschaft erfunden hat,
nämlich mit der Metapher von der Wissenschaft als Machthaberin.
«Wissen ist Macht.» Es ist Francis Bacon (1561–1626) gewesen, der in
vielen Farben schillernde Baron von Verulam, der diesen Slogan sowohl ge-
prägt wie zugleich durch eine Methodologie untermauert und schliesslich
in eine gesellschaftsreformerische Erzählung, nämlich in die utopische Fi-
gur der Insel «Neu-Atlantis»4, übersetzt hat. «Nova Atlantis» ist die Frag-
ment gebliebene Darstellung eines vollkommenen Staatswesens und einer
in sich geschlossenen, denkbar bestens funktionierenden Gesellschaft, de-
ren Bestand und Zukunft durch die Leistungen der von Bacon entworfe-
nen, empirisch-rationalen, induktiven und experimentellen Methode der
Wissenschaft und durch die wachsende Fülle ihrer technisch anwendbaren
Ergebnisse gesichert wird. Was Bacon skizziert, ist nichts anderes als die –
in den fiktiven Bericht über eine im Pazifik gelegene insulare Gemeinschaft
gefasste – Konkretisierung der Idee vernünftig-wissenschaftlicher, buch-
stäblich «techno-kratischer» Selbstbestimmung des Menschen; die Idee ei-
ner vom unbedingten Vertrauen in die Macht menschlichen Wissens ge-
tragenen Ordnung, wo wir Menschen dank der weissen Zauberin VernunftHarry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität 103
uns in die weisen Herren der Natur und unserer Geschichte zu verwandeln
fähig sind.
Ich kann hier die baconistische Utopie5 weder in ihren oft überra-
schend treffsicheren Prognosen hinsichtlich der Möglichkeiten des techni-
schen Fortschritts referieren, noch will ich genauer analysieren, weshalb
diese technokratische Utopie eben in der Tat ein «Utopia», also ein «Nir-
gendwoland», bleiben musste. Doch sind wenigstens einige Feststellungen
zu treffen, die hinreichend deutlich erklären, was das Utopische, und das
meint nun: das Realitätswidrige, von Bacons wissenschaftsgläubigem Welt-
bild verschuldet.
Es sind drei Annahmen, die zum Kern des baconistischen Rationa-
litätskonzepts gehören. Erstens die Annahme der dauerhaften Kontrollier-
barkeit von Wissen und Wissenswachstum; zweitens die Annahme, Politik
sei auf die Lösung von wissenschaftlich-technischen Problemen zu redu-
zieren; drittens die Annahme, die Motive des Wissen-Wollens zuverlässig
nach Graden von Sinnkräftigkeit sortieren zu können. Von diesen Voraus-
setzungen lebt Bacons technokratischer Optimismus, und wenn wir über-
legen, worin sein basaler Fehler besteht, erkennen wir endlich, was alles an
der Figur der Nutrition Ivy und an der Metapher einer planvoll-vernünftig
regulierbaren, insularen Praxis eben doch falsch ist. Die Genese und die
Stellung des wissenschaftlichen Geistes in der Welt lassen sich mit solchen
Sinnbildern bestenfalls partiell erfassen. Das möchte ich im nächsten Ab-
schnitt zeigen, und ich bitte um Entschuldigung, wenn es jetzt eine Zeitlang
sehr abstrakt und reflexiv zugeht.
III.
Um Bacons Grundfehler auf einen Begriff zu bringen: Er liegt in der Idee
der eindeutigen Grenzsetzung oder Trennbarkeit, und zwar der Separier-
barkeit unter mindestens zwei Aspekten; nämlich einerseits im Hinblick
auf das Verhältnis zwischen der Wissenschaft und ihrem «Objekt», der in-
neren Gesetzlichkeit der Wirklichkeit, anderseits im Hinblick auf das Ver-
hältnis der Wissenschaft zu ihr selber und zu ihren eigenen Produktions-
bedingungen.104 Georg Kohler
Betrachten wir nur die erste der drei genannten Annahmen. Vorhan-
denes, technisch umsetzbares Wissen ist nichts, was sich (beispielsweise
deswegen, weil sein Gebrauch unerwünschte Konsequenzen haben könnte)
einfach wegsperren und dadurch unschädlich machen lässt. Wissen, einmal
da, ist nur dann wieder aus dem Verkehr zu ziehen, wenn alle Personen, die
es zu erwerben imstande sind, einer lückenlos arbeitenden Gedankenpoli-
zei unterworfen werden können; was an sich schon fast unmöglich ist. Ge-
setzt aber, es gäbe eine solche Polizei, dann dürften wir auch sofort voraus-
sagen, dass mit ihrer durchschlagenden Tätigkeit nicht bloss ein
bestimmter Wissensstoff, sondern bald alle wissenschaftliche Kreativität
und damit der Wissensfortschritt als solcher zum Verschwinden gebracht
würden.
Erfolgreiche Wissenschaft ist ein ständiger Prozess, doch Wissenschaft
vermag ihren Fortgang niemals selber so zu begreifen, wie sie die Bewe-
gungen der Objekte ihrer – der realen Welt im Übrigen stets nur annähe-
rungsweise gleichenden – Idealwelt zu berechnen imstande ist. Die Wis-
senschaft und ihre Vitalität sind nichts, was sich beherrschen lässt wie
Kugeln auf einem Billardtisch. Ihr Zuwachs, ihre Erweiterung und ihre Er-
neuerung verdanken sich einer Originalität, deren Quellen nicht objekti-
vierbar und darum nicht kontrollierbar und mithin nicht abtrennbar sind
von den Zufällen, Unwahrscheinlichkeiten, Überkreuzungen, Multikausa-
litäten und von den geistig-sozialen, dem deterministischen Denken so-
wieso entzogenen Bewusstseinsfaktoren, die die Welt formen, in der wir
tatsächlich leben.
Der baconistische Wissensbegriff scheitert also, wenn er auf sich selber
angewendet wird. Und er scheitert ebenso, wenn das Verhältnis zwischen
Wissenssubjekt und -objekt, das er unterstellt, mit dem tatsächlichen Ver-
hältnis zwischen Erkennen und Welt präziser verglichen wird.
Man kann den Punkt, um den es hier geht, vielleicht mit einem Satz
kennzeichnen: Kein Wissen und kein Wissenwollen ist «unschuldig», rein,
separat und frei von sehr praktischen, geschichtlich-kontingenten Um-
ständen, die jeweils seine Forschungsperspektiven und erkenntnisermögli-
chenden Präsuppositionen festlegen. Forschungsleitende und erkenntnis-Harry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität 105
eröffnende Basistheoreme, in deren Licht erst die Gegebenheiten der
alltäglichen Erfahrungswelt zu Fakten der Wissenschaft werden, sind
selber schon das Ergebnis unübersichtlicher, manchmal plötzlich aufge-
tauchter, manchmal langsam und intransparent gewachsener Problemati-
sierungsweisen, deren Gründe und Ursachen allemal auf jene vorwissen-
schaftliche und soziale Wirklichkeit zurückweisen, die doch durch die
Wissenschaft erst richtig, unvoreingenommen und neutral beschrieben
werden soll.
Entdeckt man die erwähnten Rückkoppelungen, dann erweist sich die
baconistische Version einer zwar strengen, gleichwohl aber neutralen
Wahrheitsbefragung der Natur als Illusion. Wissenschaft ist immer schon
und bleibt unvermeidlich in dieselbe Wirklichkeit verstrickt, die sie zu-
gleich untersucht, kategorisiert und erläutert.
Jede Wissenschaft, ob Natur- oder Sozial- oder Geisteswissenschaft, ist
darum von vornherein auch als kulturelle Praxis zu bestimmen, unlösbar
verbunden mit dem Wandel geltender Anschauungen, Interessen und
Wirklichkeitsentwürfe, angewiesen auf die Resonanz ihrer Erträge bei den
tonangebenden Schichten des Publikums, und dabei zugleich selber wert-
setzend, kulturprägend und wirklichkeitsgestaltend.
Ich denke, man versteht jetzt, weshalb ich meine, dass die am Anfang
vorgeschlagenen Sinnbilder – Nutrition Ivy und das Nova Atlantis der Er-
leuchteten – nicht recht stimmen können. Weder das Bild einer klar vom
Ozean des Nichtwissens abgegrenzten Insel, noch das Bild der weissen
Hexe, die über und ausserhalb der ihrem Vermögen gehorchenden Dinge
schwebt, treffen das Wesen derjenigen Wissenschaft, wie sie sich realiter
vollzieht. Die Frage ist nur, was wir mit dieser Einsicht anfangen.
IV.
Jede Metapher, selbst die beste, ist ungenau und in irgendeiner Hinsicht
verdeckend statt erhellend. Doch das andere gilt gleichermassen. Meta-
phern sind mehr oder weniger gelungene Versuche, einem etwas zu verste-
hen zu geben. Was also lässt sich trotz allem lernen von Nutrition Ivy und
Nova Atlantis?106 Georg Kohler
Ich will die Frage behandeln, indem ich mich zugleich mit dem be-
schäftige, wonach Sie sich an zweiter Stelle erkundigen; nämlich mit dem,
was eigentlich die «Universität» als die hauptsächliche Organisationsgestalt
von Wissenschaft kennzeichnen muss.
Die Institution der europäischen Universität hat eine lange, im Mittel-
alter beginnende Geschichte; ihre entscheidende, in Grundzügen auch
heute noch verbindliche Erneuerung erhält sie aber im 19. Jahrhundert.6
Dabei ist es keineswegs so, dass in dieser Periode bloss ein einziger Hoch-
schultyp erprobt worden wäre.
«Grossbritannien ging einen eigenen Weg, auf dem diverse Hoch-
schulformen nebeneinander entstanden. Auf dem Kontinent konkurrier-
ten gleichzeitig zwei konträre Modelle: das französische und das im
deutschsprachigen Raum entwickelte, das wir meist das Humboldtsche
nennen. (…) Das französische Modell fand zwar Anklang in Süd- und
Osteuropa, doch durchgesetzt hat sich, national jeweils modifiziert, das
deutsche. (…) In Deutschland, in Österreich und in der Schweiz bildete sich
ein Universitätstypus heraus, der schliesslich um die Wende zum 20. Jahr-
hundert ebenso auch in den USA und in Japan das eigentliche Ideal der
modernen Universität verkörperte.»7
Den Kern dieses Ideals fixieren drei Forderungen: Die Universität ist
ein rechtlich garantierter Ort freier Wissenschaft, der vom Staat zwar er-
möglicht wird, zugleich aber unabhängig bleibt von den Zugriffen exter-
ner, staatlicher oder privater Macht, die weder Einfluss auf den inneren Be-
zirk der Forschung noch auf den der Lehre hat. Zweitens stehen Lehre und
Forschung in einem dichten und kontinuierlichen Konnex. Schliesslich gilt
der Wert der studentischen Eigenverantwortung. Sie markiert den dritten
Eckpunkt in der Trias der akademischen Freiheit von Forschung, Lehre und
Studium.
Dieses Modell, das die Universität als komplexe, aber in sich selber zen-
trierte und sinnvolle Einheit methodischer Wissensgewinnung, Begabtes-
tenausbildung und autonomer Wahl der Wissensfelder definiert, wurde
im 20. Jahrhundert zur primären Grundlage des wissenschaftlich-techni-
schen Fortschritts und zum Orientierungsgehalt an der Spitze des gesam-Harry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität 107
ten Bildungssystems. Und dieses Modell war zugleich «die notwendige
Voraussetzung, um den Aufstieg der modernen Naturwissenschaften in
den Rahmen der Universitätsorganisation zu integrieren»8. Denn es erwies
sich als flexibel genug, um der Expansion und den unvorhersehbaren Wen-
dungen der Wissensentwicklung zu entsprechen.9
Die historische Beschäftigung mit dem Erfolgsmuster der europäi-
schen Universität lehrt im Übrigen, dass es, entgegen der verbreiteten Mei-
nung, die mit dem Namen «Humboldt» verknüpft ist, keiner Gesamtpla-
nung entsprang und sich in steter Konkurrenz mit den anderen Typen
formte, in deren Gestaltung es ebenso hineinwirkte, wie diese umgekehrt
seine eigene Evolution beeinflussten.
Nicht zentrale Regulierung und Homogenisierung erklären die Ge-
schichte und die success story der europäischen Universität der Moderne,
sondern ein autonom geführter Wettbewerb der Strukturen, der, bei aller
evolutionär geschehenden Angleichung der institutionellen Organisati-
onsmerkmale, dezentrale und lokale Neuerungen, Abweichungen und Of-
fenheit für situationsgemässe Lehr- und Forschungsprofile gestattete.
Das ist eine Erkenntnis, deren Wichtigkeit in unserer aktuellen Bolog-
narevolution10 kaum unterschätzt werden kann.
V.
Und was soll das mit Nutrition Ivy und Nova Atlantis zu tun haben? Wohl-
wollend interpretiert versinnbildlichen die beiden Metaphern auf je ver-
schiedene Weise zwei fundamentale normative Gedanken, die nach wie vor
beachtlich sind. Der erste Gedanke ist der der selbstverantwortlichen Frei-
heit der Lehrenden, Lernenden und Forschenden. Von ihm spricht etwa
Francis Bacon dann, wenn er die Autonomie des auf Nova Atlantis befind-
lichen «Hauses Salomons» – der «Universität» der Insel – erläutert: In
«Nova Atlantis» existieren keinerlei von aussen steuernde Instanzen, die
festlegen, was forschungsrelevant ist und was nicht. Die Kompetenz dazu
liegt einzig und allein bei den Mitgliedern des Hauses selbst. Der zweite Ge-
danke ist der der Nutzenfolgen, die sich aus dem Selbstzweckcharakter des
Wissenwollens ergeben; curiositas, Neugierde, Wissensdurst erzeugt «Rele-108 Georg Kohler
vanz», gesellschaftlich brauchbare Güter und Kenntnisse, und nicht umge-
kehrt produziert «Relevanz» curiositas. Denn wer schon zum Voraus zu
wissen glaubt, was relevant ist und was nicht, der ist, ob er es will oder nicht,
ständig in Gefahr, durch seine externen Kriterien die Quellen von Kreati-
vität und Originalität zu verstopfen und auszutrocknen, statt sie freizule-
gen und zu erweitern.
Nutrition Ivy, die weisse Hexe, ist «weiss», da sie eben nicht jegliches
Tun unter dem Bann der eigennützigen Verwertbarkeit betrachtet. Und
exakt darum erschliessen sich ihr wie von selber die Geheimnisse der Natur
und besitzt sie das subtile Gehör, den achtsamen Blick für die feineren
Winke der Dinge, weil sie frei ist von den unmittelbaren Zwängen der Ge-
winnmaximierung und der Erwirtschaftung fristgerechter Investitionsren-
diten. Während Nutrition Ivy also lehrt, dass die Wissenschaft und ihr Be-
trieb nicht in der Art eines marktökonomischen Unternehmens zu planen
sind, zeigt, komplementär dazu, die Situierung des «Hauses Salomons» in
der Gesellschaft von Nova Atlantis, dass die Wissenschaft und ihr Betrieb
stets auf einen nicht durch sie selber, sondern durch Politik und Zivilsinn
gestifteten und geschützten Spielraum angewiesen bleiben; auf einen freien
Bereich, der allein jene Selbstorganisation erlaubt, die so dauerhafte wie
flexible und anpassungsfähige Strukturen zu finden vermag, wie sie bei der
gegebenen Eigenlogik der Wissenssuche und -vermittlung nötig sind.
VI.
Es sind zweifellos alte Wahrheiten, an die ich erinnert habe. Nichtsdes-
totrotz sind sie auch heute zu respektieren. Das ist eine Aussage, die auf vie-
lerlei Weise einen Übergang in die gegenwärtigen Debatten verschafft. Auf
zwei Foci dieser Diskussion möchte ich ausdrücklich zu reden kommen:
auf das Thema der vom Stil der postindustriellen «Zweiten Moderne» ver-
langten wissensgesellschaftlichen Universität und auf die Idee eines von
den Schwerfälligkeiten universitätstypischer Organisationsstrukturen los-
gelösten Netzwerkes von Forschungs- und Lehrteams.
Wer heute auf eine enge Verflechtung zwischen universitärer Institu-
tion und gesellschaftlichen und ökonomischen Erwartungen drängt, hatHarry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität 109
das Gewicht der herrschenden Stimmung auf seiner Seite. «Die Globalisie-
rung der Wirtschaft und die Verschärfung der Konkurrenz schaffen eine
neue Interdependenz zwischen der Wirtschaft und der Universität (…).
Die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit zeigt sich etwa im
Erfordernis ausgebauter Postgraduierten-Studiengänge, die von bedeuten-
den Beiträgen aus der Privatwirtschaft profitieren könnten, sowie in der
Zunahme von gemischten Forschungsprojekten (…). Jedoch, dieser
Annäherungsprozess wird immer noch durch die Kultur der Universitäten
und ihre Funktionsregeln allzu stark gebremst.» Zitiert wird der Schweize-
rische Staatssekretär für Forschung und Wissenschaft, Charles Kleiber.11
Und es ist nicht so, dass er nicht gute Gründe anführen könnte für seine
Mahnungen. Nämlich die Einsicht in die Natur des insgesamt veränderten
Zivilisationsprozesses, der die Welt des 21. Jahrhunderts charakterisiert:
Akzeleration der Produktionszyklen durch den grösseren Wettbewerbs-
druck; verzweigte Berufskompetenzen, die, wegen der genannten Be-
schleunigungstendenz ein ständiges Nach- und Neulernen brauchen; die
zunehmende Schwierigkeit, zwischen angewandter, von externen Bedürf-
nissen getragener und der vom Eigensinn der Wissenschaft bestimmten
Grundlagenforschung zu trennen. Das sind nur einige Stichworte, die un-
terstreichen, warum es mit den Rezepten des 19. Jahrhunderts allein nicht
mehr geht.
Allerdings sollte man, bei aller Anerkennung der für die «Zweite Mo-
derne» typischen Kräfte, die alte Wahrheit nicht verdrängen, die, um es ein
bisschen antiquiert, aber dennoch richtig zu sagen, zum Wesen des
menschlichen Geistes gehört und die erinnert, dass Inspiration, Kreativität
und ansteckende Wissenslust verloren gehen, wo zu viel vorgespurt und
vorgegeben ist. Ohne Gleichgewichtssinn, der die gute Mitte zwischen den
neuen Dringlichkeiten und den alten Wahrheiten zu finden weiss, ist die
zeitgemässe Idee der Universität nicht zu formulieren.
Das erweist auch das zweite Beispiel, auf das ich noch hinweisen
möchte. Mein Zürcher Kollege Bruno S. Frey hat im vorliegenden Band12
das interessante Bild von privat organisierten, unabhängigen Forschungs-
teams entworfen, die sich in Opposition gegen eine mehr und mehr regu-110 Georg Kohler
lierte, an ökonomischen und wissenschaftsexternen Zwängen orientierte
Universitätsordnung herausbilden könnten. Frey versteht seinen Beitrag
sogar als Prognose: «Erfolgreiche Forscher und Forscherinnen werden
nicht mehr einer bestimmten Universität angehören, sondern sich auf dem
internationalen Markt bewegen. Sie werden gleichzeitig Projekte an unter-
schiedlichen Universitäten betreiben, (weil sie) Alternativen innerhalb und
ausserhalb des herkömmlichen Systems besitzen. Eine einzelne Universität
kann ihnen deshalb kaum noch Vorschriften machen, weil sie sonst ganz
abwandern. Nachwuchswissenschaftler bewerben sich darum, in die besten
Teams aufgenommen zu werden. Sie wissen, dass sie dort an die Front der
Forschung geführt werden und die besten wissenschaftlichen Kontakte er-
halten.»13
Frey meint all dies sowohl feststellend wie empfehlend. Sein berechtig-
ter libertärer Ärger über die kurzsichtige Bereitschaft von vielen Politikern
und Bolognareformern, die Universität als Unternehmen primär unter Ge-
sichtspunkten der profitökonomischen Betriebswirtschaftslehre vorantrei-
ben zu wollen, beflügelt seine soziale Phantasie, die durchaus mit soliden
Beobachtungen über faktische Veränderungen befestigt werden kann.
Trotzdem will ich im Namen meiner alten Wahrheiten auf zwei kritische
Argumentationsmöglichkeiten nicht verzichten.
Ich glaube, dass Freys Vorschlag einerseits die auch für ihn wichtige
Bedeutung der bisherigen, mit der Idee einer starken organisationellen
Zusammengehörigkeit verbundenen Universitätsinstitution unterschätzt,
andererseits allzu leichtfertig eine Zweiteilung der akademischen Welt in die
geschmeidig-innovative Liga der kosmopolitanen Wissenschampions und
in die schwerfällige Schar der überregulierten Durchschnittsbildungsan-
stalten in Kauf nimmt. Wenn die Werte der akademischen Freiheit einmal
soweit missachtet sein sollten, dass sie überhaupt nicht mehr für die so ge-
nannte «Massenuniversität» gelten (die doch auch die Basis bietet für die
durchlässig-luftigen Lofts auf den obersten Etagen), dann bin ich mir ziem-
lich sicher, dass die Spielräume für freie Geister überall schrumpfen und
brüchig werden; sei es wegen finanzieller, sei es wegen kultureller Defizite.
Und wenn die ehrwürdige Trias der Einheit von Forschung, Lehre und stu-Harry Potter, die Insel und die schwierige Idee der Universität 111
dentischer Selbstverantwortung im Säurebad von BWL-Rationalität und
bürokratischer Übereifrigkeit ganz und gar aufgelöst werden sollte, dann
steht es schlecht nicht nur mit den Herkunftschancen für Freys ehrgeizige
Nachwuchstalente, sondern ebenso mit den Möglichkeiten, motivierende
Lehrer und motivierte Lernende in den mittleren Rängen der ja immer
noch «Hochschulen» geheissenen Bildungsbereiche zu erhalten. Was mich
mein altes Lied anstimmen lässt, dass die Wahrheiten der europäischen
Universitätsidee zwar immer wieder in die gewandelten Umstände ihrer
zeitgenössischen Realisierungsbedingungen eingearbeitet, nie aber verges-
sen werden sollten.
VII.
Sie haben mich nach meiner «Vision» der Wissenschaft gefragt und nach
der daraus ableitbaren Gestalt der Universität. Und Sie haben gesehen, wie
ich mich zwar darum bemühte, aber zu einem umfassenden Bild nicht ge-
kommen bin. Allenfalls die beiden Gedankenfiguren eines Überlegungs-
gleichgewichts und des patchworks zwischen alten und neuen Elementen
der zweihundertjährigen europäischen Universitätsdiskussion würden mir
durchgängig gefallen, doch das wären höchstens «Bilder zweiter Stufe»,
«Meta-Bilder». Dass aber einzig solche Vorstellungen der Sache angemes-
sen erscheinen, ist kein Zufall. In ihrer Offenheit und anschaulichen Un-
anschaulichkeit spiegeln sie die Beweglichkeit und die paradoxe Daseins-
form – die Wirklichkeit – dessen, was wir «die Wissenschaft» nennen: dass
diese stets nur ein Teil unserer allgemeinen kulturellen Praxis ist, der sie
doch auch entrinnen muss, um sie erkennen und verbessern zu können.
Anmerkungen
1 Im Brief, der mich zum Schreiben dieses kleinen Essays einlud, wurden als mögli-
ches Thema u.a. die folgenden Fragen gestellt: «Welches ist Ihr Bild, Ihre Metapher,
für das Wesen der Wissenschaft? Ist die Wissenschaft zum Beispiel ein ‹Netzwerk›
oder eine ‹Leiter zum Licht› oder ‹eine rabiate Inquisitorin, die die Natur streng be-
fragt›, ... usw. Was verstehen Sie – im Horizont Ihrer Antwort auf die obige Frage –
noch unter dem Begriff der ‹Universität›? Ist es einfach ein Sammelname für die
betriebswirtschaftlich-organisationelle Integration ganz diverser wissenschaftli-112 Georg Kohler
cher Disziplinen und Methoden? Oder meint ‹Universität› noch etwas anderes?»
2 So etwa der Physiker und Philosoph C. F. von Weizsäcker, der mir in einem langen
Gespräch erklärte, die Interpretation der quantenmechanischen Gleichungen sei
nach wie vor ein vollkommenes Rätsel, vgl. «Unterwegs. Ein Gespräch mit C. F.
von Weizsäcker», geführt von Georg Kohler zusammen mit Sven Murmann, in:
H. Holzhey/G. Kohler (Hg.), In Erwartung eines Endes. Apokalyptik und Geschichte,
Zürich 2001, S. 155–174.
3 Nutrition Ivy ist eine Erfindung von mir. Inspiriert hat mich dazu die Gestalt der
tückischen grünen Elfe und Verführerin, die in Batman II, gespielt von Uma
Thurman, den Begleiter und Gehilfen des heldenhaften Fledermausmannes in
ärgste Nöte bringt. Poison Ivy, wie diese Figur heisst, ist egozentrisch, destruktiv
und ein Unglück für alle gewöhnlichen Sterblichen, die mit ihr zu tun bekommen.
Als das genaue Gegenteil hat man sich Nutrition Ivy vorzustellen; in einem Film
würde ich ihre Rolle durch Michelle Pfeiffer besetzen oder, noch besser, durch
Sandra Bullock.
4 In deutscher Übersetzung greifbar zum Beispiel (zusammen mit den zwei anderen
berühmten Utopien der Neuzeit, nämlich Thomas Morus’ Utopia und Tommaso
Campanellas Sonnenstaat) in: Der utopische Staat, hg. von K. J. Heinisch, Reinbek
bei Hamburg 1960.
5 Vgl. dazu das einschlägige Kapitel in: Richard Saage, Utopien der Neuzeit, Darm-
stadt 1991.
6 Vgl. zum Folgenden den Zürcher Vortrag vom 30.11.2004 von Dieter Langewie-
sche: Die Geisteswissenschaften im gegenwärtigen Umbau der europäischen Uni-
versitäten, aus dem ich auch zitiere: www.tausendworte.de; dort zu finden unter
«Langewiesche». Vgl. ausserdem: Universität ohne Zukunft, hg. von D. Kimmich et
al., Frankfurt am Main 2004.
7 Langewiesche, Zürcher Vortrag, S. 3.
8 A.o.O., S. 4.
9 A.o.O., S. 6f. In diesem Zusammenhang ist besonders interessant, was Langewie-
sche über die Rolle der Privatdozenten sagt, S. 7.
10 In vielen Ländern wird diese Evolution vor allem von eifrigen staatlichen Bil-
dungsbürokratien befeuert, während sie in der Schweiz zusätzlich durch den pri-
vatwirtschaftlich-ökonomisch ausgerichteten Think Tank von Avenir Suisse beein-
flusst wird.
11 Charles Kleiber, Die Universität von morgen. Visionen, Fakten, Einschätzungen, Bern
1999, S. 25.
12 S. 83–89.
13 Ich zitiere aus dem Artikel, der in der «NZZ am Sonntag» am 17.10.2004 veröf-
fentlicht worden ist, S. 22.Sie können auch lesen