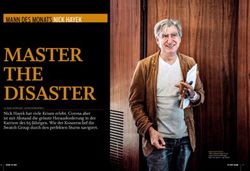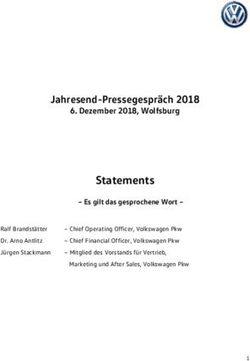Poenicke, Anke Gibt es Stämme in Afrika? Hinweise zur Darstellung eines Kontinents
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Poenicke, Anke Gibt es Stämme in Afrika? Hinweise zur Darstellung eines Kontinents ZEP : Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 27 (2004) 1, S. 27-31 urn:nbn:de:0111-opus-61417 in Kooperation mit / in cooperation with: http://www.uni-bamberg.de/allgpaed/zep-zeitschrift-fuer-internationale-bildungsforschung-und-entwicklungspaedagogik/profil Nutzungsbedingungen / conditions of use Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. Die Nutzung stellt keine Übertragung des Eigentumsrechts an diesem Dokument dar und gilt vorbehaltlich der folgenden Einschränkungen: Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder anderweitig nutzen. We grant a non-exclusive, non-transferable, individual and limited right to using this document. This document is solely intended for your personal, non-commercial use. Use of this document does not include any transfer of property rights and it is conditional to the following limitations: All of the copies of this documents must retain all copyright information and other information regarding legal protection. You are not allowed to alter this document in any way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the document in public, to perform, distribute or otherwise use the document in public. Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die Nutzungsbedingungen an. By using this particular document, you accept the above-stated conditions of use. Kontakt / Contact: peDOCS Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) Mitglied der Leibniz-Gemeinschaft Informationszentrum (IZ) Bildung Schloßstr. 29, D-60486 Frankfurt am Main E-Mail: pedocs@dipf.de Internet: www.pedocs.de
Zeitschrift für
internationale
Bildungsforschung
und
Entwicklungspädagogik
27. Jahrgang · Heft 1 · 2004 · ISSN 1434-4688 D · Preis: 6,00 €
Mit: Mitteilungen der DGfE-Kommission ”Bildungsforschung mit der Dritten Welt“
Qualitätsmonitoring
im Nord-Süd-Kontext
Aus dem Inhalt:
• Schulleistungsvergleichsuntersuchungen im Süden
• Bildungsvergleich zwischen Nord und Süd
• Evaluation27. Jg. Heft 1 März 2004 ZEP Seite 1
Zeitschrift für internationale Bildungsforschung
und Entwicklungspädagogik
27. Jahrgang März 1 2004 ISSN 1434-4688D
Adama Ouane /
Madhu Singh 2 Large Scale Assessments and their Impact for Education in the South
9 Die PISA-Erhebung in Ländern des Südens
Asit Datta 13 Bildungsvergleiche im Nord-Süd-Kontext
Priska Sieber 16 Evaluation des nationalen Schulentwicklungsprojekts in Serbien
Audrey Osler 22 Education for Global Citizenship
Anke Poenicke 27 Gibt es Stämme in Afrika? Hinweise zur Darstellung eines Kontinents
Porträt 32 Markus Diebold: Das neue Institut für internationale Zusammenarbeit in
Bildungsfragen an der PH Zentralschweiz
BDW 34 Ganztagsbildung in der Wissensgesellschaft/Global Education Week 2003/
Das Recht auf Bildung für alle
36 Kurzrezensionen
43 Unterrichtsmaterialien
44 Informationen
Impressum
ZEP - Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik 27. Jg. 2004, Heft 1
Herausgeber: Gesellschaft für interkulturelle Bildungsforschung und Redaktion: Barbara Asbrand, Hans Bühler, Asit Datta, Heidi Grobbauer (Ös-
Entwicklungspädagogik e.V. und KommEnt terreich), Helmuth Hartmeyer (Österreich), Richard Helbling (Schweiz), Torsten
Schriftleitung: Annette Scheunpflug Jäger, Ulrich Klemm, Gregor Lang-Wojtasik, Claudia Lohrenscheit, Gottfried
Redaktionsanschrift: ZEP-Redaktion, Pädagogik I, EWF, Regensburger Orth, Bernd Overwien, Georg-Friedrich Pfäfflin, Annette Scheunpflug, Klaus
Str. 160, 90478 Nürnberg Seitz, Barbara Toepfer
Verlag: Verlag für Interkulturelle Kommunikation (IKO), Postfach 90 04 Technische Redaktion: Gregor Lang-Wojtasik (verantwortlich) 0911/
21, 60444 Frankfurt/ Main, Tel.: 069/784808; ISSN 1434-4688 D 5302-735, Claudia Bergmüller (Rezensionen), Matthias Huber (Infos)
Abbildungen: (Falls nicht bezeichnet) Privatfotos oder Illustrationen der
Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: erscheint vierteljähr- Autoren.
lich; Jahresabonnement EUR 20,- Einzelheft EUR 6,-; alle Preise verste- Titelbild: Urheber konnte nicht ermittelt werden
hen sich zuzüglich Versandkosten; zu beziehen durch alle Buchhandlungen Diese Publikation ist gefördert vom Evangelischen Entwicklungsdienst-
oder direkt vom Verlag. Abbestellungen spätestens acht Wochen vor Ablauf Ausschuss für Entwicklungsbezogene Bildung und Publizistik, Bonn. Das
des Jahres. Heft ist auf umweltfreundlichem chlorfreien Papier gedruckt.27. Jg. Heft 1 März 2004 ZEP Seite 27
Anke Poenicke
Gibt es Stämme in Afrika?
Hinweise zur Darstellung eines Kontinents
Zusammenfassung: Die vielen Analysen der deutschen Das Endprodukt, die Bilder in den Köpfen der befragten
Afrika-Darstellung haben kaum etwas bewirkt. In der im Schüler/innen, ähneln diesem Input unübersehbar. Folgende
Folgenden vorgestellten Broschüre für Schulbuchverlage Stichwörter skizzierten die allgemeinen Empfehlungen für zu-
und andere Interessierte wird dafür plädiert, die koloniale künftige Darstellungen:
Terminologie dem Forschungsstand anzupassen. - kritische europäische Selbstreflexion,
- (möglichst) gleiche Regeln für die Darstellungen Afrikas
Wegen der sehr unterschiedlichen Darstellungsweisen, soll und Europas,
es hier um Afrika ohne die Mittelmeeranrainerstaaten gehen. - verschiedene Facetten Afrikas,
Aktuelle Befragungen von Kindern und Jugendlichen in - afrikanische Beispiele bei allen Themenbereichen,
Deutschland ergeben dazu folgende vorherrschende Bilder: Af- - mehr afrikanische Perspektiven,
rika ist fremd, „ihnen“ fehlt, was „wir“ haben, alle sind arm und - mehr zu Hintergründen (dafür lieber weniger Themen),
schwarz, es gibt Kriege, weil es „Stämme“ gibt, das Leben der - wissenschaftlich zutreffende und wertneutrale Termini.
Frauen dort ist hart, Afrikaner sind natürlich und haben Zeit für
ihre Kinder (vgl. Poenicke 2001, S. 7-12) „Afrika realistisch darstellen“ konkretisiert die damaligen
Negativismen herrschen vor, ergänzt durch das Bild des „Ed- Empfehlungen. Es widmet sich der Terminologie (z.B. Pygmäen,
len Wilden“. Schulbücher sind einer der Faktoren, die Befragte Naturvölker, Weltreligionen, Entwicklungsländer), der Dar-
geprägt haben. Aus dem Rahmen fallen sie innerhalb Deutsch- stellung geschichtlicher Themen (z.B. afrikanische Systeme,
lands und Europas nicht; wahrscheinlich können wir heute von Demozide und Kriege, Sklaverei, Völkermord an den Herero,
einer globalisierten Darstellungsweise Afrikas sprechen – und Folgen der Kolonisation), der Darstellung politischer Themen
von globalisierten Afrikabildern in den Köpfen. (Tribalismus, Konfliktursachen, Hunger) und pädagogisch-di-
Die Broschüre „Afrika realistisch darstellen“ (Poenicke 2003), daktischen Aspekten. Thematisiert wurden jeweils die besonders
die ich hier vorstelle, war die Folgemaßnahme einer ersten Bro- typischen Darstellungstendenzen bisheriger Schulbücher; sie
schüre (Poenicke 2001). Sie entstand vor allem auf Wunsch von wurden konkret hinterfragt, um dann begründete alternative
Schulbuchautoren und ist das Ergebnis der Arbeit einer europä- Herangehensweisen zu entwickeln.
isch-afrikanischen Fachgruppe.1 Ziele und Prämissen haben sich
dabei nicht geändert: „Der Zweck [...] besteht, mit Augenmerk
auf Deutschland, darin, zur Verständigung zwischen Europa und Bezeichnungen für menschliche Gesell-
Afrika beizutragen. [...] Voraussetzungen für Verständigung sind schaften
vor allem grundsätzlicher Respekt und Achtung vor Denken,
Fühlen und Handeln des anderen (ein nur durch die Priorität der In den Zeiten der Kolonisation dienten zahlreiche Begriffe
Menschenrechte einzugrenzender Grundsatz), die Reflexion ei- dazu, Afrika, im Vergleich zu Europa, andersartig und unterle-
gener Positionen, Kenntnisse zum Verstehen der Positionen des gen erscheinen lassen und auf diese Weise Europas Zugriff zu
anderen, Fähigkeit und Bereitschaft zum Verständnis (Empathie) rechtfertigen. Dazu wurden nicht nur neue Wörter erfunden
des anderen“ (Poenicke 2001, S. 5f). (z.B. „Hottentotten“, „Buschmänner“), sondern alte Termini, die
Wesentliche Ergebnisse der ersten Broschüre über die Dar- man für das aktuelle Europa schon lange nicht mehr benutzte,
stellung Afrikas in deutschen Medien und Schulbüchern lagen wurden für Afrika neu aufgelegt.
darin, dass
- Afrika oft nur dann ein Thema ist, wenn es – direkt – mit Stamm
Europa zu tun hat, Das bis heute prominenteste Beispiel ist der Begriff „Stamm“.
- die Themen sich weitgehend auf Negativismen und „Män- Im westlichen Kontext nur für Gesellschaften vor und zu Beginn
gel“ beschränken, unserer Zeitrechnung benutzt, gibt seine systematische Benut-
- dabei aber die Rolle Deutschlands bzw. Europas wenig zung für afrikanische Kontexte nun eine Analogie zwischen frü-
selbstkritisch reflektiert wird, hen europäischen (z.B. Germanen) und zeitgenössischen afrika-
- „Fremdes“ überbetont wird, nischen Gesellschaften vor. Viele Afrikaner/innen haben den
- kaum afrikanische Perspektiven vorkommen und Begriff, der in ihren Sprachen nicht existiert, übernommen, eben-
- koloniale Termini und Konzepte fortleben. falls ein Erfolg der Kolonialideologen.
Die Fachgruppe lehnte den Begriff „Stamm“ einhellig ab, ebenSeite 28 ZEP 27. Jg. Heft 1 März 2004
zum einen weil er negativ konnotiert ist, Primitivität suggeriert das Bewusstsein der Zusammengehörigkeit über einen Grün-
und traditionell der Abgrenzung von Gesellschaftsformen in derahn. Ethnische Gruppen im politischen Sinn können entste-
Afrika von solchen in Europa dient. Zum anderen folgt er dem hen, wenn dieses Bewusstsein politisch manipuliert und zur
Konzept des Evolutionismus, nach dem der Stamm als „natür- zentralen und exklusiven Charakteristik der eigenen Gruppe auf-
lich“ gewachsene Einheit weit unten auf einer vermeintlich vor- gebaut wird (Prozess der Politisierung der Ethnizität). Z. B. be-
gezeichneten menschlichen Entwicklungsskala steht, an deren zeichneten die Bezeichnungen „Hutu“ oder „Tutsi“ veränder-
Ende sich gesetzmäßig der Staat befinde. Dabei wird überse- bare soziale Kategorien; seit der Kolonialzeit wurden sie dann
hen, dass sich auch nicht-staatlich organisierte Gesellschaften aber aus politischem Kalkül als Bezeichnungen für unterschied-
auf komplexe politische, also nicht einfach natürlich-verwandt- liche „Ethnien“ oder gar „Rassen“ instrumentalisiert – beides
schaftliche Strukturen gründen. gleichermaßen Konstrukte.
„Stamm“ bezeichnet eine festgefügte Gruppe von Menschen, Auch in Europa gibt es keine Ethnien, aber Gruppen, die kul-
die eine gemeinsame Kultur, Sprache und Religion sowie ein turelle und historische Gemeinsamkeiten als ihr kulturelles Erbe
gemeinsames Weltbild haben, unter subsistenznahen Be- und als ihre Identität gegenüber anderen Gesellschaften pfle-
dingungen auf niedrigem technologischen Niveau leben und gen, z. B. „Bretonen“, „Bayern“, „Iren“. Wenn dieses Erbe zur
politisch autonom sind. Zur Bezeichnung der afrikanischen Abgrenzung von anderen Gruppen und zur politischen Mobili-
Wirklichkeit ist der Begriff falsch. Spätestens seit dem 19. Jahr- sierung gegen diese „Anderen“ aufgebaut und geradezu ver-
hundert standen dort die meisten Gesellschaften durch Aus- absolutiert wird, entstehen – überall auf der Welt – politisier-
tausch von Waren, Ideen und Menschen in ständigen Be- te ethnische Gruppen. Auch was Menschen selber denken, ist
ziehungen zu ihrer Umwelt und bildeten damit sowieso keine dabei keineswegs immer eindeutig: Die Grenzen sind oft nicht
„Stämme“ mehr. Die Projektion europäischer Nationalvor- klar (z.B. wer ist Swahili, wer nicht in Kenia?), die Selbst-Defini-
stellungen auf nicht-europäische Strukturen impliziert, dass letz- tionen verändern sich mit der Zeit (z.B. stammen einige Zulu
tere klar voneinander abzugrenzen seien. Afrikanische Gesell- von heute aus Gruppen, die sich vor drei Generationen nicht als
schaften waren und sind aber weder in dem Maße homogen Zulu bezeichneten) und die Selbst-Definitionen können sich
noch voneinander abgrenzbar, wie es der Begriff suggeriert. mit dem Kontext verändern: Eine Person mit Ndebele- und Shona-
Eigenbezeichnungen afrikanischer Gesellschaften nehmen und Vorfahren kann sich in einem Kontext als Shona bezeichnen, in
nahmen übrigens oft Bezug auf den Siedlungsraum (z.B. „die einem anderen als Ndebele und in einem dritten als beides.
Leute von den Bergen“) oder einen Herrscher (z.B. Zulu als die Wenn Autoren/Autorinnen von Schulbüchern den Begriff
Leute, die in dem von Shaka Zulu gegründeten Reich lebten); „Ethnie“ trotzdem benutzen, sollten sie festhalten, dass es sich
sie definieren also keine statische Gruppe. um keine objektive Kategorie handelt. Gibt es tatsächlich ein
Zudem ist es unsinnig, völlig unterschiedliche Gesellschaf- Zugehörigkeitsgefühl, so erklärt es sich durch politische u.ä.
ten, wie etwa die Ogoni mit heute ca. 800.000 Menschen und die Faktoren (bes. äußerer Druck). Aber noch wichtiger ist: Was
Haussa mit mehr als 80 Millionen Menschen, gleichermaßen häufig als „ethnische Konflikte“ dargestellt wird, sind Konflikte
unter dem Begriff zu subsumieren. wie anderswo auch. Wenn darin der Begriff „Ethnie“ Platz fin-
Wertneutrale und inhaltlich zutreffende Alternativen zu den soll, dann nur als „ethnisierter Konflikt“, womit die Willkür
„Stamm“ sind je nach Kontext z.B. „Gesellschaft“, „Bevölke- und die Instrumentalisierung der Kategorie deutlich werden.
rung“ bzw. „Bevölkerungsgruppe“ oder auch „Kultur“. In den
meisten Kontexten ist allerdings zu fragen, ob ein derartiger Völker
Überbegriff überhaupt nötig erscheint. Diese Frage ist leicht zu Nun gibt es Schulbücher, die die Begriffe „Stamm“ und
beantworten, wenn die europäische Analogie getestet wird (z.B. „Ethnie“ vermeiden und von afrikanischen „Völkern“ sprechen.
Stoiber ist Bayer, Obasanjo ist Yoruba; fehlt da etwas?). Eine Das hat den Vorteil, dass ein mitunter für Europa gebräuchlicher
terminologische Ungleichbehandlung macht selten Sinn – am und nicht negativ konnotierter Terminus benutzt wird. Im allge-
wenigsten, wenn sie falsch ist und nichts erklärt. meinen Sprachgebrauch ist ein Volk eine Gruppe von Menschen,
die sich als ideelle Einheit begreifen, also als eine durch gemein-
Ethnie same Herkunft, Geschichte, Kultur und Sprache, z.T. auch Reli-
Viele dieser Aspekte gelten auch für den inzwischen gängi- gion, verbundene Gemeinschaft. Es gab in Afrika vor der Kolo-
gen Ausdruck „Ethnien“ (griech. ethnos = Volk), die im heuti- nialzeit Völker (z.B. Zulu, Swazi, Bini), aber nicht alle Gruppen
gen allgemeinen Verständnis als primordiale und unveränderli- oder Gesellschaften galten als Völker und auch die meisten vor-
che Einheiten angesehen werden. Wo historisch vielleicht von kolonialen Gesellschaften waren multikulturell. Hinzu kommt,
„Ethnien“ gesprochen werden kann, sind diese starreren For- dass in größeren afrikanischen Reichen einzelne Teile, auch
men oft erst durch die Eingriffe der Kolonialregierungen in die unterworfene Gesellschaften, ihre kulturelle Identität und ihre
vorkolonialen Organisationen entstanden. Allgemein waren afri- administrative Autonomie erhalten konnten und dem Herrscher
kanische Gesellschaften viel dynamischer und flexibler als von im Zentrum des Reiches nur Anerkennung und Tribut zu zollen
den Europäern angenommen, und die Zugehörigkeit eines Indi- hatten. Die ideelle Einheit erstreckte sich also nur auf sehr weni-
viduums definierte sich nach mehreren Kriterien (Verwandt- ge Bereiche. Noch zweifelhafter wird der Ausdruck „Volk“ für
schaft, Territorium, Zugehörigkeit zu einer Kultgemeinschaft, Gesellschaften ohne politisch zentralisierte Autorität (z.B. Igbo,
Verpflichtung einem Herrscher gegenüber, Patron-Klient-Bezie- Yoruba). Sie hatten kulturelle Gemeinsamkeiten, waren aber in
hungen usw.), die je nach Situation zum Tragen kamen. kleineren Einheiten organisiert, die nie alle Yoruba-Sprachler oder
Heute gibt es in Afrika Gesellschaften, die Teil der Bevölke- Igbo-Sprachler erfassten.
rung eines Staates sind und eigene Traditionen pflegen, auch Es gibt im heutigen Afrika Gesellschaften, die man „Völker“27. Jg. Heft 1 März 2004 ZEP Seite 29
und „Nationen“ nennen könnte, die seit Beginn der Kolonialzeit Aber: Gegenüber der Starrheit und Exklusivität der ethnischen
zusammengewachsen sind und in mancher Hinsicht eine ideelle Ideologien sind die kolonial gewachsenen Ethnizitäten weder
Einheit bilden. Aber ihre internen Unterscheidungen in verschie- unveränderbar noch monolithisch. Wie jede andere Identität
dene kulturelle, sprachliche, religiöse u.a. Gruppierungen blei- bieten sie einen sozialen und politischen Aushandlungsraum,
ben bestehen. Sie sind, noch stärker als in Europa, multikulturel- in dem über Legitimität, Normen, soziale Klassen, gender usw.
le Gesellschaften. Wie Leonhard Harding fragte: Was trägt der debattiert wird, und in dem Beziehungen und Zugehörigkeiten
Begriff „Volk“ zu ihrem besseren Verständnis bei? Die Ashanti, innerhalb eines Kontextes, z.B. des staatlichen, immer wieder
die Zulu, die Baganda, die Igbo, die Yoruba etc. können einfach neu definiert werden. Andere Formen der Vergesellschaftung
bei ihrem Namen genannt werden und mit diesem sind dann die und Netzwerkbildung bleiben daneben vorhanden.
Menschen gemeint, die zu einem bestimmten Zeitpunkt zu der Statt politisierte Identitäten (regionale, religiöse, kulturelle,
bestimmten politischen Einheit gehörten bzw. gehören oder sich sprachliche usw.) zu negieren oder sie, wie manches Schulbuch,
als zusammengehörig betrachteten bzw. betrachten. Wieder als Rückfall in die Barbarei bzw. als nie überwundene Barbarei
handelt es sich zumindest um keine objektive Einheit. zu bewerten, wäre es ein wichtiger Beitrag zur politischen Bil-
Der Begriff Volk ist zwar nicht negativ konnotiert, aber in dung in Deutschland, sie anhand einiger Beispiele aus der gan-
vielen Fällen unzutreffend bzw. überflüssig. Wo es um Gruppen zen Welt als moderne Erscheinungen zu thematisieren und in
innerhalb eines „Staatsvolks“ geht, können wir z. B. von „Be- ihren unterschiedlichen Zusammenhängen und historischen Ur-
völkerungsgruppe“ oder auch von einer „sprachlichen Minder- sachen zu beleuchten. Dann würde deutlich, dass es nur sich
heit“ sprechen. stetig wandelnde, mehrere Dimensionen und mehrere Ebenen
einschließende Felder des politischen Handelns und der Beteili-
gung am kollektiven Leben gibt, in denen sich manchmal konflikt-
Tribalismus, Rassismus und Konflikt- trächtige Abgrenzungen und vereinnahmende Solidaritäten
ursachen entwickeln – aber eben keineswegs entwickeln müssen.
Was sind dann die tatsächlichen Ursachen innerstaatlicher
Es gibt keine „Stämme“ („tribes“) in Afrika. Gibt es aber Triba- Konflikte im heutigen Afrika? Es ist ein ideologisch begründe-
lismus? Denn obwohl keine Rassen existieren, gibt es ohne Zwei- ter Automatismus im Westen, von „Stammesgegensätzen“ zu
fel Rassismus. Die knappe Antwort von Dominic Johnson, Mit- sprechen, auch wenn ökonomische und politische Ursachen
glied der Fachgruppe, lautete: „Ja, es gibt Tribalismus – obwohl von Konflikten offensichtlich sind.
ich nicht verstehe, warum man das nicht einfach Rassismus In den Konflikten der neuen Staaten ging und geht es um die
nennt.“ Da Rassismus und das, was als Tribalismus bezeichnet Aufteilung der Ressourcen. Zugehörigkeiten wurden von Poli-
wird, ihre jeweils eigene Entstehungsgeschichte haben, lohnt tikern zur Mobilisierung genutzt. Für alle Konflikte Afrikas gibt
es sich, genauer hinzusehen. „Natürlich“ ist keines der beiden es mehrere Faktoren, darunter innere Instabilität der betroffe-
Prinzipien, auch wenn deutsche Schulbücher (und zwar zu Ras- nen Länder, Machtstreben einzelner Personen und Interessen
sismus besonders die Biologiebücher) dies meist suggerieren. auswärtiger Mächte oder Interessenträger. Aber nur wenn all
In der Afrika-Forschung wird der Begriff Tribalismus manch- diese Faktoren zusammenwirken, kann ein Konflikt sich tatsäch-
mal im Sinne von politisch instrumentalisierter Ethnizität (= Den- lich verselbstständigen und zu einem Bürgerkrieg werden, der
ken in ethnischen Kategorien) benutzt.2 Wie bereits angedeu- sich hartnäckig allen Lösungsversuchen zu entziehen scheint.
tet, bildeten sich während der kolonialen und der postkolonialen Auswärtige Eingreifer können ein Land destabilisieren, wenn
Zeit z.T. „ethnische Identitäten“ heraus, die als wirtschaftliche, sie sich bestehende Spannungen zu Nutze machen. Das gilt
soziale und politische Ressource eingesetzt wurden. Eine wich- ebenso für Diktatoren, die zu Zwecken des Machterhalts Bür-
tige Rolle spielten bei dieser Entwicklung z.B. die verwaltungs- gerkrieg im eigenen Land schüren.
technische Gliederung in als „Stämme“ bezeichnete Einheiten, Die innerafrikanischen Faktoren erklären sich nicht aus sich
die von den Missionaren initiierte Reduzierung des Dialektkon- selbst, sondern stehen in Verbindung mit verschiedenen vorhe-
tinuums auf wenige Schriftsprachen, die jeweils einer Gruppe rigen und gleichzeitigen Entwicklungen und deren Auswirkun-
zugeordnet und weiterverbreitet wurden, oder später in der Ar- gen, besonders
beitsmigration die sog. ethnische Zugehörigkeit als Kriterium - mit der Kolonisation (z.B. im Zusammenhang mit dem „Ers-
für die Zusammensetzung von Solidargemeinschaften etwa zur ten Weltkrieg Afrikas“ in Kongo-Kinshasa: eine Kolonial-
Verschaffung von Arbeit und Unterkunft. herrschaft mit 10 Millionen Opfern und die damit verbundene
Im Kontext des kolonialen und später auch postkolonialen Etablierung einer Kultur von Gewalt und Straflosigkeit, die Her-
Staates konnte Ethnizität damit als politisches Mittel im Wett- anbildung einer Elite nicht nach demokratischen, sondern nach
streit um die knappen und ungleich verteilten Ressourcen in kolonialen Vorgaben etc.),
Wirtschaft, Bildung, Infrastruktur, Status u.a. eingesetzt wer- - mit den neokolonialen Begehrlichkeiten ehemaliger Koloni-
den. Bei der von den Kolonialregierungen zu verantwortenden al- und anderer Mächte und mit dem sogenannten „Kalten Krieg“
Schwäche der postkolonialen Staaten diente dann in manchen (mit Folgen wie der Ermordung Patrice Lumumbas und anderer
Ländern „ethnische“ Zugehörigkeit als eines der wichtigen Be- Hoffnungsträger),
stimmungselemente von Politik. Bis heute erhalten Politiker ent- - mit diversen vom Westen mitverantworteten Faktoren, die
sprechend ihrer „ethnischen“ Herkunft Posten und mobilisie- zur Destabilisierung beitragen (Stichworte: Schuldendienst,
ren Anhänger und Stimmen entlang solcher Loyalitäten. Und Agrarsubventionen, Unterstützung von Diktatoren, Rohstoff-
das bezeichnet man als „Vetternwirtschaft“ oder eben als politi- handel mit Warlords, Waffenexporte u.v.m.).
schen „Tribalismus“. Auch dort, wo Konflikte sich immer mehr verselbstständigtSeite 30 ZEP 27. Jg. Heft 1 März 2004
haben, sind diese Hintergründe wichtig zum tieferen Verständ- bereits in der Praxis, Pendants dazu auch in anderen Fächern.
nis von so skandalösen Zuständen wie dem, dass gigantische Dabei wird, ähnlich wie beim sehr viel weiter gehenden Globa-
Rohstoffvorkommen, die für alle ein Segen sein müssten, in len Lernen, das übliche Vorgehen nach Epochen (chronologisch)
vielen afrikanischen Ländern für die Bevölkerung zu einem und Gebieten (von „Nah“ zu „Fern“ im herkömmlichen Sinne)
zerstörerischen, mitunter tödlichen Fluch geworden sind. z.T. oder ganz ersetzt durch Vorgehensweisen, die ein tieferes
In Schulbuchdarstellungen geschieht es häufig, dass das Erbe Verständnis sozialer, politischer u.a. Phänomene zulassen.
der Kolonisation und wirtschaftliche Auswirkungen der Globa- Ausgangspunkt für eine moderne Universalgeschichte ist,
lisierung zwar mehr oder weniger ausführlich dargestellt wer- dass alle Gesellschaften dieser Welt eine eigene Vergangenheit,
den, aber separat von den an anderer Stelle behandelten heuti- Gegenwart und eigene kulturelle Traditionen haben, die von
gen Konflikten, als deren Ursachen dann fast nur innere Fakto- ihnen selbst gestaltet wurden und werden. Der Maßstab einer
ren aufgeführt werden, ohne die Verbindung auch zu den äuße- Universalgeschichte ist also nicht die europäisch-westliche
ren Faktoren herzustellen und vor allem das Ineinandergreifen Entwicklung. Nicht-westliche Gesellschaften befinden sich nicht
der verschiedenen Faktoren nach einigen sehr typischen Mus- in früheren Stadien einer vorgezeichneten Entwicklungsabfolge,
tern bzw. anhand konkreter Beispiele aufzuzeigen. So entsteht sondern westliche und nicht-westliche in gleichzeitigen Stadi-
der Eindruck, dass die Folgen der äußeren Faktoren nicht wirk- en der Universalgeschichte. Im Laufe der Geschichte ist es immer
lich ein wichtiger Teil der Probleme sind. Schuld ist dann z.B. nur wieder zu wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Verflech-
der korrupte Diktator; dass dieser etwa ohne die Unterstützung tungsprozessen in allen Regionen der Welt gekommen. Die ab
eines oder mehrerer westlicher (oder inzwischen auch anderer ca. 1500 einsetzende Ausdehnung des westlich dominierten
afrikanischer) Länder schon lange nicht mehr an der Macht wäre, Weltsystems ist einer von ihnen, der allerdings zum ersten Mal
das müsste aber genau an dieser Stelle klar gesagt werden. Und zur Verflechtung der gesamten Welt geführt hat. Die vielen loka-
dass diejenigen, die jetzt unter der Last des Schuldendienstes len Gesellschaften sowie die regionalen und überregionalen Sys-
zu leiden haben und nach zum Teil gewaltsamen Wegen aus der teme, in die sie integriert waren, sind z.T. gewaltsam in das westli-
Krise suchen, meist nie etwas von dem Geld gesehen haben, che eingeführt worden. D.h., die Geschichte dieser Gesellschaf-
das an ein nie legitimiertes Regime geliehen worden ist, muss ten ist ebenso Teil des Weltsystems wie z.B. die Geschichte
auch an der Stelle stehen, an der es um die Ursachen für die Englands, gründet aber zugleich weiterhin auf den eigenen vor-
resultierenden „inneren Unruhen“ geht. Wenn Kindersoldaten hergegangen Entwicklungen. Nicht-westliche Geschichten sind
das Thema sind, gehören dazu nicht nur skrupellose Milizen, also auch keine Anhängsel einer „Hauptgeschichte“ der „Me-
die sie missbrauchen, sondern auch nicht minder skrupellose tropole“.
westliche u.a. Länder, die sich ihrer Kleinkaliberwaffen (auf di- Westliche Einwirkungen werden von den jeweiligen lokalen
rektem Weg bzw. über Drittländer) in Kriegs- und Krisengebiete Gesellschaften nicht passiv erlitten. Die lokalen Akteure gehen
entledigen und die Rekrutierung von Kindern damit überhaupt aktiv damit um – auch mit der Asymmetrie der Machtverteilung.
erst ermöglichen. Die heutigen Städte in Afrika sind keine Repliken der westli-
Diese Zusammenhänge so verzahnt darzustellen, wie sie sind, chen, sondern nigerianische, kenianische usw., senegalesischer
und die Verantwortung aller Seiten gemeinsam zu betrachten, Hip-hop ist senegalesisch, kamerunischer Fußball kamerunisch,
das leisten bisher nur selten Schulbücher. Dafür springen häu- südafrikanisches Theater südafrikanisch. Eine Universalge-
figer für den Unterricht aufbereitete Broschüren außerschulischer schichte geht davon aus, dass die Begegnung die Seiten mit-
Institutionen ein. Dies bedeutet, dass wesentliche Zusammen- einander verwoben und damit auch verändert hat.
hänge der heutigen Welt nur dann unterrichtet werden, wenn Eine Universalgeschichte würde von universellen, zur Be-
engagierte Lehrkräfte sich mit zusätzlichen Materialien versor- trachtung aller Gesellschaften gleichermaßen relevanten Frage-
gen. Dabei kann es passieren, dass sie sich ausgerechnet mit stellungen ausgehen, z.B.: Wovon leben Gesellschaften? Wie
den Materialien versorgen, die aus Eigeninteresse der Herausge- organisieren Gesellschaften ihr Zusammenleben auf politischer
ber eine besonders paternalistische Perspektive gegenüber Afri- Ebene? Wie organisieren sie ihr Zusammenleben auf gesell-
ka vertreten. schaftlicher Ebene? Wie ihr Selbstverständnis? Ausgehend von
solchen Fragestellungen ist die gesamte Geschichte der Mensch-
heit aufzurollen. Damit wird die Nationalgeschichte nicht abge-
Universalgeschichte schafft; sie ist in diese Fragestellungen einzubauen und beson-
dere Aspekte der jeweiligen Region sind dann zu vertiefen. Das
Von unseren pädagogisch-didaktischen Überlegungen möch- muss im Geschichtsunterricht geschehen, hat aber seine unmit-
te ich im Folgenden ein Konzept herausgreifen, das mittel- bis telbaren Konsequenzen auf Erdkunde, Politik, Kunst, die Spra-
langfristig vor allem den Geschichtsunterricht, aber auch den chen, Religion und Ethik.
Unterricht aller anderen relevanten Fächer so verändern könn-
te, dass Afrika (und Europa und alle anderen) quantitativ wie
qualitativ sehr viel angemessener als heute behandelt werden – Grundregeln für realistischere Afrika-
ohne die bereits unerträgliche Stofffülle zu vergrößern.
In der Geschichtsdidaktik vieler Länder werden inzwischen Darstellungen
neue Entwürfe für eine „Universalgeschichte“3 im Sinne einer
allgemeinen Geschichte der Menschheit (im Gegensatz zu Nati- Grundsätzlich sollten Termini, die in Schulbüchern benutzt
onal-, Regional- und Spartengeschichte) entwickelt, die die werden, wissenschaftlich zutreffen, nicht negativ konnotiert und
zentristische Perspektive aufbrechen soll. Ansätze existieren zugleich praktikabel sein. Im Fall der Terminologie, die traditio-27. Jg. Heft 1 März 2004 ZEP Seite 31
nell speziell für Afrika benutzt wird, sind die ersten beiden Krite- Schuld zu suggerieren) ist, wie die Reflexion der traditionellen
rien bisher sehr häufig nicht erfüllt. Diskurse, eine der Voraussetzungen für Verständigung.
Vorrang sollten möglichst Eigenbezeichnungen haben. In vie- Besonders zur Aufbereitung historischer Themen wäre es
len Fällen können Begriffe ersatzlos gestrichen werden, beson- wichtig, jeweils die (moderne) Afrika-Fachliteratur ausfindig zu
ders wenn sie für Europa auch nicht üblich sind, was durch den machen, die nur selten zum Hochschulstudium der Autoren/
Vergleich deutlich wird (z.B. X ist Bayer, Y ist Yoruba statt „vom Autorinnen von Schulbüchern für Geschichte gehört hat. Zu
Volk der Yoruba“). Wo Oberbegriffe nötig sind, stehen meist zeitgeschichtlichen Themen bieten sich zudem in besonderem
bereits gute Alternativen zur Verfügung (z.B. „Gesellschaften Maße die spezialisierten Informationsdienste im Internet an und
Afrikas“). Manchmal müssen sie erst gefunden werden; partiell Materialien aus dem Bereich Globales Lernen.
gibt es noch Forschungsbedarf (z.B. bei Eigenbezeichnungen), Bei der Revision der Terminologie wäre es relativ einfach, die
teilweise könnten Suche und Diskussion alternativer Begriffe begrenzten Möglichkeiten innerhalb der jetzigen Richtlinien und
eine Aufgabe für Unterricht darstellen (z.B. für die homogeni- Lehrpläne besser als bisher zu nutzen, um Afrika angemessen
sierenden Begriffe „Dritte Welt“ und „Entwicklungsländer“ sol- darzustellen. Auf längere Sicht kann nur eine Umstrukturierung
che zu finden, die präzise das jeweilige Kriterium benennen, um der Fächer dazu führen (Stichworte Universalgeschichte, Glo-
das es geht). Begriffe, die in Europa wie Afrika auf verschiede- bales Lernen), dass Afrika seinen Platz in Deutschlands und
nen Ebenen unterschiedlich gehandhabt werden (z.B. „Volk“), Europas Schulen bekommt und auf diesem Wege auch das all-
können ebenfalls ein lohnendes Unterrichtsthema sein. Die gemeine Verstehen von Entwicklungen und Phänomenen
Schulbücher sollten zudem nicht einfach die (Kolonial-)Begriffe menschlichen Zusammenlebens wächst.
austauschen, sondern die Problematik samt der Geschichte der
spezifischen Afrika-Terminologie thematisieren. Wenn für ei- Anmerkungen
nen problematischen Begriff noch keine Alternative zur Verfü- 1 Susan Arndt, Michel Foaleng, Leonhard Harding, Paola Ivanov, Do-
minic Johnson, Jacob E. Mabe, Mai Palmberg, Herbert Prokasky und
gung steht, können Anführungszeichen dieses Problem sym-
Louis Henri Seukwa; anders als in der Broschüre, kennzeichne ich die
bolisieren (z.B. bei „Entdeckung Amerikas“ häufig so gehand- Beiträge der einzelnen Fachleute nicht gesondert, da ich sie in diesem
habt). Wenn eine vermeintliche Spezifizierung (z.B. „Weltreligi- Artikel mische und stark komprimiere.
on“ für „Religion“) Gegensätze aufbaut, die einer Analyse kaum 2 Die folgenden Ausführungen zu Tribalismus sind ausschließlich Paola
Ivanov zu verdanken.
standhalten, sollte es bei dem allgemeineren Begriff bleiben.
3 Schissler (2003) spricht auch vom themenorientierten und themen-
Was die Wahl und die Darstellung der Themen betrifft, so zentrierten „globalen Zugang“ (S. 161). Das Konzept einer „Weltge-
sollten Schulbücher nicht nur die bisher übliche Terminologie schichte“ (S.159f) ist dazu der erste wichtige Schritt, denn es führt die
thematisieren, sondern auch die traditionellen Darstellungs- Multiperspektivität ein.
4 Jansen und Naumann (2002) haben gezeigt, wie das Rassenkonzept aus
strukturen aufgreifen (mit besonderer Berücksichtigung der
deutschen Schulbüchern für Geschichte spurlos verschwunden ist. Statt zu
Medien, aber auch der Schulbücher selber). Das Konzept von reflektieren, wurde tabuisiert, also genau das Gegenteil von meiner For-
„Stammeskriegen“ als „Kriegen, weil es Stämme gibt“ ist ein derung vorgenommen. So richtig schief gegangen ist das, weil die Mehr-
Beispiel, an dem gelernt werden kann, einfachen traditionellen zahl der deutschen Biologiebücher das – zudem durch die ganze Gesell-
schaft spukende – Rassenkonzept bis heute verbreitet, selbst wenn in den
Erklärungsmustern zu misstrauen und sie zu hinterfragen. Dass
Lehrplänen längst nichts mehr davon steht.
die Kinder und Jugendlichen durch schulischen wie außer-
schulischen Umgang mit Afrika bereits geprägt sind, lässt es Literatur
außerdem sinnvoll erscheinen, gezielt sonst vernachlässigte Jansen, R./Naumann, J.: Der lange Weg von nationalistischen und
Themen und Perspektiven zu fördern: z.B. aktives Afrika, Ge- rassistischen Menschenbildern zum Konzept des kollektiven Lernens
der Menschheit in der Einen Welt. In: Internationale Schulbuchforschung,
schichte vor der Kolonisation, „afrikanische Systeme“, die vie-
24(2002), S. 353 – 358.
len Erfolgsstories!4 Poenicke, A.: Afrika in deutschen Medien und Schulbüchern. Sankt
Was die Zuordnung historischer Themen innerhalb der übli- Augustin 2001 (Zukunftsforum Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung,
chen Chronologie speziell in Geschichtsbüchern betrifft, so ist Nr. 29). (www.kas.de).
Poenicke, A.: Afrika realistisch darstellen. Diskussionen und Alternati-
es zur Zeit eine problematische Notlösung, vorkoloniale Ge-
ven zur gängigen Praxis - Schwerpunkt Schulbücher. Sankt Augustin 2003
schichte im Rahmen der Kolonisation zu behandeln, um sie (Zukunftsforum Politik der Konrad-Adenauer-Stiftung, Nr. 55).
überhaupt behandeln zu können. Vielleicht gibt es auch im Rah- (www.kas.de ).
men bisheriger Lehrpläne – die nicht nur an dieser Stelle dringen- Schissler, H.: Der eurozentrische Blick auf die Welt. Außereuropäische
Geschichten und Regionen in deutschen Schulbüchern und Curricula. In:
der Änderung bedürfen – Möglichkeiten, afrikanische Beispie-
Internationale Schulbuchforschung,
le und Entwicklungen aus der jeweils selben Epoche wie für 25(2003), S. 155-166.
Europa einzubeziehen (d.h. nicht mehr Kolonisation mit einem
Exkurs ins Afrika des 12. Jahrhunderts im selben Kapitel, son-
dern zu Europa im 12. Jahrhundert auch ein Beispiel aus dem
Afrika der Zeit).
Zur Interpretation von Ereignissen ist Multiperspektivität ein
wichtiges Prinzip, bei dem afrikanische Perspektiven zumindest
dann eine zentrale Rolle spielen sollten, wenn es um Afrika geht.
Das betrifft gerade auch die besonders belasteten afrikanisch-
Dr. Anke Poenicke, geb. 1962 ist Er-
europäischen Themen (Sklaverei, Kolonisation u.a.), bei denen
ziehungswissenschaftlerin mit Schwer-
es gleichzeitig gilt, klare Worte für Unrecht und Verbrechen zu punkt Afrika und arbeitet als freie Au-
finden. Dieses Anerkennen (ohne Schüler/innen persönliche torin in Berlin.Sie können auch lesen