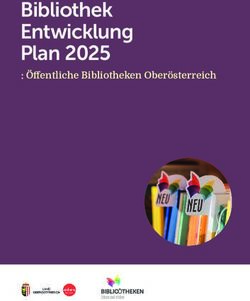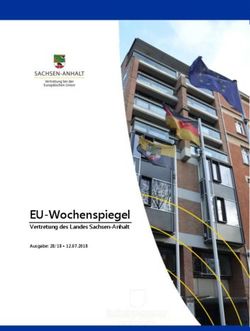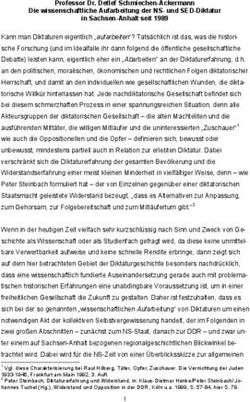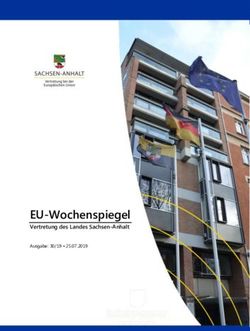HOCHSCHULEN AUF EINEN BLICK - Ausgabe 2008 Statistisches Bundesamt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Herausgeber: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Autorinnen: Pia Brugger pia.brugger@destatis.de Simone Scharfe simone.scharfe@destatis.de Astrid Stroh astrid.stroh@destatis.de Gestaltung: KOOB Erschienen im Mai 2008 Bestellnummer: 0110010-08700-1 Fotorechte: Umschlag: © Strandperle / Fancy by Veer, Higher Education Seite 4, 13, 14, 31, 37, 46: © Strandperle / Fancy by Veer, Campus Life Seite 20, 35, 41: © Strandperle / Fancy by Veer, Higher Education © Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2008 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. 2 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008
Inhaltsverzeichnis
Einleitung 5
1 Eintritt in das Hochschulsystem 6
2 Daten und Fakten zu Hochschulabsolventen/-innen 16
3 Personalstruktur, Betreuung und Effektivität 22
4 Überregionale Attraktivität deutscher Hochschulen 30
5 Einnahmen und Ausgaben der Hochschulen 40
Glossar 48
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 3Einleitung
Hochschulstatistische Kennzahlen, die es er- Im Fokus der neuen Ausgabe von „Hochschulen
möglichen, die Hochschulsysteme der Länder auf einen Blick“ stehen Veränderungen und
im Hinblick auf wesentliche Leistungsmerkmale Trends, die sich seit der letzten Ausgabe ab-
miteinander zu vergleichen, stoßen angesichts gezeichnet haben. Hier sind insbesondere die
des steigenden Wettbewerbs unter den Hoch- weiter steigenden Absolventenzahlen zu nennen,
schulen und der Einführung von Studiengebüh- die sich sowohl auf die Absolventenquote als
ren auf immer größeres Interesse. auch auf eine Reihe weiterer hochschulstati-
stischer Kennzahlen auswirken.
In der Broschüre „Hochschulen auf einen Blick“,
die 2006 zum ersten Mal erschienen ist, werden Die vorliegende Veröffentlichung bezieht sich
die wichtigsten nationalen Kennzahlen zu Hoch- ausschließlich auf nationale hochschulstatis-
schulzugang, Absolventen, Personalstruktur und tische Kennzahlen, deren Definitionen und
Betreuung, überregionaler Attraktivität sowie Abgrenzungen zum Teil von den internationalen
finanzieller Ausstattung der Hochschulen im Kennzahlen abweichen, die die amtliche Statistik
Hinblick auf Berechnungsverfahren, Aussage- jährlich an die OECD (Organisation für wirtschaft-
kraft und zentrale Ergebnisse in komp akter liche Zusammenarbeit und Entwicklung) liefert.
Form kommentiert und visualisiert. Sie richtet Ausführliche Tabellen zu nationalen und inter-
sich vor allem an die interessierte Öffentlichkeit, nationalen hochschulstatistischen Kennzahlen
an Hochschulen und Studierende sowie Experten stehen im Publikationsservice des Statistischen
und Expertinnen und Entscheidungsträger und Bundesamtes zum kostenlosen Download zur
-trägerinnen aus Politik und Wissenschaft, die Verfügung. Die im Internet angebotenen Publi-
sich einen schnellen Überblick über Strukturen kationen enthalten genaue Definitionen der
und aktuelle Entwicklungen in zentralen Berei- Kennzahlen und weiterführende methodische
chen der deutschen Hochschullandschaft Hinweise.
verschaffen wollen.
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 51 Eintritt in das Hochschulsystem
Studienberechtigtenquote nach Bundesländern 2006 1.1 Studienberechtigtenquote
Deutschland Zielvorgabe Die Studienberechtigtenquote zeigt, wie hoch
43,4 Wissenschaftsrat 50
der Anteil der Abiturienten und Abiturien-
Nordrhein-Westfalen 53,4 tinnen (Schulabgänger mit allgemeiner,
Hessen 49,1 fachgebundener oder Fachhochschulreife)
48,1
an den Gleichaltrigen in der Bevölkerung ist
Saarland
(Durchschnitt der 18- bis 20-Jährigen).
Bremen 47,0
46,6
Schulabgänger und -abgängerinnen mit
Hamburg
Hochschulreife sind potenzielle zukünftige
Berlin 45,9
Studienanfänger, deshalb liefert dieser In-
Baden-Württemberg 45,8
dikator wichtige Informationen für die Hoch-
Niedersachsen 41,4 schulplanung.
Schleswig-Holstein 40,9
Thüringen 40,3 Studienberechtigtenquote erreicht
Brandenburg 40,0 mit 43 % neuen Höchststand
Rheinland-Pfalz 38,0 2006 erreichten 415 000 Schulabgänger die
Sachsen 37,1 Hochschulreife, das entspricht rund 43% des
Bayern 34,5 typischen Altersjahrgangs in der Bevölke-
rung. Die Studienberechtigtenquote hat sich
Sachsen-Anhalt 34,0
im Vergleich zum Vorjahr um knapp einen
Mecklenburg-Vorpommern 32,2
Prozentpunkt erhöht.
0% 10% 20% 30% 40 % 50 % 60 % Im Vergleich zu 1995 ist die Studienberech-
t igtenquote kontinuierlich bis auf einen leich
ten Rückgang im Jahr 2001 (der auf die Ein-
führung des 13. Schuljahres in Mecklenburg-
6 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Vorpommern und Sachsen-Anhalt zurückzufüh- Die wachsende Zahl von Schulabgängern mit Nordrhein-Westfalen mit 53 % an der Spitze
ren ist) von 36% auf nunmehr 43 % angestiegen. Fachhochschulreife hat in den letzten Jahren
Zwischen den Bundesländern differiert die Stu-
Nach einer Empfehlung des Wissenschaftsrates zum Anstieg der Studienberechtigtenquote bei-
dienberechtigtenquote beträchtlich. Am höch-
soll der Anteil der Abiturienten eines Altersjahr- getragen (+5 Prozentpunkte seit 1995), während
sten liegt sie mit 53 % in Nordrhein-Westfalen,
gangs auf 50% gesteigert werden, um einem der Anteil der Jugendlichen mit allgemeiner
gefolgt von Hessen (49 %) und dem Saarland
drohenden Mangel an wissenschaftlichen Nach- Hochschulreife in diesem Zeitraum nur um zwei
(48 %). Im Vergleich mit anderen westlichen Flä-
wuchskräften vorzubeugen. Prozentpunkte stieg. 2006 erreicht der Anteil der
chenländern bringt Bayern (35 %) in Relation zur
Studienberechtigten mit allgemeiner Hochschul-
Bevölkerung die wenigsten Studienberechtigten
reife 30 % und der Anteil der Studienberechtigten
Deutlich höhere Studienberechtigten- hervor und rangiert im Ländervergleich auf dem
mit Fachhochschulreife 14 %. Im Vergleich zum
quote bei den Frauen drittletzten Platz vor Sachsen-Anhalt (34%) und
Vorjahr ist der Anteil der Studienberechtigten mit
Mecklenburg-Vorpommern (32 %).
Insbesondere Frauen haben von der Bildungs- allgemeiner Hochschulreife um einen Prozent-
expansion profitiert: Der Anteil studienberechtig punkt gestiegen, der der Studienberechtigten mit
ter Frauen an der weiblichen Bevölkerung ist im Fachhochschulreife blieb konstant.
gleichen Zeitraum um neun Prozentpunkte von
38% auf 47% gestiegen. 2006 haben rund 47 %
der Frauen eines Altersjahrgangs einen Schulab-
Studienberechtigtenquote nach Geschlecht Einführung des 13. Schuljahrgangs in
schluss erreicht, der zum Studium qualifiziert –
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt
dieser Anteil liegt bei den Männern nur bei 40 %.
50%
Über ein Drittel der Hochschulzugangs 45%
berechtigten mit Fachhochschulreife weiblich
40%
285 500 Schulabsolventen und -absolventinnen
35%
erreichten die allgemeine Hochschulreife, die zu
männlich
einem Studium an Universitäten und Fachhoch- 30%
schulen berechtigt. 129 600 haben die Fach-
25%
hochschulreife erworben und sind damit für ein 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Studium an Fachhochschulen qualifiziert.
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 71 Eintritt in das Hochschulsystem
Übergangsquote der Abiturienten/-innen von 2000, sechs Jahre 1.2 Übergangsquote
nach dem Erwerb der Hochschulreife Die Übergangsquote gibt Auskunft darüber,
Deutschland 76,1
wie hoch der Anteil derjenigen an allen Stu-
Berlin 90,2 dienberechtigten eines Jahrgangs ist, die im
Bremen 89,0 Laufe der Zeit ein Studium an deutschen Hoch-
84,4
schulen beginnen. Dabei wird auch berück-
Bayern
sichtigt, dass der Studienbeginn zeitversetzt
Baden-Württemberg 80,8
erfolgen kann.
Hessen 79,4
Die Übergangsquote ist ein Maß für die Aus
Saarland 77,5
schöpfung des Potentials der Studienberech-
Rheinland-Pfalz 77,3
tigten.
Schleswig-Holstein 75,8
Thüringen 72,9
Mehr als ein Drittel der Abiturienten/-innen
Niedersachsen 72,8 studiert direkt nach der Schulzeit
Sachsen 71,4
2006 nehmen 34 % von insgesamt 415 000
Mecklenburg-Vorpommern 69,8 Abiturienten und Abiturientinnen noch im Jahr
Nordrhein-Westfalen 69,2 des Schulabschlusses ein Studium auf, das
Sachsen-Anhalt 68,8 sind deutlich mehr als noch im Jahr 1995 (30%).
Der Anteil der Frauen, die direkt nach der Schul-
Hamburg 68,7
zeit studieren, liegt mit 38 % höher als bei den
Brandenburg 61,7
Männern (30 %), von denen ein Teil vor Studien-
beginn Wehr- oder Zivildienstzeit ableistet. Der
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60 % 70 % 80 % 90 % 100%
Anteil der Männer, die zeitnah zum Schulab-
schluss studieren, ist in den letzten fünf Jahren
deutlich gestiegen (+8 Prozentpunkte), was
8 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008darauf zurückzuführen ist, dass diese nicht mehr Fachhochschulreife weniger stark ausgeprägt. bringt zwar vergleichsweise wenig Abiturienten
so häufig wie früher zum Wehr- und Zivildienst Nur die Hälfte (50 %) des Abschlussjahrgangs und Abiturientinnen hervor (siehe 1.1), verfügt
herangezogen werden. 2000 hat seit dem Schulabschluss ein Studium allerdings mit 84 % über die dritthöchste Über-
begonnen. gangsquote zum Hochschulsystem. Die neuen
Länder liegen nicht nur bei der Studienberech-
Ein Viertel der Studienberechtigten
tigtenquote, sondern auch was die „Ausschöp-
löst Studienoption nicht ein Ausschöpfung des Potentials der Studien-
fung“ des Potentials der Studienberechtigten
berechtigten in den neuen Ländern geringer
Abhängig von ihrer individuellen Lebensplanung im Hinblick auf eine akademische Ausbildung
schreiben sich viele Abiturienten und Abiturien- In den Stadtstaaten Berlin (90 %) und Bremen angeht, unter dem Bundesdurchschnitt. In
tinnen erst mehrere Jahre nach ihrem Schulab- (89 %) ist der Anteil der Studienberechtigten des Brandenburg liegt die Übergangsquote für den
schluss an einer Hochschule ein und absolvieren Abiturjahrgangs 2000, die bis Ende 2006 ein Abiturjahrgang 2000 mit 62 % am niedrigsten.
vor dem Studium z. B. zunächst eine Berufsaus- Studium begonnen haben, am höchsten. Bayern
bildung. Von den 347 500 studienberechtigten
Schulabgängern und -abgängerinnen des Jahres Studienberechtigte mit Studienbeginn im Jahr des Erwerbs
2000 haben sich innerhalb von sechs Jahren der Hochschulzugangsberechtigung nach Geschlecht
drei Viertel (76%) für ein Hochschulstudium
in Deutschland entschieden. Ein Viertel (24 %) 50%
hat die Studienoption bis dahin (noch) nicht n Männer n Frauen
eingelöst. 40%
Die Bildungskarrieren von Studienberechtigten Insge-
verlaufen je nach Art der erworbenen Hochschul- 30% samt
reife unterschiedlich: Von 257 700 Schulabgän-
gern und -abgängerinnen, die im Jahr 2000 die 20%
allgemeine Hochschulreife erworben hatten, die
zum Studium an Universitäten und Fachhoch- 10%
schulen berechtigt, haben sich bis Ende 2006
rund 85% für ein Studium entschieden. Die 0%
1995 2000 2002 2004 2005 2006
„Studierneigung“ ist bei Studienberechtigten mit
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 91 Eintritt in das Hochschulsystem
Studienanfängerquote 2006 Schleswig-
1.3 Studienanfängerquote
Hamburg Holstein
nach Studienort Mecklenburg-
Die Studienanfängerquote zeigt, wie hoch der
Vorpommern
Bremen Anteil der Studienanfänger an der altersspezi-
n 40 % und mehr Niedersachsen fischen Bevölkerung ist.
Berlin
n 30 bis unter 40% Brandenburg Um die Studienanfängerquote zu bilden,
n 20 bis unter 30% Sachsen-
Nordrhein- Anhalt wird für jeden einzelnen Altersjahrgang der
Westfalen
Sachsen Bevölkerung der Anteil der Studienanfän-
Thüringen
Hessen ger berechnet. Diese Anteile werden zur
Rheinland- Studienanfängerquote addiert, so dass alle
Pfalz Studienanfänger (unabhängig von ihrem Alter)
Saarland in die Studienanfängerquote einfließen (sog.
Bayern
„Quotensummenverfahren“). Als regionale
Baden-
Württemberg Bezugsgröße wird sowohl das Land des Er-
werbs der Hochschulzugangsberechtigung als
auch das Land des Studienortes verwendet.
Studienanfängerquote in %
Studienjahr Studienanfänger/-innen insgesamt Männer Frauen Studienanfängerquote stagniert bei 36%
1995 261 427 26,8 26,6 27,0 Im Studienjahr 2003 hatte die Zahl der Stu
2002 358 792 37,1 35,9 38,3 dienanfänger und -anfängerinnen mit 377 400
einen neuen Rekordwert erreicht, der die Stu-
2003 377 395 38,9 39,5 38,3 dienanfängerquote auf 39 % ansteigen ließ.
2004 358 704 37,1 37,2 37,1 Ab dem Jahr 2004 sank dann die Studienan
2005 355 961 37,0 37,1 36,9 fängerquote kontinuierlich bis zum Jahr
2006 auf nunmehr nur noch 36 %. Politisch
2006 344 822 35,7 35,5 35,9
erklärtes Ziel der Regierungskoalition ist es,
eine Quote von 40 % zu erreichen.
10 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Gegen Mitte der 1990er Jahre hatte sich die
steigende Zahl der weiblichen Studienberech- Studienanfängerquote nach Land des Erwerbs der Hochschulreife
tigten positiv auf die Studienanfängerinnenquote
Studienanfängerquote in %
ausgewirkt. 2006 liegt die Studienanfängerquote
für Männer und Frauen jeweils bei 36 %. Bundesland 2005 2006
Hessen 35,7 34,8
Unterdurchschnittlich viele Studienanfänger Saarland 35,1 33,9
aus den neuen Ländern Hamburg 31,9 33,5
Errechnet man die Studienanfängerquote bezo Bremen 33,3 32,7
gen auf das Land, in dem die Hochschulreife
Baden-Württemberg 32,0 31,9
erworben wurde (ohne Studienanfänger und
-anfängerinnen aus dem Ausland), liegt das Nordrhein-Westfalen 33,9 31,6
bundesweite Ländermittel bei 30 % und somit Berlin 31,8 31,2
einen Prozentpunkt unter dem Wert von 2005. Rheinland-Pfalz 30,5 30,0
Da die neuen Länder im Vergleich zum übrigen Thüringen 30,9 29,9
Bundesgebiet über ein relativ geringes Potential
Niedersachsen 30,0 28,5
an Studienberechtigten (siehe 1.1) verfügen,
bleiben auch die Studienanfängerquoten der Schleswig-Holstein 29,0 28,1
östlichen Länder hinter dem Ländermittel von Bayern 27,7 27,7
30% zurück.
Sachsen 28,0 27,3
Sachsen-Anhalt 28,5 26,9
Brandenburg 28,2 26,9
Mecklenburg-Vorpommern 25,0 25,0
Deutschland (ohne Erwerb der Hochschulreife im Ausland) 31,0 30,1
Deutschland (einschl. Erwerb der Hochschulreife im Ausland) 37,0 35,7
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 111 Eintritt in das Hochschulsystem
Hessen bringt relativ zur Bevölkerung Höchste Studienanfängerdichte in den Stadt-
die meisten Studienanfänger hervor staaten und in westlichen Flächenländern
An den Hochschulen im Bundesgebiet schrieben Der Anteil der Erstimmatrikulierten bezogen auf
sich 2006 rund 23 200 Studienanfänger und die Einwohner am Studienort, liefert Informati-
-anfängerinnen aus Hessen ein. Daraus ergibt onen zur Studienanfängerdichte in den Ländern.
sich (bezogen auf die hessische Bevölkerung) In Bremen (59 %), Hamburg (55 %) und Berlin
mit 35% die bundesweit höchste Studienanfän- (47 %) leben 2006 im Verhältnis zur gleichaltri
gerquote. Auf dem zweiten Rang liegt das Saar- gen Bevölkerung die meisten Erstimmatrikulier-
land (34%), gefolgt von Hamburg mit ebenfalls ten. Die Stadtstaaten üben aufgrund der Vielfalt
34 % und Bremen (33%). Mecklenburg-Vorpom- an Studienmöglichkeiten und der sozialen und
mern bringt mit 25% die wenigsten Erstimmatri- kulturellen Angebote auf engem Raum eine stär-
kulierten hervor. kere Anziehungskraft auf Studienanfänger und
-anfängerinnen als andere Länder aus.
Hessen ist das Flächenland mit der höchsten
Studienanfängerdichte (43 %), darauf folgen
Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg (je-
weils 38 %) sowie Nordrhein-Westfalen mit 37 %.
12 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 13
1 Eintritt in das Hochschulsystem
Durchschnittsalter der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester) 1.4 Durchschnittsalter der
Studienanfänger/-innen
Durchschnittsalter bei Studienbeginn
Die Kennzahl gibt Auskunft über das durch-
Studienjahr insgesamt Männer Frauen
schnittliche Alter der Studienanfänger und
1995 22,5 22,9 22,1
-anfängerinnen beim Eintritt in den Hoch-
2002 22,2 22,6 21,8 schulbereich.
2003 22,1 22,4 21,8 Sie ist zusammen mit der Kennzahl „Durch-
2004 22,1 22,4 21,7 schnittsalter der Erstabsolventen“ ein wich-
tiger Leistungsindikator für das Bildungs-
2005 22,0 22,3 21,7
system.
2006 21,9 22,2 21,6
Erstimmatrikulierte werden jünger
Die Studienanfänger und -anfängerinnen an
deutschen Hochschulen sind 2006 durch
schnittlich 21,9 Jahre alt. Das Alter der
Erstimmatrikulierten wird vom Alter bei der
Einschulung, der Dauer des Schulbesuchs
und den Zeiten, die z. B. für Wehr- und Zivil-
dienst aufgewendet werden müssen, beein-
flusst. Außerdem haben einige Studienanfän-
ger und -anfängerinnen zunächst eine Lehre
absolviert, bevor sie sich für ein Studium
entscheiden.
Die Erstimmatrikulierten des Studienjahres
2006 sind durchschnittlich ein halbes Jahr
14 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008jünger als 1995. Im Vergleich zum Vorjahr ist Ein unterdurchschnittliches Studieneintrittsalter (21,4) zu beobachten. In diesen Fächern sind
das Durchschnittsalter über alle Fächer um gut ist in den Studienfächern Mathematik (20,7 Jah- Studienanfängerinnen deutlich mit 58% bis
einen Monat gesunken. Bedingt durch die ab- re), Rechtswissenschaften (21,1), Germanistik/ 78 % überrepräsentiert (der Durchschnitt liegt
zuleistenden Wehr- und Zivildienstzeiten sind Deutsch (21,3) sowie Medizin/Allgemeinmedizin im Studienjahr 2006 bei 49 %).
die jungen Männer bei der Ersteinschreibung
mit durchschnittlich 22,2 Jahren mehr als ein
halbes Jahr älter als die Studienanfängerinnen
(21,6 Jahre).
Ausländische Studienanfänger/-innen Durchschnittsalter der Studienanfänger/-innen (1. Hochschulsemester)
sind deutlich älter in den zehn beliebtesten Studienfächern 2006
In den Durchschnittswert fließen auch mobile Durchschnittsalter über alle Fächer 21,9
Studierende aus dem Ausland ein, die zum
Mathematik 20,7
ersten Mal an einer deutschen Hochschule ein-
Rechtswissenschaften 21,1
geschrieben sind. Da sie vielfach bereits in ihren
Heimatländern studiert haben, sind sie 2006 mit Germanistik/Deutsch 21,3
durchschnittlich 23,4 Jahren gut 1,5 Jahre älter, Medizin (Allgemein-Medizin) 21,4
als deutsche Studienanfänger (21,6). Maschinenbau/-wesen 21,6
Informatik 21,9
Hoher Anteil weiblicher Studienanfängerinnen - Wirtschaftsingenieurwesen 22,1
unterdurchschnittliches Studienanfängeralter
Elektrotechnik/Elektronik 22,1
Das Durchschnittsalter der Studienanfänger Betriebswirtschaftslehre 22,2
und -anfängerinnen ist in den einzelnen Studien
Wirtschaftswissenschaften 22,6
fächern unterschiedlich. Die Spanne zwischen
dem niedrigsten und höchsten Eintrittsalter Altersjahre 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23
variiert bei den zehn beliebtesten Studienf ächern
des Jahres 2006 um fast zwei Jahre.
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 152 Daten und Fakten zu Hochschulabsolventen/-innen
Erstabsolventenquote nach Bundesländern 2006 2.1 Erstabsolventenquote
Vorjahr Deutschland
Die Erstabsolventenquote zeigt, wie hoch der
21,1 22,2
Anteil der Absolventen eines Erststudiums an
Bremen 36,2 der altersspezifischen Bevölkerung ist. Sie
Berlin 32,2 misst damit den realen Output der Hochschu-
26,7
len in Form von Absolventen, die einen ersten
Hamburg
akademischen Abschluss erworben haben.
Nordrhein-Westfalen 23,2
23,2
Die Berechnung erfolgt wie bei der Studien-
Hessen
anfängerquote nach dem Quotensummenver-
Baden-Württemberg 22,7
fahren: Es wird zunächst für jeden einzelnen
Sachsen 22,2
Altersjahrgang der Bevölkerung der Anteil
Rheinland-Pfalz 21,5 der Erstabsolventen berechnet. Diese Anteile
Niedersachsen 21,4 werden anschließend addiert, so dass alle
Bayern 20,7 Absolventen mit in die Kennzahl eingehen.
Thüringen 20,5
Mecklenburg-Vorpommern 17,6 Erstabsolventenquote nimmt weiter zu
Sachsen-Anhalt 17,0 Die Zahl der Erstabsolventen und -absolvent-
Saarland 15,9 innen stieg im Prüfungsjahr 2006 auf
220 800, damit erreichte die Quote mit 22%
Schleswig-Holstein 15,7
einen neuen Höchststand (2005: 21 %).
Brandenburg 15,7
Betrachtet man ausschließlich die deutschen
Absolventen und Absolventinnen liegt die
0% 5% 10% 15% 20% 25 % 30 % 35 %
Quote mit 24 % etwas höher.
Der kontinuierliche Anstieg in den letzten Jah-
ren ist vor allem auf die wachsende Zahl der
16 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Erstabsolventinnen zurückzuführen. 2006 er Rückgänge in Berlin, Rheinland-Pfalz bezogen auf die Einwohnerzahl erheblich höher
reicht die Quote bei den Frauen 23 % und bei und im Saarland als in den Flächenländern. Bremen verzeichnet
den Männern 21%, das entspricht jeweils einem im Vergleich zum Vorjahr mit vier Prozentpunkten
Hochschulen und ihr Output in Form von hoch
Zuwachs von einem Prozentpunkt gegenüber den höchsten Zuwachs und verdrängt Berlin
qualifizierten Nachwuchskräften sind von be-
dem Vorjahr. Der Anteil der Frauen mit Studien- von Platz eins. Diese Steigerung ist unter ande-
sonderer Bedeutung für die regionale Wirtschaft.
abschluss ist (bezogen auf die altersspezifische rem auf die Neugründung und den Ausbau von
Die Erstabsolventenquote wird (wie die Studien-
weibliche Bevölkerung) zwischen 1997 und 2006 Hochschulen um die Jahrtausendwende
anfängerquote) vom Umfang, der Struktur und
um neun Prozentpunkte angestiegen, bei den zurückzuführen. Im Bundesdurchschnitt stieg
der Attraktivität der Studienangebote in den
Männern um drei Prozentpunkte. die Erstabsolventenquote um einen Prozent
einzelnen Ländern beeinflusst. In den Stadt-
punkt gegenüber 2005. Rückgänge verzeich
Um den steigenden Bedarf an hoch qualifizierten staaten Berlin (32 %), Bremen (36 %) und Ham-
neten Berlin (-1 Prozentpunkt), Rheinland-
Arbeitskräften in den kommenden Jahrzehnten burg (27 %), die auch über die höchste Studien-
Pfalz (-0,4 Prozentpunkte) und das Saarland
abdecken zu können, muss die Absolventenquo- anfängerdichte verfügen, ist der Output an
(-0,2 Prozentpunkte).
te aus Sicht des Wissenschaftsrates mittelfristig akademisch ausgebildeten Nachwuchskräften
weiter gesteigert werden. Dieses Ziel soll nach
Auffassung der Bildungsexperten durch eine
Erweiterung der Studienkapazitäten an den Anzahl der Erstabsolventen/-innen und Erstabsolventenquote
Hochschulen realisiert werden.
Erstabsolventen/ Erstabsolventenquote in %
Bei einer Gegenüberstellung der Absolventen-
quote des Jahres 2006 (22 %) und der Studien Prüfungsjahr -innen insgesamt insgesamt Männer Frauen
anfängerquote (32%) sechs Jahre zuvor (rund 1997 201 073 16,4 18,0 14,6
sechs Jahre beträgt die durchschnittliche Stu- 2002 172 606 17,4 17,5 17,2
diendauer) ergibt sich eine Differenz von 10
2003 181 528 18,4 18,2 18,7
Prozentpunkten. Diese Differenz weist auf den
Umfang des Studienabbruchs an deutschen 2004 191 785 19,5 19,2 19,7
Hochschulen hin. 2005 207 936 21,1 20,5 21,6
2006 220 782 22,2 21,3 23,2
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 172 Daten und Fakten zu Hochschulabsolventen/-innen
Mittlere Fachstudiendauer (Median) von Erstabsolventen/-innen Median
2.2 Fach- und
in ausgewählten Studienbereichen 2006 unteres Quartil oberes Quartil Gesamtstudiendauer
Universitätsdiplom und entsprechende Abschlüsse
Die Fachstudiendauer gibt die Zahl der Se-
Rechtswissenschaft mester an, die bis zum bestandenen Erstab-
Betriebswirtschaftslehre schluss in einem bestimmten Studiengang
Wirtschaftswissenschaften benötigt wurde. Die Gesamtstudiendauer be-
Erziehungswissenschaft
zieht sich auf die Zahl der Semester, die ins-
Biologie
gesamt im Hochschulsystem verbracht wur-
Psychologie
Maschinenbau den. Beide Kennzahlen sind Erfolgsindikato-
Germanistik ren. Sie beschreiben, wie schnell die Studie-
Informatik renden in einzelnen Studiengängen zu einem
Medizin
Erstabschluss gelangen.
Fachsemester 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Studienzeiten bewegen sich nach
Fachhochschulabschluss
Art des Abschlusses zwischen sechs
Verwaltungswissenschaft und elf Semestern
Polizei/Verfassungsschutz
Sozialwesen Die Studiendauer ist ein zentrales Thema in
Wirtschaftswissenschaften der hochschulpolitischen Diskussion, da
Maschinenbau
der finanzielle Aufwand für ein Studium mit
Betriebswirtschaftslehre
Wirtschaftsingenieurwesen
der Studiendauer steigt. Außerdem ist die
Elektrotechnik Studiendauer neben dem Alter der Hochschul-
Informatik absolventen ein wichtiges Kriterium für einen
Architektur erfolgreichen Berufseinstieg.
Fachsemester 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
18 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Die mittlere Fachstudiendauer der Erstabsol- Die mittleren Fachstudienzeiten in Fächern wie
venten und -absolventinnen des Prüfungsjahr- Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissen
gangs 2006, die ein Universitätsdiplom oder ent- schaften, Maschinenbau und Informatik, die
sprechende Abschlüsse erworben haben, liegt sowohl an Universitäten als auch an Fachhoch-
bei 11,1 Semestern. Angehende Lehrerinnen schulen angeboten werden, sind an Fachhoch-
und Lehrer brauchen im Mittel 8,9 Semester bis schulen deutlich kürzer und variieren weniger
zum ersten Staatsexamen. Die Fachstudiendauer stark als an Universitäten.
von Erstabsolventen mit Fachhochschuldiplom
liegt bei 8,5 Semestern. Sie ist bei Bachelor-
absolventen mit 6,2 Semestern deutlich kürzer.
Die mittlere Gesamtstudiendauer von Universi-
tätsabsolventen beträgt 12,0 Semester. Sie
ist an Fachhochschulen mit 8,8 Semestern Mittlere Fach- und Gesamtstudiendauer (Median) von n Fachstudiendauer
wesentlich kürzer. In die Gesamtstudienzeit Erstabsolventen/-innen nach Abschlussarten 2006 n Gesamtstudiendauer
fließen alle Semester mit ein, die an deutschen
Hochschulen verbracht wurden, auch wenn diese
nicht in Beziehung zum Studienfach stehen, in Bachelorabschluss
dem der Abschluss erworben wurde.
Die Studiendauer unterscheidet sich an Universi-
Fachhochschulabschluss
täten je nach Studienfach erheblich. Die mittlere
Fachstudiendauer angehender Juristen und
Juristinnen liegt bei 9,3 Semestern, während Lehramt
Mediziner und Medizinerinnen 12,8 Semester bis
zum Ende ihrer Hochschulausbildung brauchen. Universitätsdiplom und
entsprechende Abschlüsse
Semester 0 2 4 6 8 10 12 14
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 192 Daten und Fakten zu Hochschulabsolventen/-innen
Durchschnittsalter der Erstabsolventen/-innen 2.3 Durchschnittsalter
Durchschnittsalter der Erstabsolventen/-innen
der Erstabsolventen/-innen
Prüfungsjahr insgesamt Männer Frauen Die Kennzahl gibt Auskunft über das durch-
1995 27,8 28,2 27,3 schnittliche Alter von Hochschulabsolventen
beim Erreichen des ersten akademischen
2002 28,1 28,5 27,7
Abschlusses.
2003 27,9 28,4 27,5
Sie ist ein Erfolgsindikator, der Informationen
2004 27,9 28,3 27,4 über das Alter potentieller Berufseinsteiger
2005 27,8 28,2 27,4 liefert.
2006 27,7 28,1 27,3
Durchschnittsalter der
Erstabsolventen/-innen bei 28 Jahren
Das Durchschnittsalter der 220 800 Erstab-
solventen und -absolventinnen des Prüfungs-
jahrgangs 2006 liegt bei 27,7 Jahren. Im Ver-
gleich zum Prüfungsjahr 2002 sind die
Absolventinnen und Absolventen 2006 aller-
dings um 0,4 Jahre jünger. Es ist zu erwarten,
dass das Durchschnittsalter im Zuge der
fortschreitenden Etablierung der neuen
Bachelorabschlüsse – deren Regelstudien-
zeiten deutlich kürzer sind als in den her-
kömmlichen Diplomstudiengängen an Uni-
versitäten und Fachhochschulen – und wegen
20 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008des niedrigeren Durchschnittsalters der Stu- variiert nicht nur nach Fächern, sondern auch fügig jünger. Angehende Lehrerinnen und Lehrer
dienanfänger in den nächsten Jahren weiter nach der Art des erworbenen akademischen legen das Staatsexamen mit 27,2 Jahren ab. Im
sinken wird. Grades (siehe 2.2). direkten Vergleich mit den Erstabsolventen der
gleichwertigen Fachhochschulstudiengänge
Frauen sind bei Abschluss des Studiums durch- Erstabsolventen und -absolventinnen, die einen
haben Bachelorabsolventen mit derzeit durch-
schnittlich fast ein Jahr jünger als Männer. Be- Universitätsabschluss erwerben, sind durch-
schnittlich 25,8 Jahren einen Altersvorsprung
reits beim Eintritt in das Hochschulsystem haben schnittlich genau 27,9 Jahre alt. Absolventen mit
von zwei Jahren.
Frauen einen Altersvorsprung von einem guten Fachhochschuldiplom sind mit 27,8 nur gering-
halben Jahr, da viele Männer vor Studienbeginn
Wehr- und Zivildienstzeiten ableisten (siehe 1.4).
Das Alter der Absolventen und Absolventinnen
wird neben dem Eintrittsalter von der Studien-
dauer beeinflusst, die wiederum von der fach- Durchschnittsalter der Erstabsolventen/-innen in den zehn beliebtesten Studienfächern 2006
lichen Ausrichtung und der Art des erworbenen
Durchschnittsalter
akademischen Grades abhängt. über alle Fächer
Rechtswissenschaft 26,5
27,7
Biologie 26,9
Angehende Mediziner sind nach dem Staatsexa-
Germanistik/Deutsch 27,2
men durchschnittlich zwei Jahre älter als Juristen
Betriebswirtschaftslehre 27,3
Der Unterschied im Durchschnittsalter der Erst-
Wirtschaftsingenieurwesen 27,5
absolventen und -absolventinnen in den zehn
Maschinenbau/-wesen 27,5
beliebtesten Studienfächern lag 2006 bei fast
zwei Jahren. Angehende Mediziner und Medizine- Informatik 27,6
rinnen sind bei Studienabschluss durchschnitt- Elektrotechnik/Elektronik 27,6
lich 28,4 Jahre alt, während die angehenden Wirtschaftswissenschaften 28,1
Juristen und Juristinnen das erste Staatsexamen
Medizin (Allgemein-Medizin) 28,4
mit durchschnittlich 26,5 Jahren ablegen. Das
Alter der Erstabsolventen und -absolventinnen Altersjahre 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 213 Personalstruktur, Betreuung und Effektivität
Betreuungsrelation (ohne Humanmedizin) nach Hochschulart und Bundesländern 2006 3.1 Betreuungsrelation
Universitäten Fachhochschulen
Die Kennzahl beschreibt das zahlenmäßige
18,2 26,5 Verhältnis der Studierenden zum wissen-
Sachsen-Anhalt 14,2 25,6 schaftlichen und künstlerischen Personal
Saarland 14,9 22,5 (ohne drittmittelfinanziertes Personal; in
15,2 26,5
Vollzeitäquivalenten). Das wissenschaftliche
Thüringen
Personal nimmt neben der Betreuung von
Bayern 15,8 25,0
Studierenden in unterschiedlichem Umfang
Baden-Württemberg 16,0 22,4 auch Aufgaben auf dem Gebiet der Forschung
Sachsen 16,8 28,6 und im Bereich der Humanmedizin auch in der
Niedersachsen 16,9 22,0 Krankenbehandlung wahr.
Mecklenburg-Vorpommern 17,0 23,1 Der Indikator wird häufig zur Messung der
Schleswig-Holstein 17,3 34,2 Studienbedingungen und der Ausbildungs-
Berlin 17,9 26,4
qualität herangezogen.
Hessen 17,9 26,6
Hamburg 19,1 28,0 Zahl der Studierenden je Lehrperson
sinkt geringfügig
Brandenburg 19,3 24,7
Bremen 19,3 28,9 Statistisch gesehen entfallen an deutschen
Hochschulen in 2006 rund 15,5 Studierende
Nordrhein-Westfalen 22,5 32,7
auf eine wissenschaftliche Lehrkraft. Eine
Rheinland-Pfalz 23,3 26,1
Lehrperson betreut damit rechnerisch 0,1 Stu
dierende weniger als im Vorjahr. Das Betreu-
Studierende je Lehrperson 0 5 10 15 20 25 30 35
ungsverhältnis stellt sich je nach fachlicher
n Universitäten n Fachhochschulen Ausrichtung des Studiums unterschiedlich
dar. Die Fächergruppe Humanmedizin/Ge-
22 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008sundheitswissenschaften ist mit Abstand am schaften verschlechterte sich das Betreuungs- Ländern Rheinland-Pfalz mit 23,3 und Nordrhein-
personal- und kostenintensivsten (siehe 5.1). verhältnis sowohl in den Universitäten als auch Westfalen mit 22,5 dar. Im Vergleich zu Sachsen-
Eine Lehrkraft betreut hier rechnerisch 3,4 Stu insbesondere in den Fachhochschulen. Anhalt und dem Saarland betreut in diesen Län-
dierende. Bleibt das Medizinstudium bei der dern eine Lehrkraft über 50% Studierende mehr.
Berechnung unberücksichtigt, liegt die Betreu- Betreuungsrelation liegt in den Ländern An Fachhochschulen ist das Betreuungsverhältnis
ungsrelation im Bundesdurchschnitt bei 19,9 zwischen 14 und 23 Studierenden je Lehrkraft in Niedersachsen (22,0) und in Baden-Württem-
Studierenden je Person des wissenschaftlichen berg (22,4) am niedrigsten.
Ohne Berücksichtigung der Fächergruppe
und künstlerischen Personals. Am wenigsten
Humanmedizin verfügen Sachsen-Anhalt mit Abweichungen in den Betreuungsrelationen er-
personalintensiv ist die Fächergruppe Rechts-,
14,2 und das Saarland mit 14,9 Studierenden je klären sich z.T. durch differierende Forschungsin
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hier
Lehrkraft an Universitäten über die günstigste tensitäten sowie unterschiedliche Hochschul- und
entfallen 31,3 Studierende auf eine Lehrperson.
Betreuungsrelation. Am schlechtesten stellt sich Fächerstrukturen, die eine unterschiedliche Per-
Zwischen Universitäten und Fachhochschulen die Betreuungssituation an Universitäten in den sonalausstattung erforderlich machen können.
bestehen deutliche Unterschiede in der Personal-
struktur, die sich auf das Betreuungsverhältnis Betreuungsrelation nach Hochschulart in ausgewählten Fächergruppen 2006
auswirken. Das Betreuungsverhältnis an Uni-
versitäten (ohne Medizin) stellt sich mit 18,2 Hochschulen insgesamt Universitäten Fachhochschulen
deutlich günstiger dar als bei den Fachhochschu- Ausgewählte Fächergruppen Studierende je Lehrkraft
len mit 26,5 Studierenden je Lehrperson, da Fach- Sprach- und Kulturwissenschaften 24,7 24,9 20,6
hochschulen keinen vergleichbaren akademi- Rechts-, Wirtschafts- und
schen Mittelbau haben. An Universitäten entfal- Sozialwissenschaften 31,3 33,5 32,5
len auf eine(n) Professor/-in 2,7 Mitarbeiter aus Mathematik, Naturwissenschaften 15,7 14,0 31,1
dem Mittelbau, an Fachhochschulen weniger als
Humanmedizin (einschl.
eine Person (0,6). Im Vergleich zu 2005 blieb das Gesundheitswissenschaften 3,4 3,0 43,1
Betreuungsverhältnis an Universitäten unverän-
Ingenieurwissenschaften 17,5 12,8 23,8
dert. Bei den Fachhochschulen hat es sich rech-
nerisch mit einem zusätzlichen Studierenden Alle Fächergruppen 15,5 13,3 26,8
verschlechtert. In den Fächerg ruppen Mathema- Alle Fächergruppen
tik/Naturwissenschaften sowie Ingenieurwissen- ohne Humanmedizin 19,9 18,2 26,5
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 233 Personalstruktur, Betreuung und Effektivität
Erstausbildungsquote (ohne Humanmedizin) nach Bundesländern 2006 3.2 Erst- und Gesamt-
Vorjahr 2,1 Deutschland 2,2
ausbildungsquote
Die Erstausbildungsquote weist die Anzahl
Nordrhein-Westfalen 2,50
der Erstabsolventen im Verhältnis zum wis-
Niedersachsen 2,37
senschaftlichen und künstlerischen Personal
Berlin 2,34 aus. Die Gesamtausbildungsquote misst das
Rheinland-Pfalz 2,27 entsprechende Verhältnis für die Absolventen
Brandenburg 2,22 insgesamt (Erstabsolventen, Absolventen wei-
terführender Studiengänge und Promotionen).
Bremen 2,21
Schleswig-Holstein 2,18 Die Indikatoren messen den „Output“ an
Absolventen in Abhängigkeit von den verfüg-
Baden-Württemberg 2,16
baren personellen Ressourcen und sind damit
Hamburg 2,14
Kenngrößen für die Leistungsfähigkeit und
Bayern 2,14 Effektivität der Hochschulen.
Sachsen 2,10
Thüringen 2,08 Mehr Absolventen/-innen je Lehrkraft
Hessen 2,07
Auf eine wissenschaftliche Lehrkraft entfallen
Mecklenburg-Vorpommern 1,97 2006 rechnerisch 1,7 Erstabsolventen. Im
Sachsen-Anhalt 1,64 Vergleich zum Vorjahr ist der „Output“ an
Saarland 1,49 Erstabsolventen in fast allen Fächergruppen
leicht angestiegen. Trotz oder gerade wegen
Erstabsolventen/-innen 0 0,5 1 1,5 2 2,5 der vergleichsweise schlechten Betreuungssi-
je Lehrperson tuation (siehe 3.1) ist die Erstausbildungsquo-
te in den Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften mit 4,1 und in den Sprach- und
24 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Kulturwissenschaften mit 2,3 Erstabsolventen Ländervergleich nicht berücksichtigt. Der „Out- In fast allen Ländern hat sich die Erstausbildungs-
je Lehrperson am höchsten. In der personalin- put“ an Erstabsolventen und -absolventinnen je quote gegenüber dem Vorjahr aufgrund der stei-
tensivsten Fächergruppe Humanmedizin werden Lehrperson ist in Nordrhein-Westfalen (2,5) und genden Erstabsolventenzahlen erhöht. Die höch-
mit rechnerisch 0,4 Erstabsolventen je Lehrkraft Niedersachsen (2,4) am höchsten. Das Saarland sten Zuwächse verzeichnen Nordrhein-Westfalen
deutlich weniger Studierende zum Abschluss (1,5) und Sachsen-Anhalt (1,6) verfügen über die (+0,4) und Brandenburg (+0,3). Ein Rückgang wird
geführt. niedrigsten Erstausbildungsquoten. Das wissen- in Schleswig-Holsein (-0,2) beobachtet. Abwei-
schaftliche Lehrpersonal in beiden Bundeslän- chungen zwischen den Ländern erklären sich zum
Die Gesamtausbildungsquote liegt bundesweit
dern bringt rechnerisch in einem Jahr etwa einen Teil durch differierende Forschungsintensitäten
bei 2,1 Absolventen bzw. Absolventinnen je
Erstabsolventen weniger hervor, als das der sowie unterschiedliche Hochschul- und Fächer-
Lehrperson. Da die Promotion für angehende
Hochschulen in Niedersachsen und Berlin. strukturen, die eine unterschiedliche Personal-
Mediziner im Vergleich zu anderen Fächern den
ausstattung erforderlich machen können.
Stellenwert eines Regelabschlusses hat, ist die
Gesamtausbildungsquote in Medizin (0,6) um
50% höher als die Erstausbildungsquote. Erst- und Gesamtausbildungsquoten in ausgewählten Fächergruppen
Auch ohne Berücksichtigung der Humanmedizin Auf eine Lehrkraft entfallen ...
ist die Erstausbildungsquote an Fachhochschulen Erstabsolventen/-innen Absolventen/-innen insgesamt
2006 mit einem „Output“ von knapp vier Absol-
Ausgewählte Fächergruppen 2005 2006 2005 2006
venten (3,6) je Lehrkraft fast doppelt so hoch wie
Sprach- und Kulturwissenschaften 2,1 2,3 2,5 2,7
an Universitäten (1,8), obwohl die Betreuungs-
situation aufgrund des fehlenden Mittelbaus Rechts-, Wirtschafts-
und Sozialwissenschaften 3,9 4,1 4,4 4,6
an Fachhochschulen rechnerisch schlechter ist
(siehe 3.1). Ein ähnliches Bild ergibt sich bei der Mathematik, Naturwissenschaften 1,3 1,5 1,7 1,9
Gesamtausbildungsquote, die an Universitäten Humanmedizin (einschl.
bei 2,2 und an Fachhochschulen bei 3,9 liegt. Gesundheitswissenschaften) 0,4 0,4 0,7 0,6
Ingenieurwissenschaften 1,8 1,9 2,1 2,2
Erstausbildungsquote steigt Alle Fächergruppen 1,6 1,7 2,0 2,1
Da nicht alle Länder über medizinische Fakul- Alle Fächergruppen
ohne Humanmedizin 2,1 2,2 2,4 2,6
täten verfügen, wird die Humanmedizin beim
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 253 Personalstruktur, Betreuung und Effektivität
Promotionsquote an Universitäten (ohne Humanmedizin) nach Bundesländern 2006 3.3 Promotionsquote
Die Promotionsquote misst die Anzahl der
Deutschland 0,8 Vorjahr 0,9
Promotionen je Professor/-in (ohne drittmit-
Baden-Württemberg 1,01 telfinanzierte Professoren/-innen; in Vollzeit-
Bayern 0,95 äquivalenten).
Berlin 0,91 Sie ist ein Indikator für die Leistungsfähigkeit
Nordrhein-Westfalen 0,90 und Effektivität der Universitäten im Hinblick
0,89
auf die Qualifikation des wissenschaftlichen
Niedersachsen
Nachwuchses. Da das Anfertigen der Disserta-
Hessen 0,86
tion als Forschungstätigkeit angesehen wird,
Schleswig-Holstein 0,84
gilt die Promotionsquote auch als Forschungs-
Hamburg 0,79 indikator.
Rheinland-Pfalz 0,71
Saarland 0,71 Promotionsquote bleibt konstant
Brandenburg 0,70
2006 wurden an Universitäten und gleich-
Mecklenburg-Vorpommern 0,66 gestellten Hochschulen insgesamt 24 100
Bremen 0,62 Doktortitel verliehen. Damit entfällt bundes-
Sachsen 0,59 weit gut eine Promotion (1,1) auf jeden Uni-
versitätsprofessor bzw. jede -professorin. Die
Sachsen-Anhalt 0,55
Promotionsquote ist damit gegenüber 2005
Thüringen 0,50
konstant geblieben. In der Fächergruppe
Humanmedizin/Gesundheitswissenschaften
Promotionen je 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2
Universitätsprofessor/-in (2,6) liegt die Promotionsquote deutlich über
diesem Durchschnittswert, da der Doktortitel
für angehende Mediziner fast den Stellenwert
26 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008eines Regelabschlusses hat. Während die Fächer- unterschiedliche Qualifikationsschwerpunkte. Württemberg und Schleswig-Holstein (jeweils
gruppen Mathematik/Naturwissenschaften sowie Betrachtet man die Humanmedizin/Gesundheits- 1,5) die höchsten Promotionsquoten auf. In den
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften wissenschaften separat, erzielen Schleswig- Ingenieurwissenschaften liegen die Promotions-
(jeweils 1,2) und die Ingenieurwissenschaften Holstein (jeweils 3,9) und Thüringen (4,0) sowie quoten in Baden-Württemberg und dem Saarland
(0,9) Promotionsquoten aufweisen, die nahe Baden-Württemberg (3,4) mit über 3 Promotio (jeweils 1,3) weit über dem Durchschnitt aller
dem Durchschnittswert liegen, bringen Profes- nen je Professor bzw. Professorin Spitzenwerte. Bundesländer.
soren und Professorinnen in den Sprach- und In Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaf
Kulturwissenschaften (0,5) vergleichsweise ten werden in Baden-Württemberg (1,5), Nord-
wenige Absolventen und Absolventinnen mit rhein-Westfalen (1,4) und Schleswig-Holstein
Doktortitel hervor. (1,7) überdurchschnittlich viele wissenschaft-
liche Nachw uchskräfte ausgebildet. In Mathe-
Die Hochschulsysteme der Länder sind an der
matik/Naturwissenschaften weisen Baden-
Ausbildung des hoch qualifizierten wissen-
schaftlichen Nachwuchses unterschiedlich stark
beteiligt. Da nicht alle Bundesländer über die
Fächergruppe Humanmedizin/Gesundheitswis-
Promotionsquote an Universitäten in ausgewählten Fächergruppen
senschaften verfügen, wird sie zunächst nicht in
den Ländervergleich einbezogen. Baden-Würt
Promotionen je Professor/-in
temberg (1,0) und Bayern (0,9) verfügen 2006
über die höchste Promotionsquote (Bundes- Ausgewählte Fächergruppen 2005 2006
durchschnitt 0,8). Die niedrigsten Promotions- Sprach- und Kulturwissenschaften 0,5 0,5
quoten weisen Thüringen und Sachsen-Anhalt Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 1,2 1,2
(jeweils 0,5) auf.
Mathematik, Naturwissenschaften 1,2 1,2
Humanmedizin (einschl. Gesundheitswissenschaften) 2,8 2,6
Länder haben unterschiedliche
Qualifikationsschwerpunkte Ingenieurwissenschaften 1,0 0,9
Die Länder haben bei der Ausbildung des wis Alle Fächergruppen 1,1 1,1
senschaftlichen Nachwuchses an Universitäten Alle Fächergruppen ohne Humanmedizin 0,9 0,8
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 273 Personalstruktur, Betreuung und Effektivität
Anteil der Professorinnen nach Bundesländern 2006 3.4 Frauenanteile
Die Anteilswerte geben Auskunft über die
Vorjahr 14,3 Deutschland 15,2 Entwicklung der geschlechterspezifischen
Berlin 21,1 Bildungsbeteiligung und Chancengleichheit
Niedersachsen 20,2 im Hochschulbereich. Sie liefern wichtige
Informationen zur Planung gleichstellungs
Hamburg 18,7
politischer Maßnahmen und zu deren Erfolgs-
Bremen 18,6
kontrolle.
Brandenburg 17,7
Hessen 17,1
Mehr als die Hälfte der Erstabsolventen
Sachsen-Anhalt 15,7 sind Frauen
Sachsen 15,4
Die Regierungskoalition hat sich zum Ziel
Nordrhein-Westfalen 14,8
gesetzt, die Karrierechancen von Frauen in
Saarland 14,1 Lehre und Forschung zu verbessern. Die Bar-
Mecklenburg-Vorpommern 14,0 rieren für den Zugang junger Frauen zu einer
Baden-Württemberg 13,3 akademischen Ausbildung scheinen 2006
fast abgebaut: Fast die Hälfte (49 %) der Erst
Rheinland-Pfalz 13,0
immatrikulierten sind weiblich und erstmals
Thüringen 12,7
erwerben mehr Frauen als Männer (52%)
Bayern 11,1 einen Erstabschluss. Im Jahr 2000 hatte der
Schleswig-Holstein 10,6 Frauenanteil bei den Erstabsolventen nur
46 % betragen. Auch auf den weiterführenden
0% 5% 10% 15 % 20 % 25 % Qualifikationsstufen sind die Frauenanteile in
den letzten Jahren gestiegen. Während im Jahr
2000 nur 34 % der Promotionen von Frauen
erworben wurden, betrug 2006 dieser Wert
28 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 200841%. Nach wie vor nimmt der Frauenanteil mit Berlin (21 %) und Niedersachsen (20 %) verfügen Sprach- und Kulturwissenschaften (26%) bei den
steigendem Qualifikationsniveau der einzelnen über den höchsten Professorinnenanteil. In bei- Professoren überdurchschnittlich stark vertreten
Positionen kontinuierlich ab: bei den Habilita- den Ländern ist jede fünfte Professorenstelle sind, sind sie in den Naturwissenschaften (10%)
tionen liegt die Frauenquote bei 22 %. Deutlich mit einer Frau besetzt, in Bayern und Schleswig- und in den Ingenieurwissenschaften (7%) deut-
höher ist der Frauenanteil bei den Juniorprofes- Hostein (jeweils 11 %) nur etwa jede zehnte. lich unterrepräsentiert.
suren (31%), die einen alternativen Qualifizie-
Die Frauenanteile variieren erheblich zwischen
rungsweg zur klassischen Habilitation darstellen.
einzelnen Fächergruppen. Während Frauen in
Kunst/Kunstwissenschaft (27 %) und in den
Hohe Frauenanteile bei Erstimmatrikulierten
setzen sich nicht bis zu höheren Positionen
beim Hochschulpersonal fort
Frauenanteile in verschiedenen Stadien der akademischen Laufbahn
2006 sind fast eine halbe Million Menschen an
deutschen Hochschulen beschäftigt, davon 51% Frauenanteile in %
Frauen. In beruflichen Positionen im Bereich For- Personengruppe 2000 2003 2004 2005 2006
schung und Lehre sind diese allerdings immer
Studienanfänger/-innen 49,2 48,2 48,8 48,8 49,4
noch unterrepräsentiert: Ihr Anteil an den wissen
schaftlichen und künstlerischen Mitarbeitern Erstabsolventen/-innen 45,6 49,5 49,9 50,8 51,6
und Mitarbeiterinnen liegt bei einem knappen Promotionen 34,2 37,7 39,0 39,5 40,8
Drittel (32%). Insgesamt 15% der Professoren
sind weiblich, allerdings ist in der höchsten Be- Habilitationen 18,5 22,1 22,7 23,0 22,2
soldungsgruppe (C4/W3) nur etwa jede zehnte Hochschulpersonal insgesamt 50,8 51,3 51,2 51,2 51,3
Position (11%) mit einer Frau besetzt. In fast allen Wissenschaftliche und
Bundesländern sind die Frauenanteile bei den künstlerische Mitarbeiter/-innen 27,2 30,0 30,8 31,4 32,3
Professoren im Vergleich zum Vorjahr um ein oder
Professoren/-innen insgesamt 10,5 12,8 13,6 14,3 15,2
zwei Prozentpunkte gestiegen. Lediglich in Thü-
ringen und Schleswig-Holstein ging der Frauenan- C4/W3-Professoren/-innen 7,1 8,6 9,2 10,0 11,0
teil bei den Professoren um einen Prozentpunkt Juniorprofessoren/-innen - 31,2 30,9 29,0 31,5
zurück.
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 294 Überregionale Attraktivität deutscher Hochschulen
Wanderungssaldo der Studierenden nach Bundesländern Wintersemester 2006/2007 4.1 Wanderungssaldo
Der Wanderungssaldo bringt das Mengen-
verhältnis zwischen ab- und zuwandernden
Berlin Studierenden in den Ländern zum Ausdruck
Hamburg und ist ein Indikator für die überregionale
Attraktivität der Hochschulstandorte.
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz Der Wanderungssaldo fällt bei einem Im-
portüberschuss Studierender aus anderen
Bremen Zuwanderung
Ländern positiv aus. Übersteigt die Zahl der
Bayern
abgewanderten Studierenden die Zahl der
Sachsen Wanderungsgewinne, fällt der Wanderungs-
Hessen saldo negativ aus. Anhand der Wanderungs-
Mecklenburg-Vorpommern bilanz wird deutlich, in welchem Ausmaß die
Sachsen-Anhalt
Länder Bildungsleistungen für Studierende
erbringen, die ihre Hochschulreife in anderen
Saarland
Ländern erworben haben.
Schleswig-Holstein Abwanderung
Thüringen
Nordrhein-Westfalen ist das Flächenland mit
Baden-Württemberg
dem größten positiven Wanderungssaldo
Brandenburg
Im Wintersemester 2006/2007 weist Berlin
Niedersachsen
den höchsten Importüberschuss an Studie-
renden auf (+27 600), gefolgt von Hamburg
-30 000 -20 000 -10 000 0 10 000 20 000 30 000
(+18 300) und Nordrhein-Westfalen (+12 700).
Neben Nordrhein-Westfalen sind Rheinland-
Pfalz (+10 300), Bayern (+6 500), Sachsen
30 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008(+3 700) und Hessen (+900) die Wanderungs- im Wintersemester 2000/2001 und kehrte sich Bundesländern. Berlin verfügt im Länderver-
gewinner unter den Flächenländern. Sachsen schließlich 2005/2006 in einen Wanderungsver- gleich über den mit Abstand höchsten Import-
ist das einzige östliche Land mit einer positiven lust (-500). Dieser negative Ausweis verstärkte überschuss, dieser ist allerdings im Vergleich
Wanderungsbilanz. Die Länder Niedersachsen sich dann im aktuellen Beobachtungsjahr. zum Vorjahr um 11 % und im Vergleich zum Jahr
(-27 300) und Brandenburg (-16 600) sind die 2000 sogar um 34 % abgeschmolzen.
größten „Geberländer“; sie verlieren deutlich
Berlin mit höchstem Wanderungsgewinn
mehr Studierende an andere Länder, als bei
ihnen zuwandern. Importgewinne machen in den Stadtstaaten
knapp ein Viertel (23 %) aller Immatrikulierten
Das Verhältnis von Geber- und Nehmerländern im
aus. Sie erbringen demnach in hohem Maße
Hinblick auf die Wanderungsbilanz der Studie-
Bildungsleistungen für Studierende aus anderen
renden ist relativ stabil. Nur Rheinland-Pfalz und
Hessen konnte innerhalb der letzten zehn Jahre
ihre negative Wanderungsbilanz abbauen und in
die Gruppe der Länder mit Importüberschüssen
vorrücken.
Negative Bilanz Ostdeutschlands
vergrößert sich
Insgesamt geben die neuen Länder einschließ-
lich Berlin mehr Hochschulzugangsberechtigte
an die alten Länder ab, als umgekehrt. Der
Wanderungssaldo Ostdeutschlands liegt im
Wintersemester 2006/2007 bei -4 200. Während
im Wintersemester 1995/96 für diese Region
noch ein Wanderungsgewinn von 36 000 Stu
dierenden ausgewiesen wurde, reduzierte sich
dieser systematisch auf 24 000 Studierende
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 314 Überregionale Attraktivität deutscher Hochschulen
Anteil ausländischer Studierender (Bildungsausländer) im ersten Hochschulsemester 4.2 Anteil der Bildungs-
nach Bundesländern 2006 ausländer/-innen an den
Deutschland 15,5
Studienanfängern/-innen
Berlin 23,8
Saarland 23,5 Die Kennzahl misst den Anteil ausländischer
Studierender, die sich erstmalig an einer deut-
Brandenburg 20,9
schen Hochschule eingeschrieben haben und
Baden-Württemberg 19,0
ihre Hochschulreife außerhalb Deutschlands
Sachsen 18,3 erworben haben (sog. Bildungsausländer). Sie
Bremen 18,0 ist ein Indikator für die Attraktivität deutscher
Bayern 15,1 Hochschulen für ausländische Studierende,
der auch die Studierenden berücksichtigt, die
Sachsen-Anhalt 14,6
nur für kurze Zeit (z. B. im Rahmen von Aus-
Niedersachsen 14,6
tauschprogrammen) an deutschen Hochschu-
Thüringen 13,7 len eingeschrieben sind.
Rheinland-Pfalz 13,5
Ausländische Studierende, die sich erstmalig
Hessen 13,1 an einer deutschen Hochschule immatrikulie-
Nordrhein-Westfalen 12,8 ren, werden statistisch als Studienanfänger
Mecklenburg-Vorpommern 12,7 erfasst, auch wenn diese im Ausland bereits
Hamburg 12,3
eingeschrieben waren oder bereits einen
Studienabschluss erworben haben.
Schleswig-Holstein 10,4
0% 5% 10% 15% 20 % 25 % Der internationale Austausch unter angehen
den Akademikern und Nachwuchswissen-
schaftlern soll aus bildungs- und wirtschafts-
politischer Sicht gefördert werden. Die
32 Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008Einführung der international vergleichbaren begründet, dass viele Studierende, die nur für Stadtstaaten und neue Bundesländer
Studienabschlüsse Bachelor und Master soll kurze Zeit im Rahmen von Austauschprogram- zunehmend beliebter
den Wechsel zwischen unterschiedlichen Hoch- men nach Deutschland kommen, das Studien
Berlin übt nach wie vor die stärkste Anziehungs-
schulen inner- und außerhalb des europäischen fach Germanistik belegen, um ihre Sprachkennt-
kraft auf ausländische Studienanfänger und
Hochschulraums erleichtern. nisse zu verbessern. In den Fächergruppen
-anfängerinnen aus: Knapp ein Viertel (24%) der
Ingenieurwissenschaften und Agrar-, Forst- und
Erstimmatrikulierten in der Bundeshauptstadt
Ernährungswissenschaften (16 %) ist ebenfalls
Anteil der Studienanfänger/-innen kommt 2006 aus dem Ausland. Auf dem zweiten
ein überdurchschnittlicher Anteil ausländischer
aus dem Ausland stagniert Rang liegt das Saarland (23 %) mit seinen engen
Studienanfänger zu verzeichnen.
Im Studienjahr 2006 schrieben sich 53 600 Stu
dierende aus dem Ausland neu an deutschen
Hochschulen ein, das sind 2 200 weniger als
2005. Bei einem leichten Rückgang um 0,1 %
liegt der Anteil der Studienanfänger bzw. -anfän-
Ausländische Studienanfänger/-innen (Bildungsausländer) im ersten
gerinnen aus dem Ausland an allen Erstimmatri- Hochschulsemester nach Hochschularten
kulierten weiterhin bei rund 16 %. An Universi-
täten ist der Anteil mit 19% fast doppelt so hoch
Ausländische Anteil an allen Anteil in % an ...
wie an Fachhochschulen (10 %).
Studienanfänger/-innen Studienanfängern/
Studienjahr (Bildungsausländer/-innen) -innen in % Universitäten Fachhochschulen
Sprach- und Kulturwissenschaften sowie Kunst,
1995 28 223 10,8 13,7 4,3
Kunstwissenschaft weiterhin mit höchstem
Ausländeranteil 2002 58 480 16,3 19,7 10,1
Die Fächergruppen Sprach- und Kulturwissen- 2003 60 113 15,9 19,0 10,3
schaften weist neben der Fächergruppe Kunst, 2004 58 247 16,2 19,5 10,3
Kunstwissenschaft mit 20% den höchsten Anteil
2005 55 773 15,6 18,8 10,0
der Studienanfänger und -anfängerinnen aus
dem Ausland aus. Dies liegt unter anderem darin 2006 53 554 15,5 18,6 10,2
Statistisches Bundesamt, Hochschulen auf einen Blick, 2008 33Sie können auch lesen