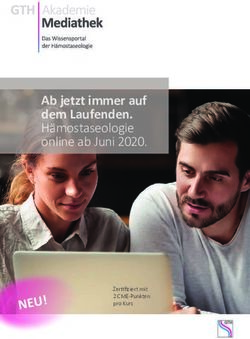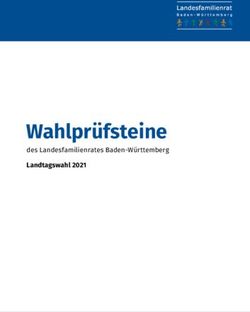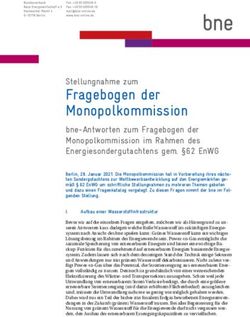Hörsturz: Was hilft? - MDR
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Seite 1 von 6
I n f o r m a t i o n s m a t e r i a l v o m 2 5 . 0 4 . 2 0 1 9
Hörsturz: Was hilft?
Plötzlich taub. Ohne Vorwarnung. Obwohl ein Hörsturz als Krankheitsbild seit lan-
gem bekannt ist, sind seine Ursachen nicht genau geklärt und auch die Therapie ist
bisher wenig erforscht. Hallenser Ärzte leiten eine bundesweite Studie, die helfen
soll, die Therapie eines Hörsturzes zu verbessern.
Es ist eine beängstigende Situation: Von einer Sekunde auf die andere hat man nur noch ein
Rauschen oder Klingeln im Ohr. Oder hört gar nichts mehr. So als ob ein großer Watte-
bausch fest im Gehörgang steckt. So beschreiben Betroffene einen Hörsturz. Er tritt meist
nur auf einem Ohr auf und betrifft alle Altersgruppen. Die genauen Ursachen sind nicht
geklärt. Eine Theorie besagt, dass es sich um eine Durchblutungsstörung im Innenohr han-
delt, weshalb man auch vom „Ohrinfarkt“ spricht. Auch Stress scheint bei der Entstehung
eine Rolle zu spielen.
Notfall oder nicht?
Früher galt ein Hörsturz als Notfall, mit dem man so schnell wie möglich in eine Klinik sollte.
Heute spricht man eher vom „Eilfall“. Man sollte vor allem Hektik und Stress vermeiden,
weil sie die Situation verschlimmern könnten und innerhalb der nächsten 24 bis 48 Stunden
einen Arzt aufsuchen. Glücklicherweise ist die Rate der „Spontanheilungen“ in den ersten
Wochen hoch. Dennoch gibt es Patienten, die teilweise ein Leben lang die Folgen eines Hör-
sturzes spüren.
Studie für bessere Behandlung
Solche Patienten sieht Professor Stefan Plontke, Direktor der HNO-Klinik des Uniklinikums
Halle häufiger. Er leitet eine bundesweite Studie, die die Therapie des Hörsturzes erforscht.
Denn vieles ist diesbezüglich noch unklar. „Ein Beweis für eine eindeutig wirksame Therapie
konnte bisher nicht gefunden werden“, fasst Plontke die Ergebnisse bisheriger Untersu-
chungen zusammen. Für die in Halle koordinierte HODOKORT-Studie stellt das Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung rund zwei Millionen Euro zur Verfügung, 40 Studien-
zentren sind deutschlandweit beteiligt. Getestet wird die Dosierung von Glukokortikoid,
einem Kortisonpräparat, und ob Tabletten und die intravenöse Gabe den gleichen Nutzen
haben. „Wir gehen davon aus, dass alle Therapieformen prinzipiell wirksam sind. Wir wollen
aber herausfinden, ob die Hochdosistherapie Vorteile birgt und wie es mit eventuellen Ne-
benwirkungen aussieht“, erklärt Professor Plontke. Dazu gehört auch zu untersuchen, wel-
1Seite 2 von 6
che Auswirkungen solche hochdosierten Glukokortikoid-Therapien auf den Blutdruck und
den Blutzucker haben. Solche Erkenntnisse sind wichtig, denn ein Hörsturz kann nicht in
allen Fällen zufriedenstellend behandelt werden.
Hightech im Ohr
In manchen Fällen bleibt eine dauerhafte Hörbeeinträchtigung zurück. Dann kann ein Hör-
gerät wieder zum besseren Hören verhelfen. Und die heutigen Hörsysteme sind viel besser
und leistungsfähiger als viele meinen. Denn auf dem Gebiet der Hörakustik hat es in den
letzten Jahren eine rasante technische Weiterentwicklung gegeben. „Moderne Hörsysteme
können sich heute über Bluethooth mit dem Handy verbinden. Auch der Fernsehton kann
direkt auf ein Hörgerät übertragen werden, ohne zusätzliches Zubehör und ohne, dass man
den Partner stört“, sagt Hörakustikermeister Karsten Fischer aus Magdeburg. Auch können
diese Hörsysteme selbstständig die akustische Umgebung wahrnehmen und sich automa-
tisch auf die jeweilige Hörsituation einstellen. „Sie nehmen sogar die Nutzungsdaten des
Trägers auf und können daraus lernen, was das Hören langfristig verbessert“, erklärt Kars-
ten Fischer. Kassenmodelle oder die „aufzahlungsfreie Versorgung“ wie es in der Fachspra-
che heißt, sind hier besser als ihr Ruf. Denn auch Kassenmodelle sind volldigital und tech-
nisch hochwertig ausgestattet. Im Vergleich zu „aufzahlungspflichtigen“ Hörgeräten müs-
sen die Patienten lediglich Abstriche in Design und Komfort in Kauf nehmen.
Wieder Hören mit Implantat
Ein Hörsturz kann aber auch zu einem dauerhaften, kompletten Hörverlust führen. Wenn
Hörgeräte nicht mehr helfen, der Hörnerv aber noch funktionsfähig ist, kann eine Hörpro-
these, ein sogenanntes Cochlea-Implantat, das Hören wieder ermöglichen. Im Unterschied
zu Hörgeräten, die Geräusche verstärken und filtern, übernimmt die Hörprothese die Funk-
tion beschädigter Teile des Innenohrs. Das Einsetzen des Implantats erfolgt unter Vollnarko-
se. Die Operation dauert rund zwei Stunden. Danach braucht der Patient Geduld, bis das
Implantat eingeheilt und das veränderte Hören erlernt ist. Ein langer Weg, der sich aber
lohnt.
Eisen – das mächtige Spurenelement
Eisen ist ein lebensnotwendiger Mineralstoff, den der Körper nicht selbst bilden
kann. Wir müssen ihn über Lebensmittel zu uns nehmen. Und obwohl wir nur
kleinste Mengen davon täglich brauchen, kann ein Zuviel oder Zuwenig davon in
unserem Körper einiges durcheinander bringen.
„Viele Patienten sagen, sie fühlen sich saft- und kraftlos. Sie sind nicht mehr leistungsfähig,
schnell außer Puste und bekommen schnell Luftnot“, so beschreibt Internist Dr. Holger
Reichmann die Symptome seiner Patienten mit einem ausgeprägten Eisenmangel. Der Arzt
leitet die Klinik für Innere Medizin an den Kliniken Erlabrunn. Häufig sieht er bei seinen Pati-
enten auch Hautveränderungen wie trockene, juckende Haut und brüchige Nägel. Ein aus-
geprägter Eisenmangel kann mit der Zeit auch zu einer Anämie, einer Blutarmut führen.
2Seite 3 von 6
Alarmsignal Eisenmangel
Eisen ist an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt, unter anderem ist es für den
Sauerstofftransport im Blut zuständig. Eisenmangel betrifft Frauen häufiger als Männer. Ein
Grund ist die monatliche Regelblutung, bei der auch Eisen verloren geht. Im höheren Le-
bensalter sind kleine innere Blutungen häufig Ursache für einen Eisenmangel. „Bei Älteren
ist es oft so, dass ein niedriger Eisenwert ein Alarmsymptom sein kann, für eine chronische
Entzündung oder eine Tumorerkrankung “, warnt Dr. Reichmann. Deswegen gehört zur
Suche nach der Ursache des Eisenmangels eine ausführliche Diagnostik: „Das geht los im
Mundbereich, dass wir gucken, ob die Patienten Zahnfleischblutungen haben, ob Blutungen
im Nasenbereich vorliegen. Finden wir nichts, folgen Magen- und Darmspiegelung. Wenn
das auch nicht zielführend ist, folgen noch Computertomografie, MRT oder auch Röntgen
des Magen-Darm-Traktes.“
Eisenwerte wieder ins Lot
Ist die Ursache gefunden, muss diese natürlich behandelt werden. Um den Eisenspiegel
wieder anzuheben, helfen in ausgeprägten Fällen Eisentabletten oder Infusionen. Bei leich-
tem Eisenmangel kann man über die Ernährung gegensteuern. Fleisch und Innereien sind
die besten Eisenlieferanten. Weizenkleie, Kürbiskerne und Hülsenfrüchte wie Sojabohnen
oder Linsen enthalten ebenfalls viel Eisen. „Das Problem bei pflanzlichen Lebensmitteln ist,
dass das Eisen nicht so gut vom Körper aufgenommen werden kann wie Eisen aus tierischen
Lebensmitteln. Vitamin C fördert aber die Aufnahme von pflanzlichem Eisen“, empfiehlt
Ernährungsberaterin Jenny Raddei aus Zwenkau. Schwarzer Tee, Kaffee und Rotwein hem-
men die Eisenaufnahme dagegen.
Vorsicht Eisenspeicherkrankheit
Einfach so auf Verdacht frei verkäufliche Eisenpräparate zu sich zu nehmen, ist keine gute
Idee. Denn der Körper kann auch zu viel Eisen anreichern. Bei der sogenannten Hämochro-
matose nimmt der Körper aufgrund eines Gendefekts zu viel Eisen auf und speichert es in
den Gelenken oder in den Organen ab. Die Erkrankung tritt nicht so häufig auf und wird
deswegen manchmal lange nicht erkannt. Das Problem dabei: Die Anreicherung des Eisens
im Körper kann auf Dauer zu schweren gesundheitlichen Problemen führen. Das sind zum
Beispiel frühzeitiger Gelenkverschleiß, Herzrhythmusstörungen, Leberschäden oder der so-
genannte „Bronzediabetes“ – Diabetes infolge der Eisenspeicherkrankheit. Eisenpräparate
sollte man also nur dann zusätzlich einnehmen, wenn es wirklich nötig ist und der Eisenwert
im Blut regelmäßig kontrolliert wird.
Fall 1: Ständig schlapp durch zu wenig Eisen
Ständig müde und abgeschlagen, so fühlt sich Nadja Pelickan-Seltmann lange.
Die Mutter von zwei Kindern ist regelmäßig beim Hausarzt, weil sie eine Schilddrüsenunterfunk-
tion hat. Zur Kontrolle gehört ein Blutbild, in dem ihr Eisenwert immer niedrig ist. Das spricht die
Schwarzenbergerin zusammen mit der dauernden Müdigkeit an, findet aber kein Gehör: „Die
Symptome sind ja so, dass sie auf viele Krankheitsbilder passen. Beziehungsweise in der Akte
steht auch, dass ich Vegetarierin bin. Da wurde dann gesagt: Essen Sie ein Stück Fleisch, dann
werden sich die Werte wieder normalisieren.“
3Seite 4 von 6
Doch von allein wird es nicht besser. Aus dem Eisenmangel entwickelt sich eine Anämie, eine
Blutarmut. Im Klinikum Erlabrunn wird schließlich die Ursache gefunden: eine ausgeprägte Ma-
genschleimhautentzündung und eine Helicobacter-Infektion. Die 39-Jährige bleibt vier Tage in
der Klinik. Ihre Magenschleimhautentzündung wird behandelt und sie bekommt Infusionen mit
einem Eisenpräparat. Ganz zufrieden ist sie heute noch nicht: „Ich habe mir erhofft, dass es mir
schneller besser geht.“ Ihr behandelnder Internist Dr. Holger Reichmann bittet sie um Geduld:
„Die Blutzellen bilden sich nicht schlagartig, sondern haben in der Regel eine Lebensdauer von
120 Tagen.“ Das heißt, sie werden erst allmählich gebildet und so dauert es einige Wochen, bis
die Symptome ganz verschwinden.
Fall 2: Kaputte Gelenke durch zu viel Eisen
Falk Kabus aus dem sächsischen Grimma hat drei künstliche Gelenke, beide Hüftgelenke und ein
Knie sind operiert. Der Gelenkverschleiß und die damit einhergehenden Schmerzen fingen un-
gewöhnlich früh an, zur Hüft-OP musste der heute 67-Jährige schon mit Anfang 50. Als nach
der Operation die Beschwerden bleiben und der Hausarzt wegen hoher Entzündungswerte ein
ausführliches Blutbild veranlasst, kommt der entscheidende Hinweis: der Eisenwert von Falk Ka-
bus ist um das 20-Fache erhöht. Die Diagnose: Eisenspeicherkrankheit. Aufgrund eines Gende-
fekts nimmt er viel mehr Eisen auf, als er braucht. Bei Falk Kabus speichert sich das Eisen vor
allem in seinen Gelenken ab.
Die Praxis für Hämatologie des Internisten Dr. Ali Aldaoud ist eine der wenigen im Raum Leipzig,
in der Patienten wie Falk Kabus behandelt werden. Die Therapie ist einfach: der Aderlass. Denn
das Eisen muss raus aus dem Körper. Bis zu einem halben Liter Blut werden Woche für Woche
abgenommen. Weil der Körper das entnommene Blut neu bilden muss, baut er nach und nach
das eingelagerte Eisen ab. Bei Falk Kabus dauerte es vier Jahre bis zur Normalisierung der Werte.
Über diese Zeit ist er zum Experten für seine eigene Krankheit geworden. Über die Hämochro-
matose-Vereinigung berät er heute Mitpatienten.
Linsen-Tomaten-Aufstrich
Rezept von Ernährungsberaterin und Diätassistentin Jenny Raddei aus Merseburg
Zutaten für 4 Portionen:
200 g braune Linsen
½ Glas getrocknete Tomaten in Öl
getrocknete Kräuter nach Geschmack (z.B. Rosmarin, Koriander)
Salz
Kürbiskerne zur Dekoration
Zubereitung:
Die Linsen zum Kochen bringen und garkochen (Kochdauer siehe Verpackung). Die gekochten
Linsen anschließend abschütten. Die getrockneten Tomaten gut abtropfen lassen und zusam-
men mit den Linsen in ein hohes Gefäß geben und pürieren. Anschließend das Ganze mit Salz
und getrockneten Kräutern nach Gusto verfeinern.
Pro Portion ca. 4 mg Eisen
4Seite 5 von 6
Fehlende Hausärzte – Wer betreut die Patienten?
Rund 2.600 Hausarztpraxen stehen in ganz Deutschland zurzeit leer. Besonders in den
ländlichen Regionen entwickelte sich in den letzten Jahren ein Mangel an hausärztli-
cher Versorgung. Laut einer Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung sollen im
Jahr 2030 über 10.000 Hausärzte fehlen. Doch wer versorgt dann die Patienten?
Hausärztliche Versorgung in Mitteldeutschland
In Sachsen praktizieren rund 2.600 Hausärzte. Über ein Viertel von ihnen ist über 60 Jahre
alt, elf Prozent sogar über 65. Im Schnitt hat jeder Hausarzt in Sachsen knapp 1.000 Patien-
ten. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen zählt 245 offene Hausarztstellen im Freistaat
(Stand Januar 2019).
In Sachsen-Anhalt sind „nur“ 140 Hausarztsitze nicht besetzt. Mit dem „Masterplan Medi-
zinstudium 2020“ hat die Bundesregierung die Weichen für die Einführung einer Landarzt-
quote an Universitäten gestellt. Sie soll seit Januar 2019 dafür sorgen, dass eine medizini-
sche Grundversorgung durch Hausärzte in allen Regionen Sachsen-Anhalts nachhaltig gesi-
chert ist. Neben finanziellen Anreizen werden mit der Landarztquote auch die Hürden für
die Zulassung zu einem Medizinstudium gesenkt. Bei maximal zehn Prozent der Studienplät-
ze soll nicht mehr allein die Abiturnote über die Zulassung entscheiden. Bewerber, die ge-
eignet sind und sich bewusst für eine Karriere als Landarzt entscheiden, werden besonders
unterstützt.
In Thüringen gab es laut Landesärztekammer im Jahr 2018 1.034 tätige Hausärzte. Auch
hier sind etliche Hausarztstellen unbesetzt. Anfang 2018 waren es 52.
Ein Grund für den Mangel an Allgemeinmedizinern ist das Alter der Ärzte: Über die Hälfte
der Thüringer Hausärzte ist älter als 55 Jahre, jeder Siebte ist eigentlich im Rentenalter. Doch
sie finden – wie in anderen Bundesländern auch – keinen Nachfolger.
Der Fall: Landarzt gesucht!
In dem kleinen Örtchen Kitzen südlich von Leipzig heißt es schon seit 80 Jahren in der Haus-
arztpraxis: „Der Nächste, bitte!“ Albrecht Kunzmann ist der derzeitige Landarzt hier. Er be-
treut heute fast 1.000 Patienten in einem Gebiet, das sich über 25 Ortschaften erstreckt. Er
liebt den Kontakt zu seinen Patienten, man kennt sich, manchmal schon ein Leben lang.
Auch seine Mutter Annie und sein Vater Otto Kunzmann sind seit 1939 Hausärzte auf dem
Land. Fast 50 Jahre lang versorgen sie gemeinsam ganze Patientengenerationen. Als Vater
Otto Anfang der 80er-Jahre aus gesundheitlichen Gründen in Rente geht, übernimmt Sohn
Albrecht Kunzmann die Praxis und die Patienten. Auch heute noch kennt Albrecht Kunz-
mann die meisten seiner Patienten sofort mit Namen. Viele duzt er sogar. Doch der Doktor
ist mittlerweile 68 Jahre alt und möchte nun selbst in Rente gehen. Doch anders als vor 40
Jahren bei ihm und seinem Vater wollen seine beiden Töchter die Praxis nicht übernehmen.
Es beginnt die Suche nach einem Nachfolger, lange ohne Erfolg. „Manche sagen, mit 42
Jahren sind sie noch nicht reif, um alleine zu praktizieren. Ich hatte eine Kollegin, die hatte
sich beworben, kam zur Tür rein und sagte, das ist mir zu ländlich und ist gleich wieder ge-
gangen“, erinnert sich Albrecht Kunzmann. Lange Zeit tut sich nichts, alles deutet schon auf
ein Ende der Landarztpraxis hin. Doch Kitzen ohne einen Kunzmann, das mag sich hier kei-
ner vorstellen. Dann endlich ein Hoffnungsschimmer: Dr. Jan Walther, frisch gebackener
5Seite 6 von 6
Absolvent der Uni Leipzig. Er soll die Rettung für die Praxis sein. Schon seit einigen Monaten
arbeitet Dr. Walther als Landarzt mit. Er übernimmt die Aufgaben, die für Albrecht Kunz-
mann zu anstrengend geworden sind. Der möchte sich langsam aus dem Praxisbetrieb zu-
rückziehen, doch das ist nicht so einfach. Vorher muss er noch eine weitere Hürde meistern:
Zum Landkreis Leipziger Land gehört auch die Kreisstadt Markkleeberg. Dort gibt es ein
Überangebot an Arztpraxen. Von offizieller Seite besteht eigentlich kein Bedarf an Land-
arztpraxen wie der in Kitzen. Doch auch das wird sich noch finden, ist sich Albrecht Kunz-
mann sicher. Und seine Patienten danken es ihm.
VERAH, Agnes & Co – die neuen Gemeindeschwestern
Egal, ob in Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Sachsen – fernab der Städte steht die allge-
meinmedizinische Versorgung der Patienten vor besonderen Herausforderungen: Nur weni-
ge Ärzte gehen gern aufs Land. Sie fürchten endlose Arbeitstage, zahlreiche Hausbesuche,
lange Wege. Neue Versorgungskonzepte sind gefragt und man erinnert sich zurück an Alt-
bewährtes: Zu DDR-Zeiten leisteten Gemeindeschwestern, was Ärzte zeitlich nicht bewälti-
gen konnten. Sie fuhren zu Hausbesuchen, maßen Blutdruck, kontrollierten die Einnahme
von Medikamenten und hatten Zeit für ein kurzes Gespräch. Die modernen Gemeinde-
schwestern von heute heißen „Agnes“ oder VERAH - kurz für „Versorgungsassistentin in
der Hausarztpraxis“. Sie haben eine zusätzliche Qualifizierung für Medizinische Fachange-
stellte. Und auch sie fahren zu Hausbesuchen, unterstützen und entlasten den Hausarzt. Die
Hausarztpraxis dient dabei als zentraler Ort, hier werden alle Patientenakten und Informati-
onen gebündelt, die einzelnen Fälle im Team besprochen. Ein weiterer Vorteil: Die VERAHs
haben vor ihrer Weiterbildung häufig schon längere Zeit in der Praxis als Praxisschwester
gearbeitet und die Patienten kennen sie.
„Hauptsache Gesund“-Journal zu bestellen unter der Abo-Hotline: 0341 – 3500 3500
Gäste im Studio:
Jenny Raddei, Diätassistentin, Merseburg
Prof. Stefan Plontke, Direktor der HNO-Klinik des Uniklinikums Halle
Dr. Klaus Lorenzen, Facharzt für Allgemeinmedizin, Dresden
Stellvertretender Vorsitzender des Sächsischen Hausärzteverbandes
Anschrift: MDR, Redaktion Wirtschaft und Ratgeber, „Hauptsache Gesund“, 04360 Leipzig
Unsere nächste Sendung 02.05. 2019: Zecken, Nordic Walking, Migräne
6Sie können auch lesen