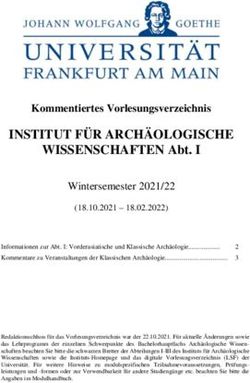Kooperation als neues Leitbild - Medienkongress der vbw zur "Weiterentwicklung der dualen Medienordnung" am 20. November 2019 in München - beck ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Service
Kooperation als neues Leitbild
8. Medienkongress der vbw zur „Weiterentwicklung der dualen Medienordnung“
am 20. November 2019 in München
Der 8. Medienkongress der Vereinigung der Bayerischen Prof. Dr. Tobias Gostomzyk
Wirtschaft vbw am 20. November 2019 stand ganz im Technische Universität Dortmund, Institut für Journalistik
Zeichen der Präsentation und Diskussion eines von der tobias.gostomzyk@tu-dortmund.de
vbw beauftragten interdisziplinären Gutachtens zum Prof. em. Dr. Otfried Jarren
Thema „Kooperationsorientierte Weiterentwicklung der Universität Zürich, Institut für Kommunikationswissenschaft
und Medienforschung, Prof. mit besonderen Aufgaben
Medienordnung“ durch die Autoren Tobias Gostomzyk
o.jarren@ikmz.uzh.ch
(Medienrecht, TU Dortmund), Otfried Jarren (Medienpo-
litik, Universität Zürich/FU Berlin), Frank Lobigs (Medien- Prof. Dr. Frank Lobigs
Technische Universität Dortmund, Institut für Journalistik
ökonomie, TU Dortmund) und Christoph Neuberger (FU
frank.lobigs@tu-dortmund.de
Berlin/Weizenbaum Institut). Der folgende Text dokumen-
tiert die Gutachtenpräsentation in einer Kurzzusammen- Prof. Dr. Christoph Neuberger
Freie Universität Berlin, Direktor am Weizenbaum-Institut
fassung.
für die vernetzte Gesellschaft
christoph.neuberger@fu-berlin.de
Warum die Medienordnung kooperationsorientiert weiterentwickelt werden muss
Unternehmer, Verbandsvertreter und Politiker setzen sich Weiteres ins Digitale übertragen. Dagegen dominieren
immer häufiger und teils mit hohem Nachdruck dafür ein, Plattformkonzerne wie Google und Facebook den digita-
dass Medien stärker zusammenarbeiten und Allianzen len Werbemarkt. Sie haben insbesondere die Vermarktung
bilden. Dazu gehören etwa der ARD-Vorsitzende Ulrich personalisierter Werbung etabliert, und aufgrund von Tech-
Wilhelm, BDZV-Präsident Dr. Matthias Döpfner, Bertels- nologiemacht und ihrer Dominanz bei der Akkumulation
mann-CEO Dr. Thomas Rabe oder der bayerische Minis- von Nutzerdaten beherrschen sie das Geschäft nahezu
terpräsident Markus Söder. Allen geht es darum, dass auch duopolistisch. Gleichzeitig sind nur wenige Nutzer bereit,
in der digitalen Welt gesellschaftlich qualitätsorientierte für nationale und regionale journalistische Qualitätsan-
Medieninhalte nachhaltig produziert und verbreitet werden. gebote im Netz herkömmliche Abopreise zu zahlen. Die
Das wird allerdings nur gelingen, wenn die Medienordnung Einnahmen der Verlage sind deshalb online bekannter-
kooperationsorientiert weiterentwickelt wird. Dabei stellen maßen verschwindend gering. Und auch das zunehmend
sich vorab grundlegende medienpolitische, medienökono- umkämpfte Video-on-Demand-Geschäft konzentriert sich
mische sowie medien- und wettbewerbsrechtliche Fragen. auf große internationale Streaminganbieter wie Netflix
Kooperation als Leitbild der Medienordnung zu verwirkli- oder Amazon Prime Video. Deshalb ist es kein Geheimnis:
chen, setzt ihre Beantwortung voraus. Setzt sich diese Gesamtentwicklung ungemindert fort, ist
der publizistische Qualitätswettbewerb über kurz oder lang
Gefährdung des publizistischen gefährdet. Stattdessen träte eine intransparenter Content-
Qualitätswettbewerbs Wettbewerb nach den Regeln der Plattform-Ökonomie an
seine Stelle, wie es etwa auch im Bericht „Rückhalt für den
Die Märkte für gedruckte Presseprodukte sowie program- Journalismus“ der Eidgenössischen Medienkommission
morientierte Rundfunkmedien sind in den vergangenen (EMEK) festgestellt wird. Ob die Inhalte öffentlich relevant
Jahrzehnten deutlich geschrumpft, während der Online- sind oder nicht, spielt dann kaum noch eine Rolle. Denn es
wie Plattformmarkt entsprechend gewachsen ist. Die geht es Plattformen vor allem darum, die Aufmerksamkeit
klassischen Medienunternehmen stellt dies inzwischen von Nutzern auf sich ziehen und zu binden – weitgehend
unbestreitbar vor wirtschaftliche Herausforderungen. Denn unabhängig von der öffentlichen Relevanz der Informati-
ihr angestammtes Kerngeschäft lässt sich nicht ohne onen. Gefährdet wäre also nicht nur das herkömmliche
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35. 1/2020 MedienWirtschaft 41
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Service – Veranstaltungsrückblick
Geschäftsmodell der Medien, sondern für die Gesellschaft Überdies sind aber auch neue Konstellationen der Koopera-
zugleich auch die Möglichkeit, sich vielfältig und breit zu tion zwischen Medienunternehmen denkbar; insbesondere
informieren. Von weiteren Risiken, wie sie aus Falschin- auch zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Medien. Zu
formationen oder dem Verschwimmen der Grenzen von unterscheiden sind hier infrastrukturelle Projekte, die einen
Werbung und Inhalten resultieren, ganz abgesehen. Ver- wirksamen publizistischen Wettbewerb überhaupt erst erhal-
lässliche Information gerade über öffentliche Belange ist ten, und kleinere, komplementäre Kooperationsmodelle, die
aber die Grundlage für eine freie individuelle und öffentli- auf einen bestehenden publizistischen Wettbewerb aufbauen
che Meinungsbildung und damit letztlich Voraussetzung für und diesen stärken. Und gerade die infrastrukturbezogenen
das Funktionieren der Demokratie. Projekte wie etwa übergreifende Medienplattformen werden
kaum spontan entstehen; sei es etwa, weil Partikularinteres-
Trend zur Kooperation sen überwiegen oder weil es der aktuelle Rechtsrahmen nicht
zulässt. Um also die Medienordnung kooperationsorientiert
Eine Stärkung von qualitativ hochwertigen Medienange- weiterzuentwickeln, ist somit vor allem auch die (Medien-)
boten kann unter Netzwerkbedingungen darin bestehen, Politik ermöglichend gefordert. So wäre durch den Austausch
Kooperationen von traditionellen Medien zu begünstigen, mit Medienunternehmen zu ermitteln, welche Kooperations-
wenn und solange diese den publizistischen Wettbewerb konstellationen als vielversprechend angesehen werden, um
der Mediananbieter stärken. Für derartige Kooperationen die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und da-
gibt es auch bereits etliche Beispiele, wenngleich bisweilen mit auf den publizistischen Wettbewerb einzuzahlen.
um den Preis von weniger Vielfalt, wie bei der Einführung
von Zentralredaktionen für den Mantelteil von Lokalzeitun- Koordinaten der Kooperation
gen. Denn regelmäßig verfolgen Medienunternehmen zwei
Strategien, um unter digitalen Vorzeichen zu bestehen: Im Sinne eines neuen Leitbildes sind solche Coopetition-
Entweder investieren sie in gänzlich neue digitale Geschäf- Modelle besonders naheliegend: Die Beteiligten kooperieren
te. Oder sie versuchen ihr angestammtes Geschäft nach in begrenztem Umfang wirtschaftlich (cooperation), während
bekannten Methoden zu stärken, indem sie es kosten- und sie weiter im publizistischen Wettbewerb zueinanderstehen
wertschöpfungseffizienter gestalten. Dabei entstehen vor (competition). Es sind auch neue Konstellationen denkbar;
allem neue Strukturen der Zusammenarbeit: innerhalb des insbesondere könnten öffentlich-rechtliche und private Medi-
eigenen Unternehmens, aber zunehmend auch in Koope- en künftig stärker kooperieren. Will man Kooperationsmodelle
rationen und Allianzen mit anderen, sogar konkurrierenden systematisieren, lassen sich diese drei Kategorien zuordnen:
Unternehmen. Viele Beispiele hierfür finden sich im Bereich „privat – privat“, „öffentlich-rechtlich – öffentlich-rechtlich“
der digitalen Werbevermarktung. und „privat – öffentlich-rechtlich“. Dabei zielen Allianzen und
Qualitativ hochwertige Medienangebote
unter Netzwerkbedingungen ermöglichen!
- Prof. em. Dr. Otfried Jarren, Präsident
der Schweizerischen Eidgenössischen
Medienkommission EMEK.
© Stefan Obermeier, Muenchen
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
42 MedienWirtschaft 1/2020 Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Service
Positive Systemwirkungen der öffent-
lich-rechtlichen Medien kooperativ
neu konzipieren! – Prof. Dr. Christoph
Neuberger, Direktor am Weizenbaum-
Institut für die vernetzte Gesellschaft.
© Stefan Obermeier, Muenchen
Kooperationen privater Medienunternehmen wesentlich dar- chung des Bundesverfassungsgerichts ergeben sich unter-
auf ab, Kostensynergien zu schaffen, indem sie Leistungen schiedliche wirtschaftliche Voraussetzungen für Rundfunk
gemeinsam produzieren und vermarkten. Damit senken die und Presse: Sie führten bei der Presse zu einem marktwirt-
Unternehmen ihre Fixkosten. Dies stärkt aber bestenfalls auch schaftlich geprägten außenpluralen Vielfaltsmodell, beim
den publizistischen Wettbewerb, da der ökonomische Wert Rundfunk zunächst zu einem binnenplural angelegten
jedes publizistischen Erfolgs steigt – und mit ihm die Anreize, öffentlich-rechtlichen Rundfunk und später – insbesonde-
publizistisch tätig zu bleiben. Selbst Synergie-Kooperationen re nach technischen Fortentwicklungen – zu einer dualen
im redaktionellen Bereich können den publizistischen Wett- Rundfunkordnung. Hier kommt dem öffentlich-rechtlichen
bewerb fördern, wenn die erzielten Synergien vor allem dazu Rundfunk bekanntlich ein Funktionsauftrag zu, das heißt
dienen, publizistische Angebote zu erhalten oder zu stärken. Programme für die gesamte Bevölkerung zu bieten, die
umfassend und in voller Breite informieren und Vielfalt si-
Vergleichbares gilt auch für Kooperationen zwischen öffent- chern. Vorrangig diese Vielfaltsorientierung rechtfertigt die
lich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Sie können ebenfalls zu Gebühren- bzw. Beitragsfinanzierung des öffentlich-recht-
Kostensynergien führen, wenn freiwerdende Ressourcen der lichen Rundfunks. Dagegen wurde beim privaten Rundfunk
Produktion von redaktionellen Inhalten zugutekommen. Medi- eine Absenkung der Erwartung an die Vielfaltssicherung in
enpolitisch gesehen wurden allerdings die Anreize für solche Kauf genommen, um hier – zu Lasten des publizistischen
Kooperationen in den vergangenen Jahren eher verringert Wettbewerbs – eine stärkere Wirtschaftsorientierung zu
als gefördert. Sie wurden mit dem Entzug von Ressourcen ermöglichen; also die Fokussierung auf unterhaltende
bedroht, nicht etwa belohnt. Deshalb wäre es beispielsweise Angebote. Es entstand mithin eine Trennung zwischen
auch besser, flexibel und investiv einsetzbare sowie verläss- öffentlich-rechtlichen und privaten (Rundfunk-)Medien.
lich planbare Festbudgets einzuführen, wie dies eine Mehr- Diese historische Entwicklung ist ein wesentlicher Grund,
zahl der Bundesländer in der lange geführten Debatte über warum Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichen und
eine Auftrags- und Strukturreform des öffentlich-rechtlichen privaten Medien bislang eher selten sind. In einer koopera-
Rundfunks gefordert hat – freilich bislang vergeblich. tionsorientierten Medienordnung sollte dagegen die beste-
hende Dualität in eine eher kooperative Partnerschaft mit
Systemübergreifende systemischem Charakter umgewandelt werden, die durch
Kooperation stärken Coopetition geprägt ist. Das gilt nicht zuletzt, weil hier ein
großes Potential für kostensynergetische Kooperationen
Die hiesige Medienordnung ist, historisch bedingt, dual besteht. Sie sollten alsdann nicht zu finanziellen Kürzungen
angelegt („publizistische Gewaltenteilung“, „duale Rund- führen, sondern Ressourcen für journalistische Produkti-
funkordnung“). Aus den Entwicklungslinien der Rechtspre- onen freisetzen. Eine Möglichkeit wäre es beispielsweise,
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35. 1/2020 MedienWirtschaft 43
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Service – Veranstaltungsrückblick
gemeinsam fiktive Filmen und Serien zu produzieren, die wie Amazons und Germany’s Gold vom Kartellamt durch
mit internationalen Großproduktionen mithalten können. hohen Auflagen unattraktiv, was die dynamischen Heraus-
Das ist etwa zum beiderseitigen Vorteil bei der Fernsehse- forderungen für Medien unter Netzwerkbedingungen nicht
rie „Babylon Berlin“ geschehen. Sie lief sowohl und zuerst hinreichend berücksichtigte. Staat dessen sollten auch hier
im privaten Bezahlfernsehen als auch im Anschluss im Kooperationen von Medien im höheren Maße ermöglicht
öffentlich-rechtlichen Fernsehen, jeweils erfolgreich. Auch werden, sofern sie nicht den publizistischen Wettbewerb
sind beispielsweise Kooperationen bei der Erprobung neu- gefährden. Ein Muster hierfür bietet schließlich das Pres-
er Technologien wie der Verbreitung von Medieninhalten sekartellrecht: Danach fällt die wirtschaftliche Zusammen-
über 5G oder des Einsatzes von redaktionellen Ressourcen arbeit von Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern nicht unter
wie Auslandsstudios denkbar. das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen,
soweit sie den Beteiligten wirtschaftlich zugute kommen,
Rechtliche Voraussetzungen schaffen was das Vertreiben ihrer Produkte betrifft oder das Wer-
begeschäft. Eine wettbewerbsbeschränkende Zusammen-
Was weiterhin die Kooperation von Medien oftmals verhin- arbeit im redaktionellen Bereich ist dabei ausgeschlossen.
dert – gerade zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten
Medien –, ist allerdings der derzeitige Rechtsrahmen. Er Bestehende Chancen erkennen
erschwert bereits einfachere Kooperationsformen zwischen
öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Medienun- Jenseits der Ermöglichung wettbewerbsbeschränkender
ternehmen wie Rechercheverbünde. Hierfür existieren bis- Vereinbarungen zwischen Presseunternehmen lassen sich
lang nur vereinzelt Rechtsgrundlagen wie im WDR-Gesetz. in der Rechtsordnung derzeit nur vereinzelt Ansätze für
Demnach muss der WDR bei der Auswahl von Kooperati- Kooperationen von Medien finden. Zu denken ist etwa an
onspartnern die Grundsätze der Meinungsfreiheit einhalten Branchenvereinbarungen für Presse-Grossisten, die eben-
und diskriminierungsfrei vorgehen. Hinzu kommen sowohl falls einen kartellrechtlichen Ausnahmetatbestand bilden.
vergabe- als auch EU-beihilferechtliche Hürden. Künftig Voraussetzung ist auch hier, dass Presse-Grossisten Zei-
muss deshalb das Ziel sein, stärker ein publizistisch kon- tungs- und Zeitschriftensortimente flächendeckend und
zipiertes Medien- und Wettbewerbsrecht zu entwickeln, diskriminierungsfrei vertreiben. Ebenso lässt sich der Deut-
das sowohl Kooperations- als auch Konkurrenzverhältnisse sche Presserat als freiwillige Selbstkontrolle der Print- und
von Medien betrachtet. Das betrifft insbesondere auch das Onlinemedien in Deutschland als Form der Kooperation an-
Kartellrecht, das vorrangig ökonomische und nicht publizis- sehen – und die kann zudem auf weitere Mediengattungen
tische Auswirkungen von Kooperationen im Blick hat. Aus sogar noch ausgeweitet werden.
diesem Grund wurden beispielsweise Mediathek-Projekte
Rechtliche Voraussetzungen für ein publizis-
tisches Wettbewerbsrecht schaffen! –
Medienrechtler Prof. Dr. Tobias Gostomzyk.
© Stefan Obermeier, Muenchen
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
44 MedienWirtschaft 1/2020 Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Service
Den publizistischen Qualitätswettbe-
werb durch geeignete Coopetition-
Modelle unterstützen! –
Medienökonom Prof. Dr. Frank Lobigs.
© Stefan Obermeier, Muenchen
Und auch die einzelnen Sendeanstalten des öffentlich- Kooperationen zwischen öffentlich-rechtlichen und priva-
rechtlichen Rundfunks können grundsätzlich wesentlich ten Medien. Doch lässt sich das Leitbild der Kooperation
stärker kooperieren, sei es auf der Ebene von Arbeitsge- systematisch auf weitere Bereiche ausweiten, die wie
meinschaften, Transferleistungen oder der Markenbildung, Nachrichtenagenturen oder Journalistenschulen infra-
wie sich aus einer Bestimmung des Rundfunkstaatsver- strukturell wichtig sind. Das hat zum einen sicher Gründe
trags ergibt. Dies gilt insbesondere für die Produktion, in der Entwicklung der Medienordnung, geprägt durch Ent-
Produktionsstandards, Programmrechteerwerb, Pro- wicklungslinien des Rundfunkverfassungsrechts. Es trennt
grammaustausch, Verbreitung und Weiterverbreitung von bis heute stark zwischen Presse und Rundfunk sowie öf-
Angeboten, Beschaffungswesen, Sendernetzbetrieb, in- fentlich-rechtlichen und privaten Medien. Das gilt teilwei-
formationstechnische und sonstige Infrastrukturen, Verein- se auch, weil die Wettbewerber hierauf bestehen, wie das
heitlichung von Geschäftsprozessen, Beitragsservice und teilweise Verbot der Presseähnlichkeit oder das internetbe-
allgemeine Verwaltung. Kommerzielle Tätigkeiten dagegen zogene Werbeverbot gegenüber dem öffentlich-rechtlichen
gehören nicht dazu, etwa Werbung und Sponsoring, Ver- Rundfunks vor Augen führt. Das Verfassungsrecht – und
wertungsaktivitäten, Merchandising, Produktion für Dritte letztlich auch das Europarecht – stünde einer stärker ko-
sowie die Vermietung von Sendestandorten an Dritte. Der operationsorientierten Ausgestaltung der Medienordnung
Rundfunkstaatsvertrag sieht zudem vor, dass sich der zumindest letztlich nicht entgegen; zumal dem Gesetzge-
öffentlich-rechtliche Rundfunk an privaten Unternehmen ber ein weiter Ausgestaltungsspielraum zukommt. Ange-
beteiligt. Auch einzelne Landesrundfunkgesetze gestatten, zeigt wäre vor allem ein publizistisches Wettbewerbsrecht,
dass die Sendeanstalten des öffentlich-rechtlichen Rund- das den publizistischen Wettbewerb erhält und stärkt. Das
funks kooperieren – sofern sie hierbei das Grundgesetz herkömmliche – vor allem ökonomisch zentrierte – Wett-
achten. Die Landesgesetzgeber ermöglichen Kooperatio- bewerbsrecht ist darauf nur begrenzt einstellbar. Die Na-
nen teilweise – wie genannt – auch im lokalen Bereich. gelprobe hierfür wäre sicher, einen Rechtsrahmen für eine
medienübergreifende Plattform auszugestalten, der einer-
Ein publizistisches seits zu Wettbewerb, aber anderseits auch zu Kooperation
Wettbewerbsrecht gestalten zwischen verschiedenen Medien führen würde.
Die Rechtsordnung enthält zwar bereits vereinzelt Bestim- Diese Schritte sind zu gehen
mungen zu Kooperationen. Sie betreffen vor allem jene
zwischen öffentlich-rechtlichen Medien untereinander Um die Medienordnung tatsächlich kooperationsorientiert
sowie «privat – privat»-Kooperationen. Wenig ausgestaltet neu aufstellen zu können, darf und müsste allerdings zu-
und rechtlich am meisten herausfordernd sind dagegen nächst die Medienpolitik selbst stärker zusammenarbeiten.
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35. 1/2020 MedienWirtschaft 45
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Service – Veranstaltungsrückblick
Ihre bundesweite und branchenübergreifende Fähigkeit planbaren Budget-Entwicklung könnten beim öffentlich-
zu gestalten, sind stärker zu fördern. Mit Mitteln der fö- rechtlichen Rundfunk dabei weitere Kooperationspotenzi-
deralen Medienpolitik könnte etwa auf Bundesebene ein ale heben. Er erhielte eine stabilisierende Rolle im Ökosys-
Beratungsgremium unabhängiger Experten wie beim Digi- tem der Medien insgesamt, durch sinnvolle Bereitstellung
tal- oder Ethikrat etabliert werden. Länder und Bund sollten von Ressourcen zum Vorteil für andere Medien, ohne sie
gemeinsam zusammenwirken, um die neue Medien- und also zu verdrängen. Im Gegenzug könnte sich der öffent-
Kommunikationsordnung zu entwickeln. Erste Ansätze lich-rechtliche Rundfunk legitimatorisch entlasten: Immer
hierzu gab es bereits bei der Bund-Länder-Kommission zur mehr Zuschauer, vor allem die jüngeren, nutzen kaum noch
Medienkonvergenz. Diese könnte konkrete Vorschläge er- öffentlich-rechtliche Programme. Deswegen wird – selbst
arbeiten und administrieren, wie die kooperationsorientier- wenn rechtlich inzwischen abgesichert – die allgemeine
te Zielvorgaben umgesetzt, gefördert und evaluiert werden Diskussion über die Notwendigkeit eines Rundfunkbeitrags
können. Eine erste Aufgabe des Expertengremiums sollte wohl nicht verstummen. Letztlich ginge es auch um ein
dabei sein, Vorschläge für eine solche sinnvolle institutio- größeres Ziel, nämlich ein Eigengewicht des publizistischen
nelle und organisationsbezogene Neuordung von Aufgaben Wettbewerbs gegenüber dem massiven Wettbewerbsdruck
und Kompetenzen einer dann «kooperativen» Medienpolitik unter den technischen und wirtschaftlichen Bedingungen
zu erarbeiten. Diese könnte dann wiederum die Kompe- von YouTube, Facebook und Co. zu gewährleisten.
tenz und politische Gestaltungskraft entwickeln, die neuen
Kooperationsprojekte, wo sinnvoll, auch aufsetzen und zu Abschließend auf den Punkt gebracht, sollten alle Überle-
evaluieren. gungen und Maßnahmen dem Grundprinzip einer beson-
deren Ausprägung von «Coopetition» folgen: Zusätzlich
Dabei wird eine wirksame Medienpolitik künftig überhaupt ermöglichte Kooperationen sind demnach grundsätzlich
nur noch dann eine kritische Masse aktivieren und sichern erwünscht, solange sie mithelfen, den so wichtigen publi-
können, wenn sie darauf setzt, möglichst umfassende, res- zistischen Wettbewerb nachhaltig zu stützen. Zielgröße ist,
sourcenhebelnde Kooperationsprojekte zu organisieren. In den Medienwettbewerb publizistisch zu stärken - und nicht
der neuen Winner-takes-all-Plattform- und globalen Ska- allein dem wirtschaftlichen Wettbewerb zu dienen. Wenn
lierungsökonomie des Digitalen ist ein gezieltes Zusam- die deutsche Medienlandschaft in ihrer jetzigen Form wei-
menwirken großer Ressourcen eine Grundbedingung. Nur ter existieren und ihre so wichtige Funktion für die Demo-
dann ist noch eine (Hebel-)Wirkung eines fördernden Mit- kratie und die soziale Marktwirtschaft weiter erfüllen soll,
teleinsatzes zu erzielen. Von großer Bedeutung wird hierbei muss die Medienordnung einem neuen Grundprinzip fol-
sein, dem starken und unabhängigen öffentlich-rechtlichen gen. Und das lautet Kooperation unter den Bedingungen
Rundfunk Freiheit und Anreize zu geben, sich in der neu- von Coopetition.
en digitalen Welt auch als eine zentrale Ordnungsinstanz
im Gesamt-Ökosystem der Medien zu begreifen. Eine Eine gekürzte Fassung des Textes ist zuvor in epd medien (48/2019) unter der
Rubrik „Debatte“ veröffentlicht worden.
konsequente Budget-Flexibilisierung bei einer zuverlässig © Stefan Obermeier, Muenchen
Diskussionsrunde beim 8. Medienkongress der vbw (v.l.): Prof. Dr. Christoph Neuberger, Prof. em. Dr. Otfried
Jarren, Prof. Dr. Tobias Gostomzyk und Prof. Dr. Frank Lobigs.
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
46 MedienWirtschaft 1/2020 Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Call for Participation
MedienWirtschaft
Die Zeitschrift MedienWirtschaft (MW) ist ein Periodikum für aktuelle betriebswirtschaftliche und volkswirt-
schaftliche Fragestellungen im Kontext von Medienunternehmen, Medienmanagement und Medienökonomie
vor dem Hintergrund der digitalen Transformation. Sie betont dabei insbesondere auch den interdisziplinären
Bezug zu kommunikations-, technik- und rechtswissenschaftlichen Perspektiven. Als Zeitschrift der angewand-
ten Forschung will die MedienWirtschaft sowohl Leser aus der Wissenschaft als auch aus der Praxis erreichen.
Zur Einreichung eingeladen werden Beiträge aus den oben genannten Themenfeldern in folgenden Kategorien:
Aktuelle Themen
■■ Standpunkte: Diese Rubrik enthält pointierte Statements zu kontroversen Themen.
■■ Aktuelles Stichwort: Wissenschaftlich fundiert und in kompakter Form wird ein in der aktuellen Diskussion relevan-
tes Stichwort präsentiert.
Aufsätze
■■ Abhandlungen: In diese Kategorie werden wissenschaftliche Beiträge aufgenommen, die sich innovativ mit relevan-
ten, aktuellen Fragestellungen aus den genannten Bereichen sowohl methodisch als auch theoretisch fundiert ausein-
andersetzen. Im Fokus sollen betriebs- und volkswirtschaftliche Fragen stehen, diese sollen aber durch den Einbezug
weiterer, insbesondere kommunikations-, technik- und rechtswissenschaftliche Perspektiven ergänzt werden.
■■ Übersichtsbeiträge: Hier werden Beiträge veröffentlicht, die eine systematische Übersicht über die Entwicklung
oder den State of the Art medienwirtschaftlicher Gebiete oder Konzepte präsentieren. Besonders erwünscht ist die
Berücksichtigung interdisziplinärer Zusammenhänge.
■■ Praxisforum: Hier werden Aufsätze zu aktuellen praxisrelevanten Fragen und Problemen aus der Praxis des Medien-
managements, der Medienökonomie und der Medienpolitik im weiteren Sinne publiziert.
Service
■■ Nachrichten aus Forschung und Lehre: Unter dieser Überschrift wird in kurzer Form über neuere Entwicklungen im
akademischen Bereich berichtet, z. B. über Konferenzen, neue Institutionen und Studiengänge oder Forschungsprojekte.
Allgemeine Hinweise
■■ Interessierte Autorinnen und Autoren werden gebeten, Manuskripte an die Schriftleitung (glaeser.martin@t-online.de
oder glaeser@hdm-stuttgart.de) oder an einen der Herausgeber einzureichen.
■■ Die Schriftleitung und jeder Herausgeber stehen für etwaige Rückfragen zur Verfügung.
■■ Die eingereichten Beiträge dürfen nicht anderweitig schon veröffentlicht bzw. zur Veröffentlichung eingereicht worden
sein; mit der Einsendung an die MedienWirtschaft verpflichtet sich der/die Autor/in, das Manuskript bis zum Ab-
schluss des Review-Verfahrens nicht anderweitig zur Veröffentlichung anzubieten oder zu veröffentlichen.
■■ Die Beiträge in den Kategorien Abhandlungen, Übersichtsbeiträge und Praxisforum werden einem Review-Prozess
unterzogen. In einem Vorverfahren prüfen die Herausgeber zunächst, ob ein Review-Verfahren in Gang gesetzt wird.
Das Review-Verfahren selbst erfolgt beiderseitig anonym.
Formalia
■■ Die Beiträge für die Kategorien Abhandlungen, Übersichtsbeiträge und Praxisforum sollten eine Zeichenzahl (inkl.
Leerzeichen) von 50.000 nicht überschreiten. Begründete Ausnahmen sind nach Absprache möglich.
■■ Für die Anonymisierung der Beiträge ist es erforderlich, dass dem Manuskript eine Titelseite vorangestellt wird, die
die Namens- und Adressangaben aller Autoren enthält. Im Manuskript sind Hinweise auf die Autoren zu vermeiden.
Herausgeber: Prof. Dr. Martin Gläser, Hochschule der Medien Stuttgart, glaeser@hdm-stuttgart.de / Prof. Dr. Georgios Gounalakis, Philipps-
Universität Marburg, gouna@jura.uni-marburg.de / Prof. Dr. Thomas Hess, Ludwig-Maximilians-Universität München, thess@bwl.lmu.de / Prof.
Dr. Frank Lobigs, Technische Universität Dortmund, frank.lobigs@udo.edu / Prof. Dr. Christoph Neuberger, Freie Universität Berlin, christoph.
neuberger@fu-berlin.de / Prof. Dr. Insa Sjurts, HSBA Hamburg School of Business Administration, insa.sjurts@hsba.de
Schriftleitung: Prof. Dr. Martin Gläser, Hochschule der Medien, Nobelstraße 10, 70569 Stuttgart, glaeser.martin@t-online.de; glaeser@hdm-
stuttgart.de
Verlag: New Business Verlag GmbH & Co. KG, Nebendahlstraße 16, 22041 Hamburg
https://doi.org/10.15358/1613-0669-2020-1-41
Generiert durch IP '172.22.53.54', am 16.06.2022, 00:13:35.
Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.Sie können auch lesen