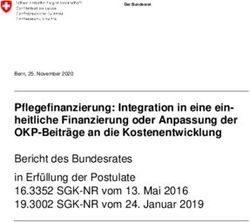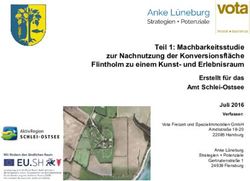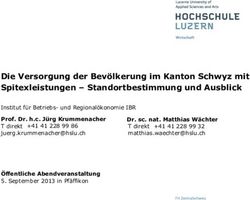Kritische Momente wissenschaftlichen Schreibens - Herzlich willkommen in der Schreibwerkstatt!
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kritische Momente
wissenschaftlichen Schreibens
Teil 1
Herzlich willkommen in der
Schreibwerkstatt!
ANKE BEYER
02.03.21Über mich
Anke Beyer
Linguistin
Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Doktorandin und
Dozentin am IVP NMS Bern
Dozentin wissenschaftliches Schreiben an
verschiedenen Schweizer Hochschulen
Interessenschwerpunkte: Textlinguistik,
Schreibdidaktik
Anke Beyer, 2021Forschungskreislauf
(nach Kruse, 2017)
Thema
Relevanz
Welche Bedeutung hat das
Schlussfolgerungen & Thema (Wissenschaft,
Fragestellung Berufsfeld)?
Ausblick
Auf welche Frage soll eine
Was folgt aus der Interpretation Antwort gegeben werden?
für die Forschung, die Praxis? Forschungsstand
Welche Fragen sind noch offen? Auf welchem theoretischen
und empirischen Wissensstand
baut die Arbeit auf?
Diskussion/Interpretation
Wie sind die Ergebnisse zu
interpretieren?
Forschungslücke
Auf welche Wissenslücke wird
Ergebnisse reagiert? (Erkenntnisanspruch,
Vorgehen und Methode Zielsetzung)
Welches Material ist
dabei entstanden? Wie sieht der Lösungsweg aus,
(Ergebnisse) um zu neuer Erkenntnis zu
gelangen?Programm Schreibwerkstatt Teil 1: Gelesenes Wiedergeben Reduzieren Zusammenfassen Zitieren, Paraphrasieren, Plagiieren Teil 2: ??? Entscheiden Sie mit! (Umfrage im Moodle)
Übung: Text auf Hauptaussagen reduzieren
Überfliegen Sie kurz den gesamten Text.
Beantworten Sie für jeden Absatz folgende zwei Fragen
schriftlich:
1. Welches Thema wird in diesem Absatz
behandelt? (als Stichwort, Titel)
2. Welche Hauptaussage wird zu diesem Thema
in diesem Absatz formuliert?
(ein Aussagesatz)
Anke Beyer, 2021Thema und Hauptaussage diskutieren In Gruppen: Lesen Sie einander Thema und Hauptaussage für den 1. Absatz vor und diskutieren Sie diese. Einigen Sie sich auf ein Thema und eine Hauptaussage und schreiben Sie diese auf. Anke Beyer, 2021
Themen Absatz 1 1. Beziehung Klient - Therapeut 2. Beziehungsgestaltung 3. Therapeutische Beziehungsgestaltung 4. Professionelle Beziehung in der Beratung 5. Wechselbeziehungen 6. Wechselbeziehung zwischen Therapeuten und Klienten 7. Beziehungsvorstellung zwischen Berater und Klient 8. Erfolg der Beratung 9. Grundlage für den Erfolg einer Beratung 10. Relevanz der Beziehung zwischen Therapeut und Klient Anke Beyer, 2021
Hauptaussagen Absatz 1
1. Die Beziehungsgestaltung ist massgebend für den Erfolg der Therapie.
2. Die Klienten-Therapeuten-Beziehung ist ein wichtiger Bestandteil in der
Beratung.
3. Einer professionellen Wechselbeziehung zwischen Therapeut*in und
Klient*in soll gründliche Aufmerksamkeit geschenkt werden.
4. Für eine erfolgreiche Beratung soll der Wechselbeziehung zwischen
Therapeut und Klient mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden.
5. Der Beziehung muss Aufmerksamkeit geschenkt werden.
6. Zu einer therapeutischen Beziehungsform existiert keine klare Vorstellung.
7. Erfolgreiche Beratung setzt eine befriedigende Beziehung zwischen
Therapeut und Klient voraus.
8. Aufmerksamkeit muss sich mehr auf die Wechselwirkung zwischen
Therapeut und Klient konzentrieren.
9. Bemühungen von Beratern bleiben meist ohne Erfolg, da sie keine klare
Vorstellung von der Beziehung haben, die existieren sollte.
10. Therapeutische Bemühungen führen zum Erfolg, wenn der Berater eine
klare Vorstellung der Beziehung hat.
Anke Beyer, 2021Übung: Zusammenfassende Inhaltswiedergabe Schreibt einen Text, der die Hauptaussagen aller Absätze mit eigenen Worten zusammenfasst (ohne Einbezug des Autors). Eine halbe bis eine ganze Seite Anke Beyer, 2021
Intertextualität: Bezugnahme auf fremde Texte
(nach Kruse 2012)
(in Anlehnung an Jakobs 1994)
• Beziehungsgestaltung
• Akzeptieren von Autoritäten
Vernetzung mit der und Traditionen
scientific community
• Import von Argumenten
• Darstellung des
Aufbau Forschungsstandes
des Textes • Formulierungshilfen
Bezugnahme auf • Anzeigen des
fremde Texte kann Wissenshintergrundes
folgende Funktionen Leserservice • Verweis auf weiterführende
erfüllen: Literatur
• Demonstration von
Belesenheit
Selbstdarstellung • Darstellung von
Zugehörigkeiten
• Absicherung gegen Kritik
Anke Beyer, 2021Verpflichtungen beim Umgang mit
wissenschaftlicher Literatur
(nach Kruse 2012)
Den Inhalt unverfälscht wiedergeben
In eigenen Worten wiedergeben (paraphrasieren)
Fachbegriffe beibehalten, nicht umschreiben
Alles Wissen zitieren, das aus fremden Quellen stammt
Jede Quelle muss auffindbar sein
Ein einheitliches Zitationssystem verwenden (z.B. MLA)
Anke Beyer, 2021Arten des Zitierens (nach Kruse 2010) Wiedergabe mit eigenen Worten (paraphrasieren) Wörtliches Zitat Zitat aus zweiter Hand Verweis auf weiterführende, ergänzende Literatur Anke Beyer, 2021
Was wird wörtlich zitiert? Definitionen Kernaussagen Zu diskutierende Forschungsmeinungen, bei denen es auf die Formulierung ankommt Prägnant formulierte Forschungsmeinungen zur Stützung der eigenen Argumentation Wichtig: Wörtliche Zitate sparsam und begründet verwenden Anke Beyer, 2021
„Formalia sind
nicht alles, aber
ohne Formalia ist
alles nichts.“
(Reinicke, 2019)
Anke Beyer, 2021Anke Beyer, 2021
Plagiat Plagiieren heisst, fremdes Gedankengut als eigenes auszugeben. Eine Arbeit ist dann ein Plagiat, wenn Textstellen aus Fremdtexten teilweise oder ganz kopiert oder sinngemäss wiedergegeben werden, ohne die entsprechenden Quellen anzugeben. An der HES-SO werden Arbeiten mit Hilfe einer Software auf Plagiate hin überprüft. Konsequenzen vgl. „Merkblatt zum wissenschaftlichen Schreiben“ Anke Beyer, 2021
Beispiel Original: Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen können. aus: Müller Staub (2013). Kritisches Denken: Sich kein X für ein U vormachen lassen. In: Panfil (Hrsg.). Wissenschaftliches Arbeiten in der Pflege. Bern: Huber. Anke Beyer, 2021
Korrektes Zitat?
Original:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung
von Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt
einen Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.
Version 1:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen
Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.
Dies ist ein Plagiat, da der Text ein nicht gekennzeichnetes wörtliches
Zitat ohne Quellenangabe enthält.
Anke Beyer, 2021Korrektes Zitat?
Original:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen
Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.
Version 2:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen
Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können (Müller Staub, 2013, 76).
Auch hier handelt es sich um ein Plagiat, da ein wörtliches Zitat als ein
sinngemässes ausgegeben wird. Es müssen hier Anführungszeichen
gesetzt werden.
Anke Beyer, 2021Korrektes Zitat?
Original:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen
Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.
Version 3:
Durch eine konsistente Pflegefachsprache wird die Aneignung von
Bestimmungen und Bedeutungen einzelner Konzepte vereinfacht
und ein begrifflicher Rahmen zur Verfügung gestellt.
Pflegefachpersonen können so Entscheidungen treffen, die durch
den Wissenskörper der Pflege begründet sind.
Auch das ist ein Plagiat. Der Inhalt des Fremdtextes wurde übernommen. Der
Satz wurde zwar umgestellt und einzelne Wörter ausgelassen bzw. durch
Synonyme ergänzt. Der Status als Paraphrase ist fraglich. In jedem Fall muss
hier die Quelle angegeben werden.
Anke Beyer, 2021Korrektes Zitat?
Original:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung
von Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und
stellt einen Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass
Pflegefachpersonen aufgrund des Wissenskörpers der Pflege
Entscheidungen treffen können.
Version 4:
Durch eine einheitliche Pflegefachsprache wird die Aneignung
von Bestimmungen und Bedeutungen einzelner Konzepte
erleichtert und ein Begriffsrahmen zur Verfügung gestellt.
Pflegefachpersonen können so aufgrund des Wissenskörpers
der Pflege Entscheidungen treffen (Müller Staub, 2013: 76).
Hier ist der Status als Paraphrase fraglich, da die Sprache des Originals
verwendet wurde und der Satz nur minimal abgewandelt ist.
Anke Beyer, 2021Korrektes Zitat?
Original:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen
Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen
aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.
Version 5:
Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von
Definitionen, so dass Pflegefachpersonen aufgrund des
Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen können (Müller
Staub, 2013: 76).
Hier handelt es sich ebenfalls um ein Plagiat. Das Entfernen von Teilen
des Satzes entbindet nicht von der Pflicht, das Zitat als wörtlich zu
kennzeichnen.
Anke Beyer, 2021Korrektur Version 5
„Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung
von Definitionen (...), so dass Pflegefachpersonen aufgrund
des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen
können.“ (Müller Staub, 2013: 76)
Anke Beyer, 2021Mögliche Paraphrase Original: Eine einheitliche Pflegefachsprache erleichtert die Aneignung von Definitionen und Bedeutungen einzelner Konzepte und stellt einen Begriffsrahmen zur Verfügung, so dass Pflegefachpersonen aufgrund des Wissenskörpers der Pflege Entscheidungen treffen können. Paraphrase: Pflegefachpersonen können nur dann auf Grundlage des Wissens der Pflege Entscheidungen für Ihr Handeln treffen , wenn die Pflege eine Fachsprache mit einer einheitlichen Terminologie verwendet (Müller Staub, 2013: 76). Anke Beyer, 2021
Paraphrasieren
Textverständnis
Fremder Text Eigener Text
Anke Beyer, 2021Formulierungen in berichtenden
Zusammenfassungen
Laut/gemäss/nach R. ... R. unterstreicht ...
R. setzt sich mit ...
R. zufolge ...
auseinander
R. untersucht ...
R. stellt fest ...
R. kritisiert/bemängelt ... R. zeigt auf ...
R. führt aus ... R. vertritt die Ansicht, die
R. betont ... Auffassung, den Standpunkt,
R. behauptet ...
die Position ...
R. geht davon aus ...
R. hebt hervor ...
R. sieht Ursachen in ...
R. plädiert dafür ...
R. spricht sich dafür aus ...
Es handelt sich dabei nicht um beliebig austauschbare Alternativen.
Sie müssen bewusst eingesetzt werden.
Anke Beyer, 2021Übung: Berichtende Zusammenfassung
Überarbeiten Sie Ihre Zusammenfassung so, dass an jeder Stelle
klar ist, von wem die Aussage stammt (unter Einbezug des
Autors über das Gelesene berichten).
Bauen Sie ein wörtliches Zitat ein.
Anke Beyer, 2021Beispiel Zusammenfassende Inhaltswiedergabe Leseforschung betrachtet Ebenen des Lesens, die hierarchisch strukturiert sind von der Buchstaben- und Worterkennung bis zum Erfassen der Gesamtstruktur. Es gibt zwei Modelltypen. Der modulare Ansatz geht auf Fodor (1983) zurück und vermutet, dass Lesen durch unabhängige Teilprozesse von statten geht, wobei die niedrigeren Prozesse Vorlauf vor den höheren haben. Der interaktiv-konnektivistische Ansatz geht auf McClelland & Rumelhart (1981) zurück und nimmt an, dass die Verarbeitung auf verschiedenen Ebenen simultan von statten gehen kann. Aufgrund ihrer besseren empirischen Fundierung wird dem zweiten Modell der Vorrang gegeben. Grundlage: "Textauszug Thema Lesen“ im Moodle Anke Beyer, 2021
Beispiel Referierende Zusammenfassung Richter & Christmann (2006) gehen davon aus, dass alle Lesetheorien den Leseprozess in Ebenen aufteilen, die von der elementaren Buchstabenerkennung bis zum Erkennen kohärenter Textstrukturen reichen. Sie unterscheiden zwei Modelltypen, die das Zusammenwirken der Ebenen unterschiedlich erklären. Das modulare Modell führen sie auf Fodor (1983) zurück, der verschiedene autonome Teilsysteme postulierte, unter denen die niedrigeren Prozesse Vorlauf vor den höheren haben. Das interaktive Aktivationsmodell, das sie McClelland & Rumelhart (1981) zuschreiben, geht hingegen davon aus, dass die Verarbeitung auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig von statten geht, wobei höhere und niedrigere Prozesse in beliebiger Folge ablaufen und miteinander agieren können. Die Autoren präferieren das zweite Modell in der Variante von van Dijk und Kintsch (1983), in der fünf Teilprozesse unterschieden werden, die sie verschiedenen Hierarchieebenen zuordnen. Grundlage: "Textauszug Thema Lesen“ im Moodle Anke Beyer, 2021
Beispiel Referierende Zusammenfassung Richter & Christmann (2006) gehen davon aus, dass alle Lesetheorien den Leseprozess in Ebenen aufteilen, die von der elementaren Buchstabenerkennung bis zum Erkennen kohärenter Textstrukturen reichen. Sie unterscheiden zwei Modelltypen, die das Zusammenwirken der Ebenen unterschiedlich erklären. Das modulare Modell führen sie auf Fodor (1983) zurück, der verschiedene autonome Teilsysteme postulierte, unter denen die niedrigeren Prozesse Vorlauf vor den höheren haben. Das interaktive Aktivationsmodell, das sie McClelland & Rumelhart (1981) zuschreiben, geht hingegen davon aus, dass die Verarbeitung auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig von statten geht, wobei höhere und niedrigere Prozesse in beliebiger Folge ablaufen und miteinander agieren können. Die Autoren präferieren das zweite Modell in der Variante von van Dijk und Kintsch (1983), in der fünf Teilprozesse unterschieden werden, die sie verschiedenen Hierarchieebenen zuordnen. Grundlage: "Textauszug Thema Lesen“ im Moodle Anke Beyer, 2021
Zwei Arten der zusammenfassenden Wiedergabe
fremder Texte
Zusammenfassende Inhaltswiedergabe: Wiedergabe des
Inhalts (auf der Sachebene) ohne Einbezug des Autors
Referierende Zusammenfassung: Bericht über das Handeln
eines Autors/einer Autorin
Faustregel:
Für unstrittiges Wissen wird eher die zusammenfassende
Inhaltswiedergabe genutzt (Schildern einer Faktenlage).
Sobald es strittig wird, sobald spezifische Aussagen einzelner
Autoren oder die Ergebnisse bestimmter Studien,
Argumentationen wiedergegeben werden, dann wird die
referierende Zusammenfassung genutzt.
Anke Beyer, 2021Anke Beyer, 2021
Sorgfältig Bibliographieren
Grundsätzlich:
Quellen eindeutig identifizierbar
alphabetisch geordnet
Vornamen ausschreiben
Jedes Element der Quelle vom Folgenden durch ein Satzzeichen
trennen
Quellentitel kursiv hervorheben
Herausforderung: Verschiedene Arten von Quellen
Vgl. „Merkblatt zum wissenschaftlichen Schreiben“
Anke Beyer, 2021Portfolio-Arbeitsauftrag 3 Lesen und Bearbeiten einer empirischen Studie zum Thema der BA Abgabe: Mittwoch, 10.03.21 als Word-Datei auf Moodle; wichtig: auch die Studie (als PDF) hochladen Feedback: 16.03.21 / 23.03.21 Anke Beyer, 2021
Programm für 2. Halbtag Nehmen Sie an der Umfrage im Moodle teil (bis 8. März)
Literatur Reinicke, Katja (2019). Wissenschaftlich schreiben und denken. Tübingen: Narr. Kruse, Otto (2017). Kritisches Denken und Argumentieren. Konstanz: Huter & Roth.
Sie können auch lesen