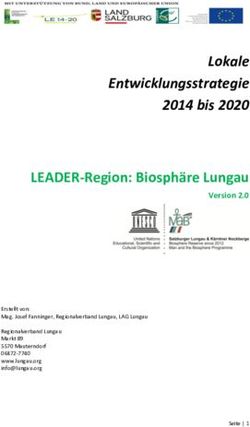Leader reloaded: Region WEITER denken! - LOKALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE 2014 bis 2020 Leader-Region LAG Lebens.Wert.Pongau
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LOKALE ENTWICKLUNGSSTRATEGIE
2014 bis 2020
Leader-Region LAG Lebens.Wert.Pongau
Leader reloaded:
Region WEITER denken!
erstellt von:
Stephan Maurer, LAG Lebens.Wert.Pongau/Regionalverband Pongau
geändert von:
Cathrine Schwenoha, MA, Leader Lebens.Wert.Pongau
Überarbeitete Version
25.08.2016
LAG Lebens.Wert.Pongau
Bahnhofgasse 12
A-5500 Bischofshofen
Tel.: 06462/33030-35
Fax: 06462/33030-34
Email: leader@pongau.org
Web: leader.pongau.org
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 1 von 71Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis 4
1. Beschreibung der Lokalen Aktionsgruppe 5
1.1. Festlegung des Gebiets und Beschreibung der Gebietscharakteristik 5
1.2. Angaben zur Bevölkerungsstruktur 6
2. Analyse des Entwicklungsbedarfs 7
2.1. Beschreibung der Region und der sozioökonomischen Lage 7
2.1.1. Bevölkerungsentwicklung 7
2.1.2. Arbeitsmarkt 8
2.1.3. Touristische Entwicklung 10
2.1.4. Wirtschaftliche Entwicklung in der Region 10
2.1.5. Bildung und Erwerbstätigkeit 11
2.1.6. Mobilität und Erreichbarkeit 11
2.2. Reflexion und Erkenntnisse aus der Umsetzung von Leader in der Periode 2007 – 2013 12
2.3. SWOT-Analyse der Region 13
2.4. Darstellung der lokalen Entwicklungsbedarfe 16
3. Lokale Entwicklungsstrategie 19
3.1. Aktionsfeld 1: Wertschöpfung 19
3.1.1. Handlungsfeld 1.1.: Lebensgrundlage Land 19
3.1.2. Handlungsfeld 1.2.: Stärkung der Tourismuswirtschaft 21
3.1.3. Handlungsfeld 1.3.: Wirtschaft mit Zukunft 23
3.1.4. Beschreibung der Kooperationsaktivitäten im Aktionsfeld 1 25
3.1.5. Zusammenfassende Darstellung: Wirkungsmatrix Aktionsfeld 1 26
3.2. Aktionsfeld 2: Weiterentwicklung der natürlichen Ressourcen und des kulturellen Erbes 28
3.2.1. Handlungsfeld 2.1.: Regionale Kultur zur Stärkung der regionalen Identität 28
3.2.2. Handlungsfeld 2.2.: Ausbau der Nutzung und Effizienz regionaler Ressourcen 29
3.2.3. Beschreibung der Kooperationsaktivitäten im Aktionsfeld 2 31
3.2.4. Zusammenfassende Darstellung: Wirkungsmatrix Aktionsfeld 2 32
3.3. Aktionsfeld 3: Stärkung der für das Gemeinwohl wichtigen Strukturen und Funktionen 34
3.3.1. Handlungsfeld 3.1.: Gemeinsam leben, bleiben, gestalten 34
3.3.2. Handlungsfeld 3.2.: Wissen | Lernen | Leben 36
3.3.3. Handlungsfeld 3.3.: Ausbau und Stärkung einer neuen regionalen Mobilität 37
3.3.4. Beschreibung der Kooperationsaktivitäten im Aktionsfeld 3 39
3.3.5. Zusammenfassende Darstellung: Wirkungsmatrix Aktionsfeld 3 40
3.4. Aktionsfeld IWB 42
3.5. Aktionsfeld ETZ 42
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 2 von 713.6. Berücksichtigung der Ziele der Partnerschaftsvereinbarung und des Programms LE 2020 42
3.7. Berücksichtigung der bundeslandrelevanten und regionsspezifischen Strategien 44
3.8. Erläuterung der integrierten, multisektoralen und innovativen Merkmale der Strategie 46
3.9. Beschreibung geplanter Zusammenarbeit und Vernetzung 46
4. Steuerung und Qualitätssicherung 47
Beschreibung der Vorkehrungen für Steuerung, Monitoring und Evaluierung der LAG-internen
4.1. 47
Umsetzungsstrukturen
Beschreibung der Vorkehrungen für Steuerung, Monitoring und Evaluierung der Strategie- und
4.2. 48
Projektumsetzung inkl. Reporting an die Verwaltungsbehörde und Zahlstelle
5. Organisationsstruktur der LAG 50
5.1. Rechtsform der LAG 50
5.2. Zusammensetzung der LAG 51
5.3. LAG-Management 52
5.4. Projektauswahlgremium 53
5.5. Ausschluss von Unvereinbarkeiten (Interessenskonflikten) 54
6. Umsetzungsstrukturen 55
6.1. Arbeitsabläufe , Zuständigkeiten, Entscheidungskompetenzen 55
6.1.1. Übersicht der Zuständigkeiten 56
6.2. Auswahlverfahren für Projekte (inklusive Projektauswahlverfahren) 57
6.2.1. Darstellung der Projektauswahlkriterien 58
6.2.2 Kleinprojekte in der Leader-Region 61
6.2.3 Fördersätze für Leader-Projekte 61
6.3. Darstellung der Transparenz der Entscheidungen 62
7. Finanzierungsplan (indikative Finanztabelle für die Gesamtperiode) 62
7.1. Eigenmittelaufbringung für die LAG 62
7.2. Budget für Aktionsplan 65
7.3. Budget für Kooperationen 66
7.4. Budget für LAG-Management und Sensibilisierung 66
7.5. Herkunft der Budgets für LAG eigene Projekte 67
8. Erarbeitungsprozess der Entwicklungsstrategie 67
9. Beilagen 69
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 3 von 71Verwendete Abkürzungen AMS Arbeitsmarktservice DV Direktvermarkter EW EinwohnerInnen GRÖ Genuss Region Österreich i. S. v. im Sinne von KMU Kleine und Mittlere Unternehmen KWK Kleinwasserkraftwerk LAG Leader-Aktionsgruppe LAGn Leader-Aktionsgruppen LES Lokale Entwicklungsstrategie LFI Ländliches Fortbildungsinstitut LVL Leader Verantwortliche Landesstelle NGO non governmental organisation - Nicht-Regierungsorganisation ÖIF Österreichischer Integrationsfond ÖPNV Öffentlicher Personen-Nahverkehr PAG Projektauswahlgruppe QM Qualitätsmanagement QMT Qualitätsmanagement-Team QS Qualitätssicherung SIR Salzburger Institut für Raumordnung TEPO Tennengau-Pongau (Energieregion, ehem. Leader-Kooperationsprojekt) ZVR Zentrales Vereinsregister Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 4 von 71
1. Beschreibung der Lokalen Aktionsgruppe
1.1. Festlegung des Gebiets und Beschreibung der Gebietscharakteristik
Das Gebiet der Leader-Region „Lebens.Wert.Pongau“ umfasst 22 Gemeinden im politischen Bezirk
Sankt Johann Pongau („Region Pongau“) sowie 3 Gemeinden im politischen Bezirk Hallein („Region
Tennengau“). Von den 25 Gemeinden der Region Pongau gehören 22 Gemeinden der LAG Le-
bens.Wert.Pongau an, das sind die Gemeinden Altenmarkt im Pongau, Bad Hofgastein, Bischofsh-
ofen, Dorfgastein, Eben im Pongau, Filzmoos, Flachau, Forstau, Goldegg, Hüttau, Kleinarl, Mühl-
bach am Hochkönig, Pfarrwerfen, Radstadt, Schwarzach, Sankt Johann im Pongau, Sankt Martin
am Tennengebirge, Sankt Veit im Pongau, Untertauern, Wagrain, Werfen und Werfenweng. Die
drei Pongauer Nationalparkgemeinden Großarl, Hüttschlag und Bad Gastein der LAG Nationalpark
Hohe Tauern. Von den insgesamt 13 Gemeinden der Region Tennengau gehören die 3 Gemeinden
Scheffau, Abtenau und Russbach der Leader-Region „Lebens.Wert.Pongau“ an.
Dadurch erweitert sich die bereits in Leader 2007 bis 2013 erfolgreich arbeitende LAG Le-
bens.Wert.Pongau auf insgesamt 25 Gemeinden mit 77.574 Einwohnerinnen und Einwohnern
(Einwohnerdaten 01.01.2014, Landesstatistik Salzburg) und wird zu einer bezirksübergreifenden
Leader-Region.
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 5 von 71Der Natur- und Landschaftsraum der Region wird bestimmt durch die Gebirgszüge der Salzburger
Kalkhochalpen im Norden und der Hohen Tauern im Süden der Region, durch die sanften Hanglagen
der Pongauer Schieferzone sowie durch die Talräume der Salzach und Enns. Mitten durch die Region
zieht sich das Tennengebirge als Teil der nördlichen Kalkalpen, sowohl Gemeinden des Tennengaus
als auch des Pongaus haben einen Anteil daran. Das Tennengebirge stellt als Teil der Bezirksgrenze
die Trennung zwischen dem Tennengau mit den Gemeinden Scheffau, Abtenau und Russbach und
den Gemeinden des Pongaus dar.
Weiters wird die Region von der Lebensader Salzach dominiert, die sich in nördlicher Richtung durch
den sog. „Pass Lueg“ windet, welcher das Salzachtal mit dem Tennengebirge auf östlicher Seite und
dem Hagengebirge auf westlicher Seite durchschneidet.
Die Region liegt zwischen dem Pinzgau im Westen, dem Lungau im Südosten und dem Zentralraum
der Stadt Salzburg im Norden inmitten der Alpen. Im Süden grenzt sie an das Bundesland Kärnten
und im Osten zu geringen Teilen an die Steiermark sowie über wenige Kilometer an Oberösterreich.
Im Nordwesten gibt es zusätzlich eine Grenze zum bayerischen Landkreis Berchtesgadener Land.
1.2. Angaben zur Bevölkerungsstruktur
Einwohner Bevölkerungsdichte
Gemeinde 01.01.2014 Fläche in km² EW/km²
Altenmarkt im Pongau 3.873 48,6 79,7
Bad Hofgastein 6.748 103,8 65,0
Bischofshofen 10.310 49,5 208,1
Dorfgastein 1.618 54,1 29,9
Eben im Pongau 2.266 35,9 63,1
Filzmoos 1.461 75,6 19,3
Flachau 2.703 117,3 23,0
Forstau 533 59,4 9,0
Goldegg 2.486 33,1 75,2
Hüttau 1.536 53,6 28,7
Kleinarl 760 70,4 10,8
Mühlbach am Hochkönig 1.508 51,7 29,2
Pfarrwerfen 2.231 38,1 58,5
Radstadt 4.797 60,8 78,8
St. Johann im Pongau 10.760 78,1 137,7
St. Martin am Tennengebirge 1.585 46,9 33,8
St. Veit im Pongau 3.592 56,9 63,1
Schwarzach im Pongau 3.543 3,2 1.107,6
Untertauern 484 71,7 6,7
Wagrain 3.030 50,5 60,0
Werfen 2.963 153,3 19,3
Werfenweng 934 45,0 20,8
Abtenau 5.717 187,1 30,6
Rußbach am Paß Gschütt 784 34,0 23,03
Scheffau am Tennengebirge 1.352 69,7 19,41
77.574 1.648,5 47,1
Bevölkerungsstand zum 01.01.2014; Quelle: Landesstatistik Salzburg, Stand August 2014
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 6 von 71Die Gemeinden der Leader-Region erfuhren in den letzten 30 Jahren eine positive Bevölkerungsent-
wicklung. Lebten am 1. Jänner 1981 insgesamt 64.787 EinwohnerInnen in den 25 Gemeinden der
Leader-Region, so stieg die Wohnbevölkerung bis zum 1. Jänner 2014 um insgesamt 16,5 % auf
77.574 EinwohnerInnen. Seit dem Jahr 2011 verlief der Bevölkerungszuwachs jedoch nur mehr mo-
derat, um 465 Personen oder + 0,6 %. Die angeführte Tabelle zeigt die Bevölkerungsstruktur auf
kommunaler Ebene
2. Analyse des Entwicklungsbedarfs
2.1. Beschreibung der Region und der sozioökonomischen Lage
2.1.1. Bevölkerungsentwicklung
Aktuelle Prognosen sagen der Salzburger Bevölkerung noch bis 2047 ein Wachstum voraus. Dann
wird sie mit 558.609 Personen - das sind um 26.711 Personen bzw. 5,0 % mehr als Anfang 2013 -
ihren Höchststand erreichen und anschließend wieder sinken. Die zunehmende Zahl an Sterbefällen
lässt die Geburtenbilanz immer geringer werden. 2028 wird es in Salzburg voraussichtlich zum ersten
Mal seit Ende des zweiten Weltkrieges mehr Sterbefälle als Geburten geben.
Der Jugendanteil wird von aktuell 20,9 % auf bis zu 17,6 % in 40 Jahren sinken, der Seniorenanteil
von 17,3 % auf 29,3 % steigen. Ab 2020 werden in Salzburg voraussichtlich mehr 65-Jährige und Älte-
re als unter 20-Jährige leben. Der Anteil der Salzburgerinnen und Salzburger, die im Ausland geboren
wurden, betrug Anfang 2013 16,2 % und wird in den nächsten 40 Jahren auf 22,7 % wachsen. Die
Zahl der in Österreich Geborenen
wird schon 2020 ihren Höhepunkt
erreichen und dann wieder zu-
rückgehen, die Zahl der im Ausland
Geborenen wird dagegen bis 2053
um fast 50 % zunehmen. In den
nächsten 20 Jahren wird Öster-
reich um 7,0 % wachsen. Wien
wird im Vergleich zu den anderen
Bundesländern mit + 14,8 % mit
Abstand am stärksten zulegen.
Salzburg wird mit + 4,4 % auf Platz
7 liegen. Kärnten wird als einziges
Bundesland - wie schon in den
letzten zehn Jahren -ein Bevölke-
rungsdefizit (- 2,1 %) hinnehmen
müssen. Circa im Jahr 2025 wird
Salzburg Kärnten als sechstgrößtes
Bundesland Österreichs ablösen.
Quelle: Landesstat. Dienst
Zur Betrachtung herangezogen wurden die 25 Leader-Gemeinden (22 Pongauer, 3 Tennengauer Ge-
meinden) im Zeitraum 1981 bis 2014. Grundsätzlich ist ein stetiges Bevölkerungswachstum zu ver-
zeichnen, im genannten Zeitraum um plus 19%, dies entspricht 12.787 Personen mehr in der Region.
Wenn man die Teilregionen vergleicht, so kann der Ennspongau (11 Gemeinden) ein durchschnittli-
ches Wachstum von fast 22% verzeichnen, die 3 Tennengauer Gemeinden rund 11%, die zwei Gastei-
ner Gemeinden rund 12% und der Salzachpongau rund 14%, was insofern beachtlich ist, als die zwei
größten Orte der Region, nämlich Bischofshofen und St. Johann im Pongau, sich im Salzachpongau
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 7 von 71befinden. Aber auch die drei Orte mit einem Bevölkerungsschwund (Mühlbach am Hkg. – minus
9,5%, Schwarzach im Pg. – minus 4%, Werfen – minus 7%) befinden sich im Salzachpongau.
Auffällig ist bei diesen drei Ge-
meinden die relativ große Anzahl
der über 65jährigen mit 19-21%,
während der Durchschnittswert in
der Region bei 16% liegt. Entspre-
chend niedriger ist die Einwohner-
zahl der Unter-20jährigen. Auffal-
lend „jung“ ist die Gemeinde Wer-
fenweng mit einem Anteil von Un-
ter-20jährigen von fast 27% und
nur rund 11% von Über-65jährigen.
Gleichzeitig ist Werfenweng die
Gemeinde mit dem höchsten Be-
völkerungswachstum, nämlich seit
1981 43,7%. Die höchste Zweit-
wohnsitz-Dichte hat die Gemeinde
Untertauern mit 787 Zweitwoh-
nungen auf 484 Einwohner, also
fast 163%. Am wenigsten Zweit-
wohnungen verzeichnet die Ge-
meinde St. Veit mit rund 4%.
Der durchschnittliche Ausländeranteil in der Region beträgt 9,4%. Den geringsten Ausländeranteil hat
die Gemeinde Scheffau mit 3%, den höchsten Anteil an Nicht-Österreichern Untertauern mit 17%.
2.1.2. Der Arbeitsmarkt
Beschäftigungsentwicklung:
Die unselbständige Beschäftigung hat im Jahr
2013 einen Rekordwert erreicht. Die bisherige
Höchstmarkte aus dem Jahr 2012 wurde noch
einmal um 236 Beschäftigungsverhältnisse über-
boten. Im Jahresdurchschnitt gab es im Bezirk
Pongau rund 34.193 Dienstverhältnisse, das ist
zum Vorjahresvergleich ein Plus 0,7 Prozent.
Dabei konzentrierten sich die Beschäftigungszu-
wächse vor allem auf das 1.Halbjahr. Der Be-
schäftigungszuwachs geht ausschließlich auf die
Ausländerbeschäftigung zurück. Hier gab es ein
Plus von 5,9 Prozent (auf 6.085 Beschäftigungsverhältnisse) während die Zahl der Beschäftigungs-
verhältnisse von Inländer/innen um 0,4% (auf 28.109) gesunken ist. Von der zusätzlichen Beschäfti-
gung profitierten mit einem Plus von 0,85% stärker Frauen (auf 16.234 Dienstverhältnisse), während
die Männer-Beschäftigung nur um 0,55% (auf 17.959 Dienstverhältnisse) gestiegen ist. Landesweit
lag der Beschäftigungsanstieg bei plus 0,4 Prozent. Trotz schwacher Konjunkturlage blieb die Arbeits-
kräftenachfrage im Pongau auf hohem Niveau. 2013 wurden dem Arbeitsmarktservice (AMS) insge-
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 8 von 71samt 6.956 freie Stellen zur Besetzung gemeldet, das waren um 3,9% oder 287 Stellen weniger als
2012.
Arbeitslosigkeit:
Nicht nur die Beschäftigung auch die Arbeitslosigkeit hat 2013 einen Höchststand erreicht und die
Marke aus dem Krisenjahr 2009 übertroffen. Mit einem Zuwachs von 11,6% (oder 221 Personen)
gegenüber 2012 waren im Jahresdurchschnittsbestand 2.129 Menschen im Pongau arbeitslos gemel-
det. Knapp 45% der beim AMS gemeldeten Arbeitslosen hat max. die Pflichtschule besucht.
Die Verweildauer, also die durchschnittliche
Dauer der Arbeitslosigkeit, ist 2012 gegenüber
dem Vorjahr um 5 Tage angestiegen und be-
trägt 67 Tage und liegt damit 8 Tage unter der
durchschnittlichen Dauer der Arbeitslosigkeit
im Land Salzburg.
Ausgewählte Personengruppen:
Langzeitarbeitslose: Die Langzeitarbeitslosig-
keit, also die Arbeitslosigkeit von Personen, die
mehr als zwölf Monate arbeitslos vorgemerkt
waren, ist – von niedrigem Niveau ausgehend –
um 18% oder 9 auf 47 Personen gestiegen.
Ältere und jüngere Arbeitslose: Die Zahl junger
Arbeitskräfte bis 24 Jahre ist 2013 mit plus
10,6% auf 356 Personen am Niveau der Ge-
samtarbeitslosigkeit gestiegen.
In der Altersgruppe 15–19 Jahre ist die Arbeitslosigkeit geringfügig um 0,7% auf 68 Personen ange-
stiegen. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersgruppe beträgt daher lediglich 3,0%. Bei jungen Ar-
beitskräften bis 24 Jahre liegt die Quote mit 6,9% über jener der Gesamtarbeitslosigkeit
Bei älteren Arbeitskräften ab 50 Jahre liegt der prozentuelle Anstieg der Arbeitslosigkeit mit 11,4%
(auf 478 Betroffene) am Gesamtniveau. Die Arbeitslosenquote beträgt in dieser Altersgruppe 6,2%.
Gleiches gilt für die Arbeitslosigkeit im Haupterwerbsalter (25-49 Jahre), der Anstieg von 11,4% auf
1.296 liegt am Niveau der Gesamtarbeitslosigkeit. Dies ergibt eine Arbeitslosenquote im Haupter-
werb von 6,1 %.
Frauen und Männer: Im Jahresdurch-
schnitt 2013 waren 1.040 Frauen und
1.089 Männer arbeitslos vorgemerkt. Bei
Männern lag der Zuwachs (+13,6%) deut-
lich höher als bei Frauen(+9,5%). Da vom
Beschäftigungsanstieg vor allem weibliche
Arbeitskräfte stärker profitierten tendiert
die Arbeitslosenquote Richtung Anglei-
chung (Frauen 6,0%, Männer 5,7%)
In- und Ausländer/innen: Bei ausländi-
schen Arbeitskräften ist die Arbeitslosig-
keit mit plus 20,7% auf 670 Personen fast dreimal so hoch gestiegen, wie bei den inländischen Ar-
beitskräften (+7,9% auf 1.459). (Quelle gesamt: AMS Pongau)
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 9 von 712.1.3. Touristische Entwicklung
Im Jahr 2013 wurden in der Region rund 7,4 Mio. Nächtigungen verzeichnet, das entspricht einer
Zunahme von 14,1% in den letzten 10 Jahren. Die touristische Entwicklung der letzten 10 Jahre ist so
vielfältig wie die Region selbst. Zum einen gibt es enorme Zuwächse von bis zu 52% (Kleinarl) bei den
Nächtigungszahlen, zum anderen eklatante Einbrüche mit bis zu 40% (Scheffau).
Der Trend ist eher positiv, 16 der 25 Gemeinden konnten in den letzten 10 Jahren Zuwächse bei den
Nächtigungen verzeichnen, was sich sehr oft auf ein verbessertes Bettenangebot oder den Bau eines
Hotels zurückführen lässt. Touristisch
zeigt die Region ein sehr differenzier-
tes Bild. Wenn man die Übernach-
tungszahlen der Sommermonate 2012
und der Wintermonate 2012/2013
betrachtet, gibt es einerseits die abso-
lut touristisch geprägten Regionen wie
zB Untertauern mit 1.214 Übernach-
tungen je Einwohner oder Flachau mit
391 Übernachtungen je Einwohner.
Dem gegenüber steht beispielsweise
die Gemeinde Bischofshofen mit 3
Übernachtungen je Einwohner oder
die Gemeinde Scheffau mit weniger
als 5 Übernachtungen je Einwohner.
Für die ganze Region gilt, dass der
Wintertourismus den Hauptteil der
Übernachtung ausmacht, wobei Orte
wie Abtenau, Bischofshofen, Filzmoos
und Werfenweng auch im Sommer
annähernd gleich hohe Übernachtungszahlen verzeichnen können. Mehr Nächtigungen im Sommer
als im Winter haben die Orte Bischofshofen, Goldegg, Pfarrwerfen, Scheffau und Werfen. Extrem
wintertouristisch geprägt sind die Orte Flachau, Forstau und am stärksten Untertauern mit fast 90%
der Nächtigungen im Winter. In den letzten Jahren wurde von den Tourismusexperten in der Region
versucht, das Angebot in Richtung Ganzjahrestourismus zu erweitern. Die Region bietet mit dem
wunderbaren Almengebiet ideale Voraussetzungen für eine Verlängerung der Sommersaison in Rich-
tung Wandertourismus. Dies entspricht auch dem Trend, pro Jahr mehrere kürzere Urlaube zu ma-
chen, anstatt einmal für 1-2 Wochen zu verreisen. Die Aufenthaltsdauer sinkt in den letzten 10 Jah-
ren kontinuierlich und liegt momentan bei durchschnittlich 5 Tagen in der Region.
2.1.4. Wirtschaftliche Entwicklung in der Region
Die Wirtschaftsstruktur im Pongau wird von Klein- und Mittelbetrieben dominiert. Längerfristig er-
höhte sich die Anzahl der Arbeitsstätten seit dem Jahr 2001 bis 2011 in der Region um fast 3.000 von
4.649 Arbeitsstätten auf 7.646 Arbeitsstätten. Auch die Betriebsneugründung steigerte sich kontinu-
ierlich, im Jahr 2013 gab es im Bezirk St. Johann im Pg. 297 Neugründungen, im Bezirk Hallein 257
Neugründungen. Die Gründungsintensität liegt im Pongau verglichen mit den anderen Bezirken mit
3,7 je 1.000 Einwohner im hinteren Bereich, der Tennengau mit 4,3 nach der Stadt Salzburg an zwei-
ter Stelle.
Im Jahr 2011 gab es in der Region 6.966 Unternehmen mit insgesamt 37.193 Arbeitsplätzen. Von den
erwerbstätigen Pongauer/innen mussten im Jahr 2011 fast 21.000 Personen auspendeln, davon
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 10 von
7112.500 in andere Regionsgemeinden. Besonders viele Pendler gibt es natürlich in den kleinen Rand-
gemeinden wie z. B. Werfenweng mit 71% oder St. Veit und Hüttschlag mit fast 75%. Die Zahl der
unselbständig Beschäftigten stieg im Pongau von 2003 bis 2013 um 19,7% an (2003 28.931; 2013
34.618 unselbständig Beschäftigte), der Tennengau konnte einen Anstieg von 14,4% verzeichnen
(2003 15.678; 2013 17.928 unselbständig Beschäftigte).
2.1.5. Bildung und Erwerbstätigkeit
Derzeit gibt es in der Region 40.398 Er-
werbspersonen, davon sind 33.050 un-
selbständig Beschäftigte, 4.982 arbeiten
als Selbständige und 2.366 Personen
sind als Arbeitslos gemeldet, was einer
durchschnittlichen Erwerbsquote von
fast 78% entspricht. Die höchste Er-
werbsquote in der Region haben Pfarr-
werfen (81,8%), Untertauern und Wer-
fenweng (je 80,4%). Die niedrigste Er-
werbsquote gibt es in Mühlbach und
Forstau (je 74,3%) sowie in Schwarzach
(74,6%) und Bischofshofen (74,7%).
Zur Betrachtung der höchsten abgeschlossenen Ausbildung wurden alle Personen zwischen 15 und
64 Jahren herangezogen. Eine Lehre ist mit Abstand die Ausbildung in der Region, die vom Großteil
der Bevölkerung abgeschlossen wird (fast 42%). Leider ist mit 24% auch der Anteil in der Bevölkerung
sehr hoch, der keine abgeschlossene Berufsbildung vorweisen kann (höchster Abschluss Pflichtschu-
le). Mit Abstand die meisten Personen ohne abgeschlossene Berufsbildung weist dabei Schwarzach
mit 32% auf, die wenigsten Personen mit Pflichtschule als höchste Bildung hat Scheffau mit 16%. Die
Zahl der Absolventen der berufsbildenden mittleren Schulen ist mit 15% etwas höher als die Anzahl
der Maturanten in der Region (11%). Einen Hochschulabschluss können lediglich 8% der Menschen in
der Region vorweisen. Die höchste Akademikerdichte hat Goldegg mit 13%. Die wenigsten Akademi-
ker wohnen in Rußbach (3%).
2.1.6. Mobilität und Erreichbarkeit
Die Region verfügt mit der Tauernautobahn (A10), den wichtigen Bundesstraßen B 159, B 166 und B
167 im Straßenverkehr sowie im Schienenverkehr mit der Tauernbahn und Salzachbahn über wichti-
ge Transitverbindungen von europäischer Bedeutung. Neben anderen stark befahrenen Bundesstra-
ßen stellen besonders diese Routen für die Anrainer/innen durch die entstehende Lärmentwicklung,
Abgase und Staubelastung eine Beeinträchtigung der Lebens- und Umweltqualität dar. Neben dem
Pendler/innenverkehr dem Gütertransit spielen auch der touristische Transit- bzw. Regionalverkehr
und die Mobilität am Urlaubsort als Belastungsfaktor eine erhebliche Rolle.
Aufgrund dieser Belastungen wurden schon bisher eine Reihe von innovativen Verkehrsprojekten
entwickelt, die 25 Gemeinden der Region tragen wesentlich zur Attraktivierung des öffentlichen Ver-
kehrs („Pongau-Takt“, „Tennngau-Takt“) bei. Darüber hinaus ist der Pongau eine der Partnerregionen
des Österreichischen Modellvorhabens "Sanfte Mobilität - Autofreier Tourismus" bzw. des Interreg III
B-Projektes „Alps Mobility“.
Prognosen deuten jedoch auf eine massive Zunahme des Verkehrsaufkommens vor allem entlang der
Tauernautobahn hin. Detailprognosen gehen hier von einer Verdopplung des Gesamtverkehrs und
sogar von einer Verdreifachung des LKW-Verkehrs bis zum Jahr 2020 aus. Aus diesem massiven An-
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 11 von
71stieg des Transitverkehrsaufkommens resultieren für die Region jedenfalls negative Auswirkungen
auf Umwelt- und Lebensqualität. Allerdings liegen Maßnahmen, welche dieser Entwicklung beson-
ders deutlich entgegenwirken und auch Maßnahmen zur Verminderung negativer Auswirkungen
leider fast ausschließlich außerhalb des Einflussbereiches der Region. Übergeordnete Planungen se-
hen hier leider sogar zum Teil einen zusätzlichen Ausbau (Verkehrsverdichtung) auf der Transitachse
Tauernautobahn vor.
Im Zusammenhang mit dem zukünftig zu erwartenden massiven Anstieg des Ölpreises und unter
dem Einfluss des Klimawandels sind Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten sowohl der Wohnbe-
völkerung als auch der Tourist/innen zu erwarten. Diese Trends gilt es rechtzeitig zu berücksichtigen,
wobei im Pongau bereits heute erfolgreich Projekte für alternative Mobilitätsformen und Touris-
musangebote realisiert sind.
Bedingt durch die Arbeitsplatzsituation im Bezirk ergibt sich ein hoher Pendler/innen-Anteil. Rund die
Hälfte der Erwerbstätigen in der Region hat ihren Arbeitsplatz außerhalb der eigenen Wohngemein-
de und ebenfalls rund die Hälfte der Arbeitsplätze wird von Personen, die außerhalb der betreffen-
den Gemeinde wohnen, besetzt.
2.2. Reflexion und Erkenntnisse aus der Umsetzung von Leader in der Periode 2007 –
2013
Die Leader-Region der LAG Lebens.Wert.Pongau umfasste in der Periode 2007 bis 2013 22 der 25
Pongauer Gemeinden mit rund 69.000 Einwohner. Ausgenommen waren 3 Gemeinden, die sich der
Leader-Region Nationalpark Hohe Tauern anschlossen (Großarl, Hüttschlag, Bad Gastein).
Die lokale Entwicklungsstrategie für die letzte Leader Periode wurde in der Region und von der Regi-
on selber erstellt. Im Pongau haben in den Jahren 2006 und 2007 mehr als 450 (!) Pongauerinnen
und Pongauer – aus allen Bevölkerungsschichten – an der Erstellung dieser Strategie mitgewirkt.
Die aus dieser Entwicklungsstrategie resultie-
renden Projekte wurden von aktiven Bürge-
rinnen und Bürgern des Pongaus initiiert,
geplant und umgesetzt. Dabei stand diesen
InitiatorInnen (Vereine, Tourismusverbände,
Unternehmen, Gemeinden, Private) das „LAG-
Management“, angesiedelt im Regionalver-
band Pongau, beratend, begleitend und auch
steuernd zur Seite. Der Vorteil dieser Ver-
knüpfung ist zum einen eine sehr ressourcen-
schonende Arbeit, da kein eigenes „Leader-
Personal“ angestellt werden musste und auch
die Räumlichkeiten des Regionalverbandes samt allen Bürogeräten und –Materialien zur Verfügung
standen, zum anderen die Möglichkeit für Projektträger, ein Projekt, das nicht in die Leader-Strategie
passte, in einem anderen Förderprogramm unterzubringen. Somit wurde eine Art Multifond-
Strategie für die Projektträger gewährleistet. Ebenso positiv wurde die Vernetzung zwischen Leader
und dem Regionalverband im Sinne des Informationsflusses seitens der Bürgermeister gesehen. Es
gab eine zentrale Stelle im Pongau, an die man sich wenden konnte. Damit wurde der Regionalver-
band zum Kompetenzzentrum für die Region.
In der Leader-Förderperiode 2007 – 2013 wurde alleine im Pongau ein Investitionsvolumen von rund
31 Mio. Euro ausgelöst, also eine Wertschöpfung, die direkt dem Pongau zu Gute kommt. Insgesamt
wurden 58 Projekte eingereicht, vom Regionalverband vorbereitet, aufbereitet und begleitet, vom
Leader Begleitausschuss beraten und meistens einstimmig beschlossen. Dies bedeutete ein Fördervo-
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 12 von
71lumen von etwa 9,3 Mio. Euro für die Region. Die Eigenmittel der Gemeinden betrugen in der ver-
gangenen Periode im Durchschnitt € 0,30 pro Einwohner und Jahr.
Die Themenliste der eingereichten Projekte spannt einen Bogen von der regionalen (Volks-) Kultur
über den Tourismus bis hin zur Naturgefahrenbewältigung, der Erneuerbaren Energie und der Er-
reichbarkeit im ländlichen Raum.
Mit diesen mehr als 40 Projekten wurden im Pongau rund 25 Arbeitsplätze unmittelbar geschaffen.
Indirekt natürlich noch weitaus mehr, da die Investitionen, die durch Leader ausgelöst wurden, ihrer-
seits wieder Folgeinvestitionen und Arbeitsplätze auslösten bzw. schafften.
2.3. SWOT-Analyse der Region
SWOT Aktionsfeld 1 – Wertschöpfung
interne Faktoren – durch die Akteur/innen der Region beeinflussbar
STÄRKEN SCHWÄCHEN
• zentrale Lage mit guter Erreichbarkeit unter- • Image des „Arbeitsplatzes Tourismus“ nimmt
stützt die (Tourismus-) Wirtschaft weiter ab
• Starker Wintertourismus mit gut ausgebauter • Frauen mit Mobilitätserschwernissen haben
Infrastruktur weniger Zugang zu Arbeitsplätzen
• Tourismus sichert Arbeitsplätze • Region ist keine „Marke“
• Tourismus sichert Einnahmen in der Land- • Direktvermarkter und Bezugsquellen regiona-
und Forstwirtschaft ler Lebensmittel zu wenig bekannt
• vielfältige Wirtschaftsstruktur, familienge- • Standortmanagement für regionale Wirt-
führte KMU und ausgewogener Branchenmix schaft fehlt
• Regionale Lebensmittel und Kulinarik haben • Öffentlicher Verkehr als Zubringer für den
hohen Stellenwert im Tourismus und bei Be- Arbeitsmarkt allgemein in den Randgebieten
völkerung zu wenig ausgebaut
• Landwirtschaft ist starkes Standbein der regi- • mangelhafte Vernetzung in allen Bereichen
on, hohe Produktvielfalt und Qualität der • starke Abhängigkeit des Tourismus vom Win-
Produkte ter bzw. Schnee
• Gut ausgebaute Gesundheitsinfrastruktur
Externe Faktoren – Trends und Entwicklungen, die nur schwer beeinflussbar sind
CHANCEN RISIKEN
• Mobilitätslösungen fördern den Zugang zum • Witterungsanfällige Verkehrsinfrastruktur
Arbeitsmarkt, speziell für Frauen und Jugend (Lawinensperren)
• Mitarbeiter/innen-Qualifikation ausbaubar, • Klimawandel und schneearme Winter
vor allem für Menschen mit speziellem Bil- • weitere Veränderungen der Arbeitswelten
dungsbedarf (Menschen m. Behinderung, äl- und Arbeitsplatzformen
tere Arbeitnehmer/innen, Menschen m. Mig- • Internationaler Wettbewerb und Kosten-
rationshintergrund, Jugend) bzw. Investitionsdruck auf Wirtschaft, Tou-
• Kooperation stärken, Synergien nutzen, Sek- rismus und Nahrungsmittelproduktion
toren übergreifendes Netzwerk • Steuerliche Belastungen für Wirtschaft und
• Sektor übergreifende Verknüpfung von Pro- Arbeitnehmer/innen schwächen Konjunktur
dukten, Dienstleistungen und Lebensmitteln und Wirtschaftsentwicklung
• neue Dienstleistungen und Produkte, für die • Gering qualifizierte Arbeitskräfte aus dem
man keinen Schnee benötigt Ausland schwächen die Arbeitsmarktchance
für heimische Arbeitskräfte, Mangel an Fach-
arbeitskräften
• Abwanderung gut ausgebildeter junger Men-
schen aus der Region schwächt die Wirtschaft
und den Tourismus
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 13 von
71SWOT Aktionsfeld 2 – Natürliche Ressourcen und kulturelles Erbe
interne Faktoren – durch die Akteur/innen der Region beeinflussbar
STÄRKEN SCHWÄCHEN
• regionale Kultur mit starkem ehrenamtlichen • alte Berufe und Handwerk (Ausübung, Wis-
Engagement, hohes kreatives Kulturpotenzial sen darüber) gehen verloren
• reiches geschichtliches Erbe • Kulturprogramme zu wenig auf den Touris-
• hohe Vielfalt in der musealen Landschaft mit mus ausgerichtet
großem Bestand an Kulturschätzen • Schigeschichte der Wintersportregion zu we-
• hohes „Erlebnispotenzial“ der Natur- und nig dargestellt
Kulturlandschaft • keine echte Vernetzung der Kultureinrichtun-
• Montangeologische- und –historische Ge- gen, zu wenig museale Zusammenarbeit
schichte (frühgeschichtlicher und mittelalter- (Vermarktung, Kooperation, Bildungsarbeit,
licher Bergbau) Expertise, Kulturforschung)
• (Volks- & Blas-) Musik hat höchste Qualität • Balance zwischen Schützen und Nützen der
und Stellenwert Kulturlandschaft gelingt nicht immer
• Potenziale zur Nutzung erneuerbarer Ener- • Museen sind nicht auf Schwerpunkte ausge-
gien sind in Leader 07-13 erhoben worden richtet
• gut ausgebaute Fernwärmenetze, Biomasse, • Kulturarbeit und Naturschutz zu wenig am
Heizkraftwerke und Potential von Kombinati- Arbeitsmarkt ausgerichtet (zu wenige Jobs)
on Landwirtschaft & Energieproduktion: • schulische Kulturarbeit fehlt
Dachflächen, Kleinwasserkraft • Finanzierung der Kulturarbeit ist schwierig
• Natur- und sanfter Tourismus hat hohes • zu starke Konzentration der Landwirtschaft
Marktpotenzial auf fossile Brennstoffe (wenig Forschung &
• Naturraum bietet hohe Freizeit- und Wohn- Entwicklung)
qualität • Tourismus und Energie steht nicht im Ein-
klang
• Energiesparpotenzial nicht genutzt
• Einspeisetarife erneuerbare Energie zu nied-
rig, geringer Anreiz
Externe Faktoren – Trends und Entwicklungen, die nur schwer beeinflussbar sind
CHANCEN RISIKEN
• Erhöhung des Wissenstandes (i. S. v. Be- • weitere Verschlechterung des Verständnisses
wusstsein) über alte Traditionen und Brauch- für unterschiedliche (Volks-) Kulturen und
tum in der Bevölkerung Bräuche
• gesamtregionale Kulturstrategie (Tourismus, • keine strategische Ausrichtung der Region in
Vernetzung der Einrichtungen, Bevölkerung) Bezug auf erneuerbare Energien und Energie-
• Hochkultur in der Region sparen
• Flächen für die Nutzung erneuerbarer Ener- • Zersiedelung der örtlichen Strukturen erhöht
gien sind vorhanden den MIV-Bedarf
• Verschärfung des Konfliktpotenzials Raum-
ordnung, Naturschutz und Tourismusentwick-
lung
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 14 von
71SWOT Aktionsfeld 3 – Gemeinwohl - Strukturen und Funktionen
interne Faktoren – durch die Akteur/innen der Region beeinflussbar
STÄRKEN SCHWÄCHEN
• kleinregionale Struktur (Gemeinden) stärkt • Nahversorgung nicht mehr in allen Orten
das Zusammengehörigkeitsgefühl gegeben, viele sonstige örtliche Infrastruktu-
• Vielfalt durch unterschiedliche Kulturen ren (Post, etc.) wurden aufgelöst
• hochwertiger Schulstandort in der Region • Betreuungsangebote in manchen Orten zu
• technische Ausbildungsmöglichkeiten in der wenig ausgebaut
Region vorhanden • ÖV-Verbindungen am Abend
• Angebot an Betreuungseinrichtungen in vie- • Abwanderung der Jugendlichen aus der Regi-
len Orten gut ausgebaut on verschärft die negative demographische
• gute ÖV- und allgemeine Verkehrsanbindung Entwicklung
des Salzachtales (regionaler Zentralraum) an • Konzentration der Lehrberufe auf zu wenige
den Salzburger Zentralraum Branchen
• Lehre ist immer noch von Bedeutung • keine Vernetzung der Bildungsträger und –
• Jugendarbeit in fast allen Gemeinden Einrichtungen in der Region
• Gutes soziales Netzwerk und soziale Dienste • Bildung im regionalen Zentralraum kon-
zentriert, hohe Mobilitätserfordernisse für
Teilnehmende
• zu wenig integrative Initiativen und Ideen in
der Region
• Kaufkraft fließt aus der Region ab, Bevölke-
rung zum Teil „selber schuld“
• hoher Ausländer/innen-Anteil stärkt das
Misstrauen gegenüber anderen Kulturen
• zu wenig Wissen über soziale und interkultu-
relle Angebote bzw. Dienste
• Jugend zu wenig in regionale Prozesse einge-
bunden
• Lebenserhaltungs- und Wohnkosten sehr
hoch
Externe Faktoren – Trends und Entwicklungen, die nur schwer beeinflussbar sind
CHANCEN RISIKEN
• durch verbesserte Mobilitätsangebote kann • weitere Verschlechterung der Nahversor-
ein besserer Zugang zum Arbeitsmarkt gebo- gungssituation in Gemeinden
ten werden • mangelndes Angebot Bus & Bahn außerhalb
• Bildungsabwandernde Jugend kann zur Rück- des regionalen Zentralraumes zwingt zur Nut-
kehr in die Region bewegt werden zung des Autos
• Gesundheitsberufe bieten Ausbildungs- und • Mobilität (Auto) wird teurer, viele können
Berufschancen sich das Pendeln nicht mehr leisten
• Bürger/innenbeteiligung als Chance • Image des Lehrberufes sinkt
• Vernetzung und mehr Kooperation • Verschärfung des demographischen Wandels
durch weitere Abwanderung
• mangelnde Finanzierung für soziale und in-
tegrative Projekte
• Verstärkung des Kaufkraftabflusses in Rich-
tung Salzburg
• weitere Verteuerung von Wohnen und Leben
sowie gestiegene Anforderungen an die Mo-
bilität verstärken den Trend zu Abwanderung
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 15 von
712.4. Darstellung der lokalen Entwicklungsbedarfe
Auch die Leader-Region Lebens.Wert.Pongau unterliegt den globalen Megatrends und wird deren
Auswirkungen in der Zukunft noch stärker spüren. Mit der lokalen Entwicklungsstrategie soll zumin-
dest auf regionaler Ebene ein gewisser „Gegentrend“ erzeugt oder das Wissen um den Umgang mit
deren Auswirkungen auf die Region erhöht werden. Der Zukunftsforscher Matthias Horx bezeichnet
Megatrends als die großräumigen, langfristigen Treiber des Wandels. Dabei handelt es sich um Ent-
wicklungen und Prozesse, die die Gesellschaft generell zu verändern im Stande sind. Oder diese für
die Zukunft wesentlich prägen. John Naisbitt (1982) prägte den Begriff des „Megatrends“, das von
Horx initiierte Zukunftsinstitut mit einem Sitz in Wien sieht die globalen Megatrends als eine der
wesentlichen Herausforderungen für Regionen1:
Globalisierung Eine Klassifizierung von „Erst- bis Drittländern“ existiert nicht mehr. Regionen
im asiatischen Raum haben Wirtschaftsentwicklungsphasen übersprungen und
sind zu Wirtschaftsgiganten herangewachsen. In früheren Schwellenländern
sind neue Käuferschichten in Milliardenhöhe entstanden. Es verliert die ei-
gentliche Nationalität zunehmend an Bedeutung während die Region an Be-
deutung gewinnt.
Entwicklungsbedarf Auch die Region unterliegt dem Trend der Globalisierung, vor allem im Bereich
der Region: der regionalen Identität, die zwar für die einheimische Bevölkerung (noch)
wichtig ist, jedoch für Menschen mit Migrationshintergrund in der Region we-
nig Bedeutung hat. Der Zuzug ist einerseits von Bedeutung, um die Wirt-
schaftskraft der Region zu erhalten – Stichwort Arbeitsplätze – birgt aber auch
die Gefahr des Verdrängungswettbewerbs am Arbeitsmarkt. Hierfür wird es
notwendig sein, dass die Wirtschaft in der Region noch enger zusammen ar-
beitet, Netzwerke bildet, dadurch entstehende Synergien besser nutzt und die
Qualifizierung für regionale Arbeitsplätze erhöht.
In einer sich zunehmend globalisierenden Welt ist es daher von größter Be-
deutung, regionale Kultur und Volkskultur, tradiertes regionales Wissen, regi-
onale Identität, Gemeinschaftssinn und die kleinstrukturierte Wirtschaft der
Region durch intensive Vernetzung, Entwicklung neuer Modelle und durch
lebenslanges Lernen zu stärken. Das miteinander Gestalten, Leben und Arbei-
ten soll dadurch eine Art „Gegentrend“ auslösen können.
Neue regionale Angebote müssen entwickelt, bestehende ergänzt und beide
in der Region positioniert werden. Menschen mit Migrationshintergrund brau-
chen beim „Zurechtfinden“ in ihrem neuen Lebensumfeld unterstützende
Begleitung und Hilfestellung..
Feminisierung Der Wandel der bisher männerdominierten Welt fand und findet statt. „Die
Volkswirtschaft könne es sich nicht leisten, Frauen an den Herd zurück zu schi-
cken“ sprach Matthias Horx in einem Interview mit der Zeitschrift GEWINN
extra2. In den letzten Jahrzehnten hat sich eine weibliche Bildungsrevolution
entwickelt, durch die zunehmende Auflösung der klassischen Geschlechterrol-
len finden große Verwandlungsprozesse statt, vor allem im Berufsleben: Frau-
en wollen Führungspositionen übernehmen, Männer fordern ihr Recht auf Zeit
mit der Familie ein. Die klassische Familie wird durch neue Formen des Zu-
sammenlebens abgelöst.
1
vgl.: http://www.zukunftsinstitut.at/megatrends, abgerufen am 05.10.2014, 13:20 Uhr
2
GEWINN extra, Ausgabe Mai 2013, Seite 164
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 16 von
71Entwicklungsbedarf Die regionale Wirtschaft benötigt Frauen, über den Tourismus und die Land-
der Region: wirtschaft hinaus. Allerdings müssen der Zugang zum Arbeitsplatz und die
Rahmenbedingungen für Frauen im ländlichen Raum an die Bedürfnisse, die
anders sind als jene der Männer, angepasst werden. Bildungsmöglichkeiten
und –chancen, der Zugang zur Bildung und eine stärkere Integration von Frau-
en mit Migrationshintergrund sind wesentliche Erfolgsfaktoren, um eine posi-
tive Entwicklung zu ermöglichen. Frauen sind darüber hinaus eine wesentliche
Stütze der wichtigen Gesundheits- und Sozialstruktur der Region, dieses Po-
tenzial kann noch verstärkt und ausgebaut werden, gerade in Hinblick auf die
Stärkung der Gemeinwohlstrukturen in der Region und seiner Gemeinden.
Frauen müssen von daher auch noch stärker als bisher in die politischen Ent-
scheidungsprozesse auf regionaler und lokaler Ebene eingebunden werden,
vor allem aber die Jugend.
Mobilität Zukünftig wird unser Leben noch wesentlich stärker von unseren Anforderun-
gen an die Mobilität geprägt sein: von ihr ist abhängig, welche Arbeitsstelle wir
annehmen, wo wir wohnen werden und ob wir unsere Lebensqualität noch
weiter steigern können. Horx sieht in der „Diskussion um Ressourcenknapp-
heit und der Forderung nach Nachhaltigkeit“ eine wesentliche Veränderung
der Auffassung von Mobilität und unseres Mobilitätsverhaltens.
Entwicklungsbedarf Die Leader-Region hat diesem Trend Rechnung zu tragen, in dem neue Model-
der Region: le für einen leichteren Zugang zu Mobilität entwickelt werden. Der Zugang
zum Arbeitsmarkt durch Mobilitätslösungen wird in einer Zeit, in der sich im-
mer weniger Menschen das Autofahren leisten können oder einfach gar keines
besitzen, zum Standortvorteil für die Wirtschaft. Der Tourismus profitiert von
neuen Mobilitätslösungen aus wirtschaftlicher Sicht, wie erfolgreiche Modelle
im Rahmen der „Sanften Mobilität“ bereits beweisen. Urlaub, ohne das eigene
Auto nutzen zu müssen, wird zunehmend nachgefragt.
Im Bereich der Bildung und des lebenslangen Lernens ermöglicht ein gut aus-
gebautes ÖV-Netz am Abend für viele Bürger/innen überhaupt erst den Zu-
gang zu Bildung. Hier muss auch die Frage gestellt werden, ob die Bildungsin-
teressierten tatsächlich immer zur Bildung kommen müssen bzw. warum nicht
die Bildung zu den Bildungsinteressierten kommen kann.
New Work Die neue Welt des Arbeitens macht die bisher traditionellen Arbeitswelten
überflüssig. Die Arbeit der Zukunft ist netzwerkbasiert und in hohem Maß von
der Mobilität abhängig. Daher verändern sich Arbeitsräume und –umwelten
sowie betriebliche Strukturen: die Grenzen zwischen Berufs- und Privatleben
verschwimmen immer mehr, wenn sie nicht bereits verschwunden sind. Mit
dieser Überschneidung wächst jedoch auch der Druck auf die Service-, Infor-
mations- und Kreativarbeiter.
Entwicklungsbedarf Die Wirtschaft, der Tourismus und die Landwirtschaft müssen sich auf diese
der Region: neuen Arbeitswelten einstellen können, brauchen aber dafür neue Modelle
und Lösungsansätze. Diese gelingen durch engere Vernetzung, Kooperation
und Darstellung einer ländlichen Region als lebenswerte Region mit vielen
Chancen und Möglichkeiten für den/die Einzelne/n.
Neues Lernen Im Zeitalter der Bildung, stark dominiert auch von der Feminisierung, explo-
diert das Wissen förmlich, der Zugang zu Wissen ist durch die Konnektivität
der digitalen Medien geprägt. In der globalen Kreativ-Ökonomie ist die Bildung
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 17 von
71der neue Schlüssel zum Erfolg und steht damit im engen Zusammenhang mit
dem Trend „Individualisierung“
Entwicklungsbedarf Der formale und non-formale Bildungsbereich muss in der Region durch neue
der Region: innovative Angebote, Produkte und durch Vernetzung bzw. Kooperation der
Bildungsakteure/innen gestärkt werden. Dabei muss auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse, Kulturen und Vorlieben des/der Einzelnen Rücksicht genommen
werden. Bildung erhöht die Chancen am Arbeitsmarkt, gerade für Jugendliche,
denen das noch nicht bewusst ist.
Gesundheit Gesundheit bedeutet heute nicht mehr nur die Abwesenheit von Krankheit.
Der Begriff Gesundheit (auch im Sinne der Erhaltung der Arbeitskraft) wird
immer stärker zum Marketinginstrument und dringt in all unsere Lebens- und
Konsumbereiche ein. Dadurch wurde die „Gesundheitsindustrie“ zu einem
wesentlichen Eckpfeiler der globalen Wirtschaft.
Entwicklungsbedarf Die Region ist mit der relativ gut ausgebauten Gesundheitsinfrastruktur „fit“
der Region: für diesen Trend. Das Potenzial für den Tourismus, für Bildung und für die
Schaffung neuer Arbeitsplätze, speziell für Frauen oder auch Menschen mit
Migrationshintergrund ist als hoch einzuschätzen und muss noch weiter ent-
wickelt werden.
Neo-Ökologie Effizienz, Nachhaltigkeit und Bio sind die drei Säulen der Neo-Ökologie, die für
sich gesehen mehr als nur Naturschutz sind und zum Mainstream werden.
Entwicklungsbedarf Der Aufbau und die Vermarktung von regional produzierten Lebensmitteln ist
der Region: eine regionale Antwort auf diesen Trend. Dabei können durch einen Marken-
Aufbau neue Einkommensmöglichkeiten für die Landwirtschaft, den Tourismus
und die Wirtschaft allgemein generiert werden. Nachhaltig regional produzier-
te Lebensmittel sind eine Möglichkeit der Diversifizierung im Rahmen der
Stärkung der Nahversorgung. Eine wichtige regionale Entwicklung in diesem
Sinne ist die Forcierung und Förderung erneuerbarer und alternativer Energie-
träger, die Steigerung der Energieeffizienz sowie die Bewusstseinsbildung und
Sensibilisierung der regionalen Bevölkerung. Die hohe Qualität des Natur- und
Kulturraumes der Region ist wichtiges Kapital für eine lebenswerte Tourismus-
region. Der neo-ökologische Trend kann zu einem wichtigen Standbein der
Nahversorgung werden, wenn es gelingt, das Bewusstsein für regionale Pro-
dukte, Lebensmittelqualität und Nahversorgung zu stärken
Silver Society Die durchschnittliche Lebenserwartung der Menschen ist gestiegen und steigt
weiter. Wir werden anders älter und das Älter werden ist laut Horx vom
„Downaging“ geprägt: der Ausstieg aus den tradierten Senioren-Rollen mit der
klassischen Sichtweise des Ruhestandes. Ältere Menschen übernehmen eh-
renamtliche Aufgaben für die Gesellschaft, beginnen mit 65 noch ein Studium
oder verbleiben im Sinne des productive agings ganz einfach im Erwerbsleben.
Entwicklungsbedarf Der demographische Wandel wird sich noch stärker als bisher auf die regiona-
der Region: len Lebens- und Arbeitswelten auswirken, die Entwicklung hin zur Wissensge-
sellschaft stellt wachsende Anforderungen an die Innovationskraft und der
Druck hin zu einen effizienteren und nachhaltigeren Umgang mit den immer
knapper werdenden Ressourcen. Das hohe Potenzial der Zielgruppe „65+“
liegt in der Region noch brach, speziell zur Stärkung der für das Gemeinwohl
wichtigen Strukturen und Einrichtungen. Das gesellschaftliche Zusammenle-
ben und der Zusammenhalt von Menschen unterschiedlichen Alters, Ge-
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 18 von
71schlechts und unterschiedlicher Herkunft muss in der Region gefördert und
unterstützt werden.
Urbanisierung Die zunehmende Urbanisierung ist eine der größten Herausforderungen für
den ländlichen Raum und seine Regionen/Gemeinden. War früher die Flucht
aufs Land bis zum Ende der 1990er Jahre einer der großen Trends, so kehren
die Nachkommen der Stadtflüchtigen offensichtlich wieder zurück. Die Wis-
sensgesellschaft führt zur weiteren Verdichtung von Ballungszentren.
Entwicklungsbedarf Die Ausdünnung des ländlichen Raums durch Abwanderung des „Humankapi-
der Region: tals“ ist eine große Gefahr für die Region. In der Region müssen Modelle und
Initiativen entwickelt werden, die die Rückkehr in die Region bzw. den ländli-
chen Raum nicht nur unterstützen, sondern überhaupt erst möglich machen.
Regionale Identität, Bildungsmöglichkeiten und –chancen, Verhaltensände-
rung und Erhaltung und Ausbau der regionalen Kultur und des tradierten Wis-
sens sind mögliche Betätigungsfelder, um diesem Trend entgegen zu wirken.
Die Versorgungqualität in den Gemeinden muss erhalten werden, dazu bedarf
es aber gemeinsamer Anstrengungen im Sinne von Vernetzung und Koopera-
tion und neuartiger Produkte bzw. Modelle, die sich an den Bedürfnissen der
Menschen und nicht am Markt orientieren.
3. Lokale Entwicklungsstrategie
3.1. Aktionsfeld 1: Wertschöpfung
Im Rahmen des Entwicklungsprozesses zur Erstellung der lokalen Entwicklungsstrategie wurden fol-
gende Handlungsfelder (Aktionsfeldthemen) erarbeitet und ausgewählt:
1.) Lebensgrundlage Land
2.) Stärkung der Tourismuswirtschaft
3.) Wirtschaft mit Zukunft
3.1.1. Handlungsfeld 1.1.: Lebensgrundlage Land
Ausgangslage
Die regionale Landwirtschaft ist ein wichtiges Standbein der Regionalwirtschaft und Basis für die Le-
bensqualität in der Region, sie trägt wesentlich zur Erhaltung der Natur- und Kulturlandschaft der
Leader-Region bei. Eine gut funktionierende Landwirtschaft ist immanent für die Entwicklung einer
ländlich geprägten Gebirgsregion. Der Beitrag der Landwirtschaft soll sich jedoch nicht nur auf die
Pflege und Freihaltung der Landschaft im Sinne eines Tourismusangebotes beschränken, sondern
darüber hinaus die Potenziale fördern. Die Almenlandschaft ist einzigartig und wird sowohl von Ein-
heimischen als auch von Gästen geschätzt. Schon alleine dadurch trägt die Landwirtschaft wesentlich
zur touristischen Wertschöpfung im Sommer- und Wintertourismus bei.
Die Landschaft bringt zahlreiche Produkte hervor, deren Wert bisher noch nicht bekannt ist. Das
„Genießbar machen“ der Region schafft Bewusstsein für regionale Kreisläufe bei Einheimischen und
BesucherInnen. Regionale Lebensmittel und Produkte helfen, Arbeitsplätze und Wertschöpfung zu
halten und leisten auch einen Beitrag zur ökologischen Entwicklung.
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 19 von
71Ziele
Ziel des Handlungsfeldes ist, für die Landwirtschaft neue Einkommensmöglichkeiten zu entwickeln
und bestehende Einkommensmöglichkeiten zu stärken. Durch die Förderung von Diversifizierungsak-
tivitäten wird die Wettbewerbsfähigkeit unserer Landwirtinnen und Landwirte gesteigert, wobei ein
Schwerpunkt in der kooperativen Umsetzung und Vernetzung liegt. Durch den Zugewinn an Wissen
und Erfahrung, besonders im Bereich der „jungen Landwirtschaft“ wird das Einsteigen in das land-
wirtschaftliche Berufsleben erleichtert und die zukünftige Wirtschaftsfähigkeit gesichert.
Strategien
• Stärkung der Landwirtschaft bedeutet, neue Einkommensmöglichkeiten zu entwickeln, den Bau-
ernhof als attraktiven Arbeitsplatz zu positionieren und ein hohes Bewusstsein für regionale
landwirtschaftliche Kreisläufe zu schaffen.
• Durch die Verknüpfung von Lebensmittel- und Landwirtschaft, Gastronomie und Tourismus wird
die regionale Nahrungsmittelproduktion gestärkt und neue Angebote für die Tourismuswirt-
schaft geschaffen
• Wissensgewinn in der Landwirtschaft führt zu einer erhöhten Wertschöpfung und zur Steigerung
der Kooperationsfreudigkeit der Landwirtschaft
Angestrebte Resultate und Erfolgsindikatoren
Resultate am Ende der Periode Erfolgsindikatoren
Für die Landwirtschaft sind neue Einkommens-
Anzahl neuer Beschäftigungsmodelle in der
möglichkeiten entwickelt und sie ist als attrakti-
Landwirtschaft
ver Arbeitsplatz etabliert
Anzahl neuer Angebote und Produkte
Die Landwirtschaft hat neue Angebote und Pro-
Menge vermarkteter Rohware (kg)
dukte für die Bevölkerung und den Tourismus
Anzahl neuer Verkaufsstellen und –projekte für
geschaffen und offensiv vermarktet.
regionale Produkte
Durch Kooperation und Wissensgewinn ist die Anzahl TeilnehmerInnen in Fortbildungsveran-
Wertschöpfung der Landwirtschaft gesteigert staltungen
Aktionsplan im Handlungsfeld
Aktivitäten (Projektebene) mögliche Projektträger/innen
Einkommen sichern: Aufbau von Einkommensmöglichkeiten in der Landwirtschaftliche Betriebe
Kinder- oder Altenbetreuung am Bauernhof
Photovoltaik-Anlagen auf landwirtschaftlich genutzten Gebäuden Landwirtschaftliche Betriebe,
– Nutzung bestehender Dachflächen zur Energieproduktion Energieberatung, KMU
Arbeitsplatz Bauernhof: Unterstützung von Quereinsteiger/innen, Landwirt/innen, LFI
Wiedereinsteiger/innen und Aufsteiger/innen
Bezirks-Agrarkreise für Landjugend (Fachreferent/innen zum Aus- Landjugend Pongau
tausch bzw. für Weiterbildung)
In-Wert-setzen der Wichtigkeit der Landwirtschaft und ihrer Pro- Gemeinden, landwirtschaftli-
dukte in der Bevölkerung che Betriebe
Kooperations-Plattform landwirtschaftliche Direktvermarktung - Genussregion Pongauer Wild,
Vernetzung, Kooperation und gemeinsame Vermarktung (Ver- Verein der Salzburger Direkt-
marktungsgenossenschaft), Erfahrungsaustausch, Börse, Öffent- vermarkter, AMS Bischofsh-
Lokale Entwicklungsstrategie 2014-2020 l LAG Lebens.Wert.Pongau Seite 20 von
71Sie können auch lesen