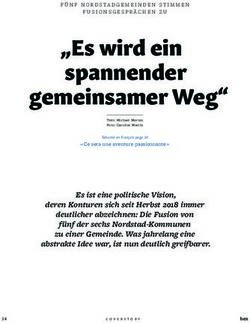Mediävistische Perspektiven im 21. Jahrhundert - Herausgegeben von Andrea Schindler - Uni Graz ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schindler (Hg.) . Mediävistische Perspektiven im 21. Jahrhundert
Mediävistische Perspektiven
im 21. Jahrhundert
Herausgegeben von
Andrea SchindlerSchindler_FS_Bennewitz_Titelei.indd 1 15.10.21 11:38
Schindler_FS_Bennewitz_Titelei.indd 2 15.10.21 11:38
Mediävistische Perspektiven
im 21. Jahrhundert
Festschrift für Ingrid Bennewitz zum 65. Geburtstag
Herausgegeben von Andrea Schindler
unter Mitarbeit von Detlef Goller und Sabrina Hufnagel
REICHERT VERLAG WIESBADEN 2021
Schindler_FS_Bennewitz_Titelei.indd 3 15.10.21 11:38Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über
http://dnb.dnb.de abrufbar.
Gedruckt auf säurefreiem Papier
(alterungsbeständig – pH7, neutral)
© 2021 Dr. Ludwig Reichert Verlag Wiesbaden
www.reichert-verlag.de
ISBN: 978-3-7520-0598-1 (Print)
eISBN: 978-3-7520-0081-8 (E-Book)
https://doi.org/10.29091/9783752000818
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes
ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbe-
sondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Printed in Germany
Schindler_FS_Bennewitz_Titelei.indd 4 15.10.21 11:38Inhalt Vergangenheit – Gegenwart – Zukunft ........................................................................................... IX JUDITH LANGE und MARTIN SCHUBERT Eva im Langen Ton Regenbogens .................................................................................................... 1 CORA DIETL Einfach nur Namen? Oswalds gesungener Heiligenkalender Kl 28 ........................................... 17 CHRISTOPH HUBER Rezeption und Imagination. Wie Frauenlob im Marienleich das Hohelied und dessen Kommentierung poetisch umsetzt .............................................................................. 27 ALEXANDER SAGER Anerkenntnis der Meisterin. Überlegungen zu einer Nebenfigur im Eneasroman Heinrichs von Veldeke ............................................................................................. 43 SARA S. POOR ‘Fake News,’ the ‘Romance’ of Charlemagne, and the Troubled Queen in Morant und Galie ................................................................................................................................ 55 FREIMUT LÖSER Meister Eckhart predigt (zisterziensischen) Frauen – und anderen. Überlegungen zu seiner Kölner Predigt 22 ..................................................................................... 67 FLORENT GABAUDE Weiberlist und starke Frauen in Hans Sachs’ illustrierter Exempeldichtung ............................ 87 REGINA TOEPFER Von Heroinen und ‚Hausfrawen‘. Genderspezifische Normenvermittlung in Johannes Sprengs deutscher Metamorphosen-Übersetzung (1564) ............................................ 99 MICHAEL STOLZ Die Bidirektionalität transkriptiver Logik. Anmerkungen zu ‚Original‘ und ‚Kopie‘ des Rappoltsteiner Parzifal ............................................. 113 MATHIAS HERWEG Zwischen zwei Medien, zwischen zwei Kulturen. Das Hildebrandslied und die volkssprachige Literatur des frühen Mittelalters ...................................................................... 123 GABY HERCHERT Der große Sultan Saladin: edler Ritter, mächtiger Herrscher und Freund der Religion(en)? ....... 145 CLAUDIA BRINKER-VON DER HEYDE Schaurig schön. Das Mittelalter des 18. Jahrhunderts ................................................................... 155
VI Mediävistische Perspektiven im 21. Jahrhundert WINFRIED FREY Juden, Hexen, Teufel. Der ‚teuflische Gestank‘ als Kennzeichen für ‚Außenseiter‘ über Jahrhunderte ........................................................................................................ 171 ARTHUR GROOS “Weia! Waga! Woge, du Welle!” Das Rheingold as Germanic-Musical Cosmogony .................. 193 SIEGRID SCHMIDT Das Mittelalter und die Salzburger Festspiele ................................................................................. 205 BERND BASTERT „Die Reimerei, die sich in seinem Kopf zusammengesetzt hatte“. Walther von der Vogelweide im historischen Roman nach 1945 ............................................... 223 MICHAEL DALLAPIAZZA Wie die Monate das Jahr. Anita Pichlers Oswald-Erzählung nach dem Wolkenstein-Boom ......... 241 ALEXANDER HONOLD Texturen des Abenteuers bei Peter Handke ................................................................................... 247 CLAUDIA HÄNDL Die Figur der Brünhild im deutschsprachigen Theater der Gegenwart ..................................... 259 DANIELE GALLINDO GONÇALVES Von Rittern und Drachentötern. Mittelalterrezeption in der brasilianischen Literatura de Cordel ...................................................... 275 ANDREA SCHINDLER Wie klingt das Mittelalter? Ritter, Könige und Narren in Hörmedien ....................................... 283 SARAH BÖHLAU, JANINA DILLIG, MICHAELA PÖLZL Ratgeberinnen, Hexen, Mörder, Zeitreisende. Figurationen von Mediävistinnen und Mediävisten in der Populärkultur ................................. 307 CHRISTOPH HOUSWITSCHKA Ein Arthur seiner Zeit. Herrschaft und Populismus in King Arthur. Legend of the Sword (2017) ........................................ 333 ANN MARIE RASMUSSEN and JASON QU Re-Conceptualizing Transgressive Love in Gottfried’s Tristan und Isolde for Online University Teaching ......................................................................................................... 343 HORST BRUNNER Zur Geschichte der Edition mittelalterlicher deutscher Texte. Ulrich Müller als Herausgeber ........................................................................................................... 355
Inhalt VII KAI LORENZ Frau Philologia zieht um. Vom Turm aus Elfenbein ins digitale Babylon? ............................... 367 ALBRECHT CLASSEN Zeitlose Lebenslehren aus dem Spätmittelalter. Die Fabeln des Ulrich Bonerius und ihre Relevanz für die Gegenwart ............................................................................................... 381 CHRISTA HORN und DETLEF GOLLER Relevanz und Zukunft mittelalterlicher Literatur. Bamberger altgermanistische Schul-Wege ....................................................................................... 401 WERNFRIED HOFMEISTER und ANDREA HOFMEISTER-WINTER Mehrwertlehre. Grazer Erträge des Joint Master’s Degree-Studiums „Deutsche Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ mit der Universität Bamberg ................ 411 EVELYN MEYER „Warum Mittelalter? Das interessiert mich nicht wirklich!“ Kreative Projekte im mediävistischen Literaturseminar im Ausland .......................................... 429 STEFANIE STRICKER und DETLEF GOLLER Cophinum est … chorb. Überlegungen zum Einsatz mittelalterlicher Schriftlichkeit im Deutschunterricht am Beispiel des alphabetischen Glossars der Handschrift Graz, Universitätsbibliothek 149 ......................................................................... 447 TILMAN SPRECKELSEN Ein stilles Lächeln für den Helden. Das Nibelungenlied in Ludwig Tiecks Phantasus .................. 465
WERNFRIED HOFMEISTER UND ANDREA HOFMEISTER-WINTER
Mehrwertlehre
Grazer Erträge des Joint Master’s Degree-Studiums „Deutsche Philologie des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ mit der Universität Bamberg
Vorbemerkung
In diesem Aufsatz, der gleichermaßen fachgeschichtlich wie lehrreflexiv ausgerichtet ist, wird
das Beitragsduo1 nur aus Grazer Sicht über das 2013 begonnene und 2022 planmäßig auslau-
fende Kooperationsstudium mit dem hauptinitiativen Bamberger Lehrstuhl von Ingrid Benne-
witz Bilanz ziehen. Zwar werden sich dabei indirekt auch Erträge auf Bamberger Seite mit abbil-
den, doch möge das nicht als ein Schmücken mit fremden Federn verstanden werden: Es blei-
be Bamberg vorbehalten, zu gegebener Zeit eine publizistische Gesamtbilanz dieser länder-
übergreifenden ‚Mehrwertlehre‘ zu ziehen.
Wie alles begann
Für Graz begann alles mit einem unerwarteten Anruf im Sommer 2012: Das Telefonat mit Ingrid
Bennewitz galt dem dauervakanten2, doch unverdrossen aktiven mediävistischen Fachbereich, um
ihn zum Einstieg in ein gemeinsames Masterstudium einzuladen.3 Am anderen Ende der Leitung
waren die ‚Hofmeisters‘ soeben damit beschäftigt, nach mehrjähriger Vorarbeit ihr Netzwerk der
„Steirischen Literaturpfade des Mittelalters“4 an acht Schauplätzen zu errichten und feierlich zu er-
öffnen;5 damit sicherten sie pünktlich einem zeitgleich genehmigten schulorientierten Begleitprojekt6
1 Gemäß der (nicht allzu strengen) Rollenaufteilung in diesem Beitrag fällt es Wernfried Hofmeister als dem Grazer Studien-
koordinator und Curriculakommissions-Vorsitzenden der gegenständlichen Lehrkooperation zu, Allgemeineres zu deren
Genese, Zielsetzungen und Begleitaktivitäten festzuhalten. Bei den Ausführungen zu den einzelnen Lehrprojekten führt
überall dort Andrea Hofmeister die Feder, wo sie allein oder in Kooperation für die jeweilige Lehre verantwortlich war.
2 Die Vakanz ab dem Herbst 2005 (nach der Emeritierung von Anton Schwob) endete fünfzehn Jahre später durch eine
erfolgreiche Nach- resp. Neubesetzung: Die Erreichung genau dieses Ziels hatte zu den subvokalen Motivationen für
die Aufnahme des JMD-Studiums gezählt und darf daher als einer seiner wichtigsten ‚Nebenerträge‘ verbucht werden.
3 Wie sich der Angerufene, von Berufs wegen zu Skepsis Neigende erinnert, wurde ihm auf Nachfrage zu seiner
Freude versichert, für das konkrete Kooperationsanliegen der in Österreich ideale und daher ‚exklusiv‘ angefragte
Partner für eine wechselseitige Stärkung der mediävistischen Fachbereiche zu sein.
4 Aktuelles zu diesem Projekt, das an den Schauplätzen 2022 auslaufen, aber zumindest digital weiter präsent blei-
ben soll, findet sich unter https://literaturpfade.uni-graz.at/ [letztes Zugriffsdatum auf diesen und alle weiteren
Links in diesem Beitrag: 9.9.2021]. Zur wissenschaftlichen Aufbereitung des Literaturpfadeprojekts vgl. Wernfried
Hofmeister: Altdeutsche Texte im öffentlichen Raum. Projekt- und Forschungsbericht über das Netzwerk
„Steirische Literaturpfade des Mittelalters“. In: ZfdA 143 (2014), S. 467–483.
5 Der erste Pfad konnte am 30. Juli 2012 in Neuberg an der Mürz (unter Anwesenheit des damaligen Vizerektors für
Lehre, des heutigen Rektors der Universität Graz, Martin Polaschek) eröffnet werden, der achte schließlich am 26.
Oktober 2012 in Wildon.
6 Als Fördergeber dafür trat das Österreichische Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung auf.
Die Verwaltung des Förderungsprogramms „Sparkling Science“, das von 2007–2019 aktiv war (siehe unter
https://www.sparklingscience.at/de/info/sparkling-science-2007-2019.html), erfolgte gemäß internationalen, hoch
kompetitiven Standards durch die „Österreichische Agentur für Bildung und Internationalisierung“. Über diese schulori-
entierte Förderschiene wurden im Laufe der Jahre drei (!) aufeinander aufbauende, aber jeweils gesondert einzureichende,412 Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter
die notwendige faktische Basis. Viel Zeit zum Nachdenken blieb also in dieser (im doppelten Wort-
sinn) heißen Phase nicht – und brauchte es auch nicht, um die Win-Win-Situation durch ein erstmals
einzurichtendes, zumal im gesamten deutschen Sprachraum singuläres (!) Joint Master’s Degree-Stu-
dium zu erkennen. Nach intensiven technischen Vorberatungen, in die in den Folgemonaten an der
Seite von Ingrid Bennewitz7 Martin Fischer und Detlef Goller eingebunden waren, konnte schon
Mitte Juni 2013 von beiden Universitäten ein Kooperationsvertrag für das gemeinsame Master-
studium „Deutsche Philologie des Mittelalters und der Frühen Neuzeit“ besiegelt werden. Was damit
für die Grazer Mediävistik im Detail strategisch verknüpft war, sei im nächsten Kapitel ausgeführt.
Worauf es (im Hintergrund) ankam
Klar, das oberste gemeinsame Ziel stellte die Etablierung eines philologisch fein geschliffenen,
international anerkannten Masterstudiengangs dar, um damit die Karrieren der künftigen Stu-
dierenden fachspezifisch zu fördern. Zugleich diente das JMD-Studium, wie es ab jetzt kurz
genannt wird, der sichtbaren, produktiven Vertiefung einer kollegialen Beziehung, die zwischen
zwei Mediävistiken dank ihrer homogenen Interessen, Schwerpunkte und methodischen Aus-
richtungen über viele Jahre herangereift war.8
Der Grazer Mediävistik bot die ehrenvolle Anfrage des Bamberger Lehrstuhls darüber hinaus die
willkommene Gelegenheit, von den obersten Stellen der Universität Graz eine Stärkung ihrer eigenen
Fachressourcen zu erbitten: Während sich nämlich der Bamberger Lehrstuhl traditionell auch auf das
fächerübergreifende Studienangebot des Zentrums für Mittelalterstudien (ZEMAS) stützen konnte,
verfügt(e) Graz über nichts Äquivalentes, das es ermöglicht hätte, allein auf Basis des bereits vorhan-
denen, breit aufgestellten altgermanistischen Masterregelstudiums für künftige JMD-Studierende ein
attraktiv intensiviertes Joint Mediävistikstudium zu konfigurieren. Daher lautete die unwidersprech-
liche, in manchen Ohren vielleicht schon listig wirkende Überlegung des Grazer Studienkoordinators
in spe, dass es eben eine entsprechende Profilierung des lokalen Studienangebots brauche, um dem
zu begutachtende und zu evaluierende Phasen des Projekts „Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittel-
alters“ genehmigt: „Neue Konzepte und Materialien zur Vermittlung älterer deutscher Texte“ (2012–2015), „Die Vermitt-
lung mittelalterlicher Texte im medialen Spannungsfeld von Wort, Schrift und Gedächtnis“ (2014‒2016), „Arbeitskoffer
zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters 3D: Literatur- und Wissensvermittlung im öffentlichen und digitalen
Raum“ (2017‒2019). Idee und Gesamtkoordination (inkl. Einrichtung des „Grazer didaktischen Textportals zur Literatur
des Mittelalters“, siehe unter http://gams.uni-graz.at/context:lima) verdanken sich dem Engagement von Ylva Schwing-
hammer, für die Gesamtleitung des „Arbeitskoffer“-Projekts zeichnete Wernfried Hofmeister verantwortlich.
7 Ein mediävistischer Gastvortrag (zum Thema „Fragile Macht: Inszenierungen von weiblicher Herrschaft und
Erbfolge in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit“) bot Ingrid Bennewitz die Gelegenheit, am 12. und 13.
Dezember 2012 gegenüber den entscheidenden Grazer Universitätsstellen persönlich für die Umsetzung des
JMD-Studiums zu werben.
8 Halb anekdotisch sei hierzu angemerkt, dass eine erste wissenschaftliche Begegnung zwischen Ingrid Bennewitz und Wern-
fried Hofmeister schon im Sommer 1984 aus Anlass von dessen erstem öffentlichen Vortrag vor internationalem Publikum
auf dem Kongress zur „Mittelalterlichen Literatur in der Steiermark“ in Seggau stattgefunden hatte – im Nachhinein be-
trachtet, das allererste interessens- und vertrauensbildende Ereignis. An weiteren, später hinzugekommenen Fachkomple-
mentaritäten sei Folgendes auswahlhaft festgehalten: Forschungsschwerpunkte im Editionsbereich, in der überlieferungs-
nahen Textanalyse und – um ein themenspezifisches Beispiel hervorzuheben – die Oswald von Wolkenstein-Forschung
bzw. generell die spätmittelalterliche Literatur. Verbindend wirkten des Weiteren die hohe Wertschätzung von historischer
Grammatik und Sprachanalyse sowie (alles vereinend) ein wacher, unternehmungsfreudiger Sinn für aktive Öffentlich-
keitsarbeit, nicht zu vergessen die intensive Förderung von schul- und unterrichtsorientierten Fachbelangen. – Für historisch
Interessierte sei hinzugefügt, dass es zwischen der Steiermark und Bamberg eine uralte, doch wenig bekannte ‚Partnerschaft‘
gibt: Bischof Ekbert von Andechs-Meranien, kurz Ekbert von Bamberg genannt und u. a. als Erbauer des Bamberger
Doms unvergesslich geworden, wurde kurz vor seinem Tod 1237 Statthalter der Herzogtümer Österreich und Steiermark.Mehrwertlehre 413
renommierten einladenden Partner wirklich auf Augenhöhe begegnen zu können. Innerhalb dieses
multiperspektivischen Planungsszenarios ergab nun eines das andere: der Wunsch nach neuartiger
Lehre den Bedarf an zusätzlichen fächerübergreifenden Lehrmodulen, deren Etablierung wiederum
die Notwendigkeit frischer Geldmittel, und daraus erwuchs die Chance einer autonomen Verwaltung
der erhofften JMD-Finanzen durch die Einsetzung einer eigenen, von der germanistischen Bachelor-
und Master-Curriculakommission (kurz Cuko) unabhängigen JMD-Cuko.
Das alles wurde erfolgreich umgesetzt! Wie es gelang, den soeben geschilderten Dreischritt
‚Lehre – Geld – Cuko‘ Realität werden zu lassen, welche aventiuren dabei zu bestehen waren,
könnte nun viele Seiten füllen, muss aber – etwas scherzhaft formuliert – schon aus Datenschutz-
gründen im Reich des Inoffiziellen bleiben. Ganz unverfänglich erwähnt werden können folgen-
de Eckpunkte: Die fürs JMD-Studium zu ergänzenden Lehrformate betrafen konkret die Etablie-
rung eines sog. Forschungsmoduls, eines Praxismoduls sowie eines fachreflexiven Mastersemi-
nars; ferner legte der Grazer Planungspartner Wert darauf, das für Bamberger Studierende gene-
rell übliche Verfahren von zwei Masterarbeits-Gutachten (anstatt des in Graz üblichen einen) zu
übernehmen, wobei das zweite Gutachten für die Grazer Studierenden vom Bamberger Partner
kommen sollte.9 Puncto Finanzen erklärten sich das geisteswissenschaftliche Dekanat und das
Vizerektorat für Lehre in Graz bereit, den benötigten Sonderfinanzierungsrahmen abzusichern.10
Die angestrebte Einsetzung einer eigenen, neben den anderen Fach-Cukos äquivalent und auto-
nom agierenden JMD-Cuko11 erfolgte durch den Senat der Universität Graz. Nicht vergessen sei
die Realisierung eines letzten, freilich besonders wichtigen Kooperationsbausteins, nämlich des
für alle JMD-Studierenden verpflichtenden Auslandssemesters an der jeweils anderen Universität: Dafür
wurde die Aufnahme in das internationale Erasmus-Mobilitätsprogramm erreicht, was für die
künftigen JMD-Studierenden aus Bamberg und Graz die strategische sowie finanzielle Unterstüt-
zung ihres Gastaufenthalts absicherte. – So also hatte sich der Weg für die Unterfertigung des be-
reits erwähnten Kooperationsvertrags durch die Rektorate beider Universitäten ebnen lassen.12
Das neue JMD-Curriculum konnte in Graz mit Stand 12. Juni 2013 veröffentlicht13 und damit
9 Für die gutachtende Person aus Bamberg geht damit auch die Berechtigung zur Abnahme der Zweitprüfung bei
der kommissionellen Diplomabschlussprüfung einher. Aus studienrechtlichen Gründen musste diese obligate Gra-
zer Regelung im Falle von Bamberger Studienabschlüssen eine fakultative bleiben. Erstmals Gebrauch davon
machte jüngst Jakob Ernesti (Bamberg) für die Zweitbegutachtung seiner Masterarbeit (durch Wernfried Hof-
meister) mit dem Titel „Vom Umgang mit den Toten. Der Leichnam im ‚Wigalois‘ Wirnts von Gravenberg“
(Bamberg 2021, Betreuerin: Ingrid Bennewitz); das Seminar, welches dafür beim Grazer Gastaufenthalt von Herrn
Ernesti (vormals Stößlein) den allgemeinen thematischen Anstoß gegeben hat, ist unter den nachfolgenden Aus-
führungen zu den Grazer Forschungsmodulseminaren beschrieben.
10 Im Unterschied zu den meisten bundesdeutschen Universitäten, so auch zu Bamberg, verwaltet und vergibt etwa in
Graz die Fakultätsebene die Lehrfinanzen, in weit geringerem Ausmaß das Rektorat, wogegen die Institutsebene über
keinerlei Lehrbudget verfügt. Der ausschöpfbare Rahmenbetrag wurde auf die Höchstsumme von 14.000,- € pro Stu-
dienjahr festgelegt. Zwecks organisatorischer Mithilfe – darunter Aufbau und Wartung der (in den ersten Jahren ge-
meinsamen) JMD-Homepage https://germanistik.uni-graz.at/de/joint-masters-degree/ – wurde dem Grazer JMD-
Verantwortlichen eine personelle Unterstützung gewährt: Der Dank dafür gebührt dem Geisteswissenschaftlichen De-
kanat und dem Institut für Germanistik, für die engagierte Durchführung der damit verbundenen Tätigkeiten ist Verena
Fink zu danken sowie ihrer Nachfolgerin Martina Panse. Der Vollständigkeit halber sei bei dieser Gelegenheit auch die
Adresse der soeben erwähnten Bamberger JMD-Homepage genannt: https://www.uni-bamberg.de/ma-jd-philma/.
11 Die Leitung obliegt zweckmäßigerweise dem Grazer Studienkoordinator. Er wurde in dieses Amt ab JMD-Grün-
dung gewählt und für alle weiteren (jeweils 2-jährlichen) Funktionsperioden bestätigt.
12 Namentlich von Prof. DDr. Godehard Ruppert (Bamberg) und Univ.-Prof. Dr. Christa Neuper (Graz).
13 Siehe das Mitteilungsblatt der Universität Graz unter dem Eintrag für den 27.6.2013: https://mitteilungsblatt.uni-
graz.at/de/2012-13/39.d/pdf/. Nicht umsetzbar war die im Studienplan vorsorglich mit abgebildete, vom Bam-
berger Lehrstuhl eingeworbene Partnerschaftsoption mit der Universität Halle a. d. Saale (Lehrstuhl Hans-Joa-414 Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter
dank beiderseits rasch eingeworbener Erstinskriptionen ab dem WS 2013/14 hoch motiviert be-
gonnen werden. Bezüglich der künftigen Studierendenanzahl hatte die Hoffnung von Beginn weg
bei rund 20 gelegen. Fast genauso viele sollten es am Ende insgesamt werden – der 2013 bereits
deutlich spürbaren, doch damals noch nicht so genannten ‚Masterkrise‘14 zum Trotz.
Allgemeines zur Struktur des Grazer JMD-Curriculums
Folgende Tabelle aus dem Curriculum soll vorab die Orientierung zu den Eckpunkten der Stu-
dienstruktur erleichtern:15
1. Sem. Modul Deutsche Philologie I: Freie Wahlfächer/
Grundlagen der deutschen Philologie (10 ECTS) Erweiterungs-
Bereich
Modul Deutsche Philologe II: Wahlpflicht- Praxis-
(20 ECTS)
modul modul
2. Sem. Thematische Module zur Dt. Literatur- u.
Forschung (10 ECTS)
Sprachgeschichte
(10 ECTS)
(30 ECTS, davon zumindest je 10 ECTS im Be-
reich Literatur- bzw. Sprachgeschichte)
3. Sem. Master- und Profilmodul
(10 ECTS)
4. Sem. Masterarbeit und Masterprüfung/Disputation
(30 ECTS)
Übersichtstabelle zum Grazer JMD-Curriculum16
Hervorgehoben sei hier nur das, was man als spezifische Ausprägungen des JMD-Curriculums
bezeichnen mag.17 Das sog. Grundlagenmodul („Modul Deutsche Philologie I“), bestehend
chim Solms): Dort verhinderten gesamtuniversitäre, für viele Fächer existenziell bedrohliche Restrukturierungs-
debatten die notwendige Ressourcensicherheit für die Begründung neuer langfristiger Kooperationen.
14 Damit bezeichnen bekanntlich speziell geisteswissenschaftliche Fächer im deutschen Sprachraum die markante
Abnahme der Anzahl an Masterstudierenden, erklärbar etwa – u. a. im kompetitiven Kontext neu gegründeter
Fachhochschulen – durch die sinkende Attraktivität einer akademisch hoch elaborierten, jedoch in keine äquiva-
lenten Berufsbilder passenden Universitätsausbildung.
15 Die anrechnungstechnische, im Studienplan ausgeführte Kongruenz dieses Grazer Curriculums mit dem Bam-
berger Studienangebot sichert allen JMD-Studierenden während ihres Auslandssemesters an der jeweiligen Part-
neruniversität die Anerkennung sämtlicher Abschlüsse trotz lokal teilweise unterschiedlicher Lehrformate. –
Angemerkt sei noch, dass (anders, als etwa an bundesdeutschen Universitäten üblich) in Graz die Lehre nicht se-
mesterweise, sondern jeweils für ein ganzes Studienjahr geplant wird. Das schafft zwar frühe Planungssicherheit,
erschwert aber kurzfristige Anpassungen.
16 Vgl. Mitteilungsblatt (wie Anm. 13), S. 15.
17 Deutlich wird diese Spezifik im Vergleich zum Regelstudium auf Masterebene, bei dem sich eine Fachspezifik erst
mittels einer Auswahl durch die Studierenden von zwei Bereichen aus den dafür in Frage kommenden drei Teil-
fächern Germanistische Mediävistik, Neuere Deutsche Literatur und Deutsche Sprache ergibt. Das zur Zeit der
Etablierung des JMD-Studiums gültige Grazer Masterstudium der Germanistik findet sich unter dem Link
https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2010-11/36.b/pdf/ (die aktuelle, seit 2020 gültige Fassung unter
https://mitteilungsblatt.uni-graz.at/de/2019-20/35.f/pdf/).
Mit Blick auf die thematischen Module lautet der dazu passende Infotext im gemeinsamen Werbefolder (bzw. -flyer)
des JMD-Studiums wie folgt: „Das Joint Degree Masterstudium Deutsche Philologie des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit bietet Ihnen die Möglichkeit, sich intensiv mit der deutschen Sprache und Literatur des Mittel-Mehrwertlehre 415
aus einer Vorlesung und einem Seminar, wurde aus dem regulären germanistischen Masterstu-
dium übernommen, um auch beim Einstieg ins JMD-Studium ‚Fachgrundlagen für Fortge-
schrittene‘ zu vermitteln.18 Die Inserierung ins JMD-Studium führte nicht nur auf Studieren-
denseite zu einer fruchtbaren Erweiterung des Blickwinkels und insbesondere in den Semina-
ren dieses Moduls zu wertvollen neuen Impulsen (dazu unten etwas mehr)!
Bei den thematischen Modulen, die ebenfalls mit dem regulären Master-Studienangebot
kongruieren, sollte der mediävistische Benefit für JMD-Studierende darin liegen, dass die In-
halte der entsprechenden Vorlesungen und Seminare von keinem germanistischen Zweitfach
‚konkurrenziert‘ werden.19 Dieses zentrale Prinzip bildete für Bamberg und Graz den Kern des
Studiums, wobei aber das Grazer JMD-Curriculum die Möglichkeit einer Schwerpunktsetzung
zwischen der mediävistischen Literatur- und Sprachwissenschaft einräumt20 – freilich ohne die
völlige Abwahl eines dieser beiden mediävistischen bzw. frühneuzeitlichen Bereiche.
Beim Wahlpflichtmodul Forschung21 (oder kurz „Forschungsmodul“) gestattet es der stu-
dienrechtliche Terminus der „Wahlpflicht“ den Studierenden, aus ggf. mehreren einschlägigen
Studienangeboten ein für sie optimales, im fächerübergreifenden Kontext anrechenbares Modul
zu konfigurieren. De facto kamen wirklich passende Forschungsmodule in Form von zwei Semi-
naren aus unterschiedlichen Fächern nur durch die proaktive Organisationsarbeit des Studien-
koordinators zustande, gemäß erwartetem Bedarf an einem Zweijahresrhythmus ausgerichtet.
Derselbe Rhythmus galt für das anwendungs- und öffentlichkeitsorientierte Praxismo-
dul,22 wobei aber für diese maßgeschneiderte Lehre, bestehend aus einem fachwissenschaft-
lichen themeninduzierenden Seminar und einem daran eng angebundenen Praktikum, von
vornherein klar war, dass geeignete Lehrangebote von der JMD-Leitung zu organisieren sein
alters und der Frühen Neuzeit auseinanderzusetzen. Dieses vertiefte Studium der germanistischen Mediävistik
bietet einen multiperspektivischen Zugang zur Erforschung der deutschen Sprache und Literatur vom 8. bis zum
16. Jahrhundert in deren kultureller Relevanz bis zur Gegenwart.“ (https://static.uni-graz.at/fileadmin/gewi-
institute/Germanistik/JD_Mittelalter/JMD_Folder_Stand_18-01-2017.pdf, Folderrückseite, Spalte 1). Ein daraus
abgeleiteter Werbefolder wurde vom Geisteswissenschaftlichen Dekanat aufgelegt: https://static.uni-graz.at/
fileadmin/gewi-institute/Germanistik/JD_Mittelalter/2019027_MASTERINFOFOLDER_DtPhilologieMA.pdf.
18 Dieses Modul wurde im Kontext eines gesamten neuen Masterstudienplans von Wernfried Hofmeister ausge-
staltet und seit seiner ersten Einführung im WS 2008/09 bis heute ‚exklusiv‘ angeboten.
19 In Kongruenz zum Grazer Regelstudium eignen sich dafür alle mediävistischen, einst (vom Beitragsverfasser als Mitent-
wickler des Grazer Masterstudiums) bewusst breit aufgestellten Module „Literatur des Kanons (bis 1600)“, „Textgebundene
Weltmodellierungen“, „Themen, Motive, Stoffe“ und „Editionsphilologie“. Zum obigen (nur halb ernst gemeinten) Stich-
wort „konkurrenziert“ sei hinzugefügt, dass eine gewisse innergermanistische Breite auch auf Masterebene zweifellos wei-
terhin wünschenswert ist. Der großzügige Rahmen an „freien Wahlfächern“ bot genau dafür einen gewissen Spielraum.
20 Dass Bamberg den sprachgeschichtlichen Teil in seinem JMD-Curriculum völlig äquivalent etablieren konnte und
wollte, hängt nicht zuletzt mit der traditionell kollaborativen Verschränkung des dortigen sprachhistorischen
Fachbereichs mit der Mediävistik zusammen.
21 Im oben (Anm. 17) genannten JMD-Folder nimmt folgende Passage auf dieses Modul Bezug: „Zentrale Ausbil-
dungsziele des Masterstudiums sind die Intensivierung und Spezialisierung von philologischen und kulturwissen-
schaftlichen Kompetenzen mit historischer Perspektive sowie die Fähigkeit, wissenschaftliche Methoden im Be-
reich der deutschen Philologie in einer die Fachgrenzen übergreifenden Weise anzuwenden und deren Ergebnisse
für eine breitere Öffentlichkeit aufzubereiten und darzustellen.“ (Folderrückseite, Spalte 1).
22 Darauf referiert im JMD-Werbefolder (wie Anm. 17) folgender Abschnitt unter der Überschrift „Wissenschaft
und Praxis“: „Im Rahmen des Masterstudiums ist ein Berufspraktikum zu absolvieren, das der frühzeitigen Orien-
tierung in der Berufswelt dient. Die enge Verzahnung von Wissenschaft und Praxis wird an allen beteiligten Uni-
versitäten intensiv betrieben. Gemeinsam mit den Studierenden werden Themen der deutschen Philologie des
Mittelalters und der Frühen Neuzeit einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht (Projekt „Steirische Literatur-
pfade“, „Mittelalter macht Schule“ usw.).“ (Folderrückseite, Spalte 3).416 Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter
würden. Der Angebotsrhythmus alternierte mit dem Forschungsmodul, sodass pro Studienjahr
entweder ein Forschungs- oder Praxismodul auf dem Programm stand.
Fast jährlich galt es, für die Absolvierung des Mastermoduls das neu konzipierte sog. Fach-
diskursseminar anzubieten; damit ist das schon eingangs erwähnte „fachreflexive Mastersemi-
nar“ gemeint. Über seine ganz besondere Ausrichtung ist erst im nächsten, umsetzungsorien-
tierten Kapitel zu sprechen.
Ein ebenfalls kurzes Wort genüge zum Curriculumblock der freien Wahlfächer:23 Um für
diesen bewusst großzügig bemessenen Bereich an absolut beliebig wählbaren Lehrveranstal-
tungen den Blick auf alles ‚Mittelalterhaltige‘ an der Universität Graz zu lenken, wie es sich hin-
ter den Veranstaltungstiteln mehr oder weniger klar zeigt, wurden auf der JMD-Homepage zu
Beginn eines jeden Studienjahres entsprechende Tipps kundgemacht.
Das alles überspannend war der JMD-Lehrbetrieb darauf ausgerichtet, sämtliche JMD-spezi-
fischen Angebote auch für Studierende aus anderen Studiengängen und Fächern zu öffnen, damit
aus den ansonsten drohenden JMD-Kleinstgruppen doch etwas größere, fächerübergreifend
inspirierende ‚Thinktanks‘ würden. Mit anderen Fach-Cukos abgesprochene Anrechnungsoptio-
nen und intensive Werbung sorgten dafür, dass meist Gruppen von über fünf Personen zustande
kamen. Diese waren dann freilich immer noch klein und intensiv genug, um (als sehr wünschens-
werten Nebeneffekt!) zwischen den JMD-Studierenden eine kollegial freundschaftliche Atmo-
sphäre entstehen zu lassen, in die sich auch die Lehrenden mit eingebunden sehen durften –
vielleicht entfernt vergleichbar mit den fast familiären Gründungszeiten der Grazer Germanistik.24
Die umgesetzte JMD-Lehre: eine Ährenlese
Für die Betrachtung der konkreten Ergebnisse aus dem oben erläuterten Lehrkonzept soll das
Hauptaugenmerk vorweg den insgesamt sechs durchgeführten Forschungs- und Praxismo-
dulen gelten.25 Ergänzend treten kumulative Bilanzen der JMD-relevanten Ergebnisse aus den
Seminaren zum Grundlagenmodul und Mastermodul (Fachdiskursseminare sowie Privatissima)
hinzu sowie abrundende Highlights aus jenen themenorientierten Seminaren (von Andrea Hof-
meister und/oder Wernfried Hofmeister) des Moduls Deutsche Philologie II, in denen
JMD-Studierende gleichsam das Salz in der Suppe waren.
23 Siehe dazu den Kommentar in Anm. 19.
24 Vgl. Wernfried Hofmeister: Vom „Salonseminar“ zum öffentlichen Seminar-Projekt. In: Literatur. Lehren. Ler-
nen. Hochschuldidaktik und germanistische Literaturwissenschaft. Hg. von Susanne Hochreiter und Ursula Klin-
genböck. Wien u. a. 2006, S. 157‒172, und Hans-Harald Müller/Myriam Isabell Richter: Praktizierte Germanistik.
Die Berichte des Seminars für deutsche Philologie der Universität Graz 1873‒1918. Unter Mitarbeit von Margare-
te Payer. Stuttgart 2013 (= Beiträge zur Geschichte der Germanistik; 5). Vor allem letztgenannte Publikation
macht deutlich, mit welch hohem persönlichen Einsatz einzelne Universitätslehrer ihre Studierenden gefördert
haben, und sie legt nahe, dass dies ein wesentlicher Teil der bemerkenswerten Führungsrolle der Grazer Germa-
nistik zu dieser Zeit im gesamten deutschen Sprachraum war.
25 Zwei Forschungs- und vier Praxismodule wurden abgehalten. Die ungleiche Verteilung zwischen diesen beiden
alternierend angebotenen Curriculabereichen erklärt sich einerseits aus dem Ersteinstieg mit einem Praxismodul,
andererseits aus der Erfahrung, dass es die o. g. interdisziplinären Stärken des Bamberger Partners (mit dem Mit-
telalterzentrum im Rücken) einigen Grazer JMD-Studierenden ermöglichte, ein äquivalentes Wahlpflichtmodul im
Rahmen ihres Auslandssemesters in Bamberg zu absolvieren.Mehrwertlehre 417 Praxismodule Das erste Lehrangebot aus diesem Bereich – und überhaupt das allererste Speziallehre-Ange- bot im JMD-Studium26 – trug im WS 2014/15 den modulübergreifenden Titel Mittelalterliche Literatur im öffentlichen Raum, thematisch angelehnt an das (schon eingangs erwähnte) Literatur- pfadeprojekt. Fürs mediävistische Seminar von Andrea und Wernfried Hofmeister lautete der Untertitel schlicht Fachwissenschaftliche Aspekte27, Aspekte der museologischen Vermittlung28 fürs daran angedockte, von denselben Studierenden besuchte Praktikum von Theresa Zifko.29 Trotz der engen Verschränkung beider Lehrveranstaltungen gelangten je eigene Projekte zur Umsetzung: Im Seminar entstand für den damals geplanten 9. Literaturpfad in Žiče (Seitz in Slowenien) 30 unter aktiver Beteiligung aller Studierenden ein begleitendes Textheft zum Marienleben des Bru- der Philipp von Seitz mit Übersetzungen ausgewählter Textpassagen.31 Im parallel abgehalte- nen Praktikum durften die Studierenden unter professioneller Anleitung ausloten, auf welchem Weg sich das Ausstellungsobjekt ‚Literatur‘ (am Beispiel der mittelalterlichen Literatur in der Steiermark) in einem konkreten Raum optimal präsentieren ließe.32 Das facettenreiche Ergeb- nis beider Lehrveranstaltungen wurde zu Semesterende an der Universität Graz öffentlich prä- sentiert und rege diskutiert. 26 Aus diesem Anlass überbrachte zu Modulbeginn Margit Reitbauer in ihrer Funktion als Studiendekanin Gruß- worte namens der Grazer geisteswissenschaftlichen Fakultät. 27 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=405173&pSpracheNr=1. 28 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=405174&pSpracheNr=1. 29 In Theresa Zifko[-Rosinger] stand eine bewährte Kooperationspartnerin zur Verfügung: Als FH-Absolventin des Faches Museumsdesign hatte sie bereits als Literaturpfade-Designerin firmiert; s. Theresa Zifko: Literatur lokali- siert. Museologische Überlegungen zur Präsentation von literarischen Texten mit besonderer Bezugnahme auf das Designkonzept des Projekts Steirische Literaturpfade des Mittelalters. Frankfurt a. M. u. a. 2013 (= Mediävistik zwischen Forschung, Lehre und Öffentlichkeit; 6). 30 Er hätte gemäß letztem, umsetzungsreifem Planungsstand außen um die Mauern der Kartause Seitz herumführen sollen, also nur wenige Meter entfernt von jener Wirkungsstätte, wo einst der Kartäusermönch Bruder Philipp sein berühmtes Werk verfasst hatte. Trotz aller Vorleistungen durch die Projektleitung der Literaturpfade konnte die- ser Pfad die benötigten Fördergelder auf slowenischer Seite leider nicht gewinnen. 31 Die Gestaltung des Texthefts orientierte sich an der bereits publizierten Serie von Textheften und erschien 2016 im Eigenverlag: Bruder Philipp der Kartäuser: Marienleben. Mittelhochdeutscher Text und Übertragung ins Neuhoch- deutsche in Auszügen. Hg. von Andrea Hofmeister und Wernfried Hofmeister unter Mitwirkung von Cornelia Drex- ler, Ivelina Dyulgerova, Alexandra Fiala, Lisa Maria Glänzer, Wolfgang Holanik, Anna Kollingbaum, Ramona Richter und Matthias Schwendtner. Graz 2015 (= Texte zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters; 6). Auf der Rück- seite des Umschlags steht stolz: „Textauswahl, Übersetzung und verbindende Überleitungstexte wurden im Winterse- mester 2014 von den Teilnehmer/innen des Praxis-Moduls ‚Mittelalterliche Literatur im öffentlichen Raum‘ erarbei- tet.“ Als sog. graue Literatur fand dieses Textheft im Verband mit den übrigen Textheften Aufnahme in eine Sam- melpublikation, die in der Grazer Fachbibliothek für Germanistik aufliegt, aufrufbar unter dem Katalogisat-Link https://permalink.obvsg.at/UGR/AC13235438. 32 Zumindest Teile bzw. Aspekte des dabei entwickelten Konzepts „Ich-Objekte. Steirische Autoren des Mittelalters im Spiegel von Landes- und Geistesgeschichte“ ließen sich etwas später in der Ausstellung „#dichterleben. Mittelalterliche tweets aus der Steiermark“ realisieren. Diese wurde von Wernfried Hofmeister in Kooperation mit dem o. g. „Arbeits- koffer“-Projekt konzipiert und war von 2016 bis 2018 im Steiermärkischen Landesarchiv zu sehen; sie kann jetzt noch virtuell bei einem interaktiven 360°-Rundgang besucht werden: http://gams.uni-graz.at/lima/dichterleben360/. Die fünf Ausstellungsmodule wanderten danach an fünf Orte in der Steiermark. Über alles Nähere informiert der Beitrag von Wernfried Hofmeister: Botschaften aus dem Mittelalter: Die #dichterleben-Ausstellung 2016–2021(?) im Kontext ihrer Literatur-, Landes- und Projektgeschichte. In: Blätter für Heimatkunde 93 (2019), S. 81–97.
418 Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter
Storytelling: Bildungstouristische Wege zu mittelalterlicher Literatur lautete das Generalthema des Pra-
xismoduls im WS 2016/17, in welchem einerseits Fachwissenschaftliche Aspekte (Andrea Hofmeis-
ter)33, andererseits deren Führungspraktische Umsetzung (Elisabeth Brenner)34 auf dem Programm
standen. Als Objekt für dieses fächerübergreifende Lehrprojekt zwischen Germanistik und
Kunstgeschichte wurde der Zyklus der insgesamt 15 skulptural gestalteten Gewölbekonsolen
im Kreuzgang des ehemaligen Zisterzienserstifts Neuberg an der Mürz gewählt: Die Tierplasti-
ken aus den 1340er Jahren umfassen neben Darstellungen der vier Evangelistensymbole Sze-
nen aus dem Physiologus und eigneten sich somit bestens für eine interdisziplinäre Erschließung
aus literaturwissenschaftlicher und kunsthistorischer Perspektive. Sieben Master- und Dokto-
ratsstudierende enträtselten unter Anleitung der beiden Lehrenden die Geschichten, welche die
bald 700 Jahre alten Darstellungen von Tieren und fabelhaften Wesen den Betrachter:innen
erzählen. Das Modul fand in besonders enger Verschränkung statt, indem sich beide Lehrver-
anstaltungen sowohl der fachwissenschaftlichen Erschließung als auch der Didaktisierung der
Ergebnisse unter Einsatz der ‒ heute so modernen, aber in Wahrheit uralten ‒ Methode des
Storytelling widmeten. Was zunächst in erster Linie als philologische bzw. kunsthistorische
Fingerübung gedacht war, entwickelte eine ungeahnte Dynamik, als sich herausstellte, dass
nicht alle der dargestellten Figuren bislang von der Forschung richtig identifiziert und gedeutet
worden waren, was eine Neubewertung nicht nur der einzelnen Figuren, sondern des gesamten
Skulpturenzyklus unter Einbeziehung seiner ursprünglichen Funktion als Kontemplations- und
Meditationszone des Konvents erforderlich machte. Nach der umfassenden Orientierung über
den wissenschaftlichen Status quo beider Fächer galt es, die reichen Ergebnisse in einer Form
aufzubereiten, dass sie einem nichtakademischen Publikum sachlich korrekt, aber auf anspre-
chende Weise vermittelt werden konnten: Was den Zuhörer:innen am 28. Jänner 2017 im
Pfarrsaal des ehem. Stiftes bei einer öffentlichen, gut besuchten Präsentation geboten wurde,
war ‚Edutainment‘ vom Feinsten. Eine Art Schlussbericht über das erfolgreiche Lehrprojekt
erschien bald danach im Mitteilungsblatt des Vereins der Freunde des Neuberger Münsters.35
Philologische Fertigkeiten mit Kompetenzen der digitalen Datengenerierung, -verarbeitung
und -präsentation zu verbinden, war die Intention des nächsten praxisbezogenen Lehrprojekts im
WS 2018/19. Es stand unter dem Generalthema Kulinarhistorische Texte und widmete sich im me-
diävistischen Seminar der Philologischen Erschließung und realienkundlichen Kommentierung (Andrea Hof-
meister)36 von spätmittelalterlichen Kochrezepttexten, während das Praktikum aus dem Bereich
der Digital Humanities die (ausschließlich weiblichen) Teilnehmerinnen in die Datenverarbeitung im
Kontext einer Digitalen Edition (Helmut W. Klug)37 einführte. Den Ausgangspunkt bildete der latei-
nische Bericht des Paolo Santonino († 1507), Privatsekretär des Patriarchen von Aquileia, über
drei diplomatische Reisen, die er in den Jahren 1485‒1487 als Mitglied einer geistlichen Delega-
tion durch Osttirol, Kärnten, Krain und die ehemalige Mark an der Sann begleitete. Neben seiner
dienstlichen Mission offenbaren seine Aufzeichnungen ein lebhaftes Interesse an Land und Leu-
ten, speziell den regionalen Essgewohnheiten, denn er hält alle auf der Reise konsumierten Mahl-
zeiten detailliert fest. – Soweit die Ausgangssituation, an die sich das Lehrprojekt knüpfte. Im
Praktikum sollten die drei Teilnehmerinnen – es handelte sich ausnahmsweise um lauter JMD-
33 https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=457745.
34 https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=457746.
35 Vgl. Andrea Hofmeister und Elisabeth Brenner: Was mittelalterliche Tiere erzählen. Eine Entdeckungsreise durch den Neu-
berger Kreuzgang. In: Der Dom im Dorf. Mitteilungsblatt der „Freunde des Neuberger Münsters“ 96 (Okt. 2017), S. 3–11.
36 https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=538247.
37 https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=541839&pSpracheNr=1.Mehrwertlehre 419
Studierende – Grundlagen der Datenverarbeitung erwerben und an der Erstellung einer digitalen
Edition der besagten Schrift mitwirken. Die Aufgabenstellung lautete, Santoninos Reiseroute
samt Orts- und Datumsangaben zu visualisieren und zu annotieren, insbesondere alle Erwähnun-
gen von Tischgenossen, Speisen und Menüfolgen. Im fachwissenschaftlichen Seminar wurden zu
diesen Speisennennungen und -beschreibungen Kochrezepttexte aus deutschsprachiger Überlie-
ferung recherchiert, um eine Vorstellung davon zu erhalten, welche Gerichte sich hinter den latei-
nischen Bezeichnungen verbergen könnten. Ermittelt wurden diese Kochrezepte mit Hilfe der
Datenbank „Medieval Plants Survey“38 als Recherchemedium, welches den Weg zu den Editi-
onen weist. So konnte ‒ um ein Beispiel zu nennen ‒ ein von Santonino wegen der dunklen Far-
be als carnes in tenebras beschriebenes Gericht als Fürhäs identifiziert werden, ein in der Ober-
schichtenküche verbreitetes würziges Ragout aus Innereien und Tierblut. Mittels textkritischen
Vergleichs von Rezepten aus verschiedenen Überlieferungen wurden zahlreiche Varianten des
Gerichts ausgemacht, eine aussagekräftige Zubereitungsanleitung rekonstruiert und mit Hilfe re-
alienkundlicher Literatur kommentiert, was eine praktische Umsetzung ermöglichte. Eine solche
wurde von den drei JMD-Kandidatinnen in Form eines Workshops für eine Studierendengruppe
des Instituts für Archäologie ausgerichtet. Für dieses Unternehmen, das am 2. Februar 2019 zum
Abschluss des Semesters stattfand, bot die noch völlig intakte Rauchküche aus dem späten
15. Jahrhundert im ehemaligen Propsteigebäude der Wallfahrtskirche Straßengel bei Graz das
perfekte, weil historisch authentische Ambiente.39
Mit ausgewählten deutschsprachigen Texten aus dem stets aktuellen Themenbereich Heilung
und Gesundheitsvorsorge wurden die Teilnehmerinnen im letzten Modul Mittelalterliche Literatur als
Allheilmittel im SS 2021 befasst, das im fachwissenschaftlichen Seminar und im Praktikum von
Andrea und Wernfried Hofmeister gemeinsam betreut wurde: Die Lektürepalette im fachwissen-
schaftlichen Seminar unter dem Titel Kurative Fachliteratur und Dichtung40 reichte von kurzen saler-
nitanischen Gesundheitssprüchen über komplexe „Regimina sanitatis“ bis hin zu den bedeutend-
sten deutschsprachigen Arzneibüchern des Spätmittelalters, dem sog. Bartholomäus und dem
Handbuch Ortolfs von Baierland. Da sich fachliterarische Texte erst vor dem Hintergrund des
zeitgenössischen Wissensstandes erschließen, galt es zunächst Grundlagen der alten Medizin zu
erarbeiten, z. B. die Vier-Säfte-Lehre, die Vorstellung von den Organfunktionen, die ‚Sex res non
naturales‘, das astromedizinische Denkgebäude und dergleichen mehr. Ausgestattet mit solchem
Basiswissen durften die Teilnehmerinnen aus dem breiten Themenspektrum jeweils einen Schwer-
punktbereich wählen, um diesen einerseits in seinen wesentlichen Grundzügen zu präsentieren
und andererseits Reflexe in der Dichtung aufzuspüren, denn durch die Berücksichtigung solchen
Artes-Wissens erschließt sich eine zusätzliche Bedeutungstiefe in der poetischen Literatur.
Als Teil der sog. TEM (Traditionelle Europäische Medizin) erfährt die mittelalterliche Klos-
termedizin heute wieder verstärkte Aufmerksamkeit. Daher war es das Ziel des angeschlossenen
Praktikums, Moderne Rezeption und Vermarktung41 der mittelalterlichen medizinischen Fachliteratur
unter die Lupe zu nehmen und solche Versuche der Wiederbelebung bewährten Gesundheits-
38 MPS-Repository: http://medieval-plants.org/mps-daten/ (erstellt von Helmut W. Klug und Roman Weinberger).
39 Sie dazu folgenden Kurzbericht: http://kulinarisches-mittelalter.org/wie-man-es-schafft-einen-fisch-am-spiess-
am-kopf-und-am-schwanz-zu-braten-und-in-der-mitte-zu-daempfen/; das Ergebnis dieses digitalen Editionspro-
jekts ist interaktiv nachzulesen unter https://gams.uni-graz.at/context:santonino.
40 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=645008.
41 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=645009.420 Wernfried Hofmeister und Andrea Hofmeister-Winter
wissens in der alternativen Medizin und im Rahmen diverser Wellness-Angebote einer rezepti-
onskritischen Reflexion und Bewertung zu unterziehen. Um die aufschlussreichen Seminarergeb-
nisse trotz pandemiebedingter Beschränkungen der Öffentlichkeit vorstellen zu können, wurde
diesmal das Medium ‚Web-Blog‘ genutzt: Unter dem Titel „Von Aderlässen, Winden und Zahn-
beschwörungen“ kann man frei Haus die Quintessenz des erarbeiteten Wissens nachlesen, an-
gepasst an den ernährungsbezogenen Fokus des Blogs „Historische Kulinarik“42 der renom-
mierten österreichischen Tageszeitung Der Standard.43
Forschungsmodule
Im WS 2015/16 galt es, das erste Forschungsmodul anzubieten. Je ein altgermanistisches und
ein religionswissenschaftliches Fachseminar widmeten sich dafür der Ergründung historisch
greifbarer Konzepte von menschlichem ‚Glück‘ zwischen Himmel und Erde:44 Der Titel des
philologischen Seminars von Andrea und Wernfried Hofmeister lautete Glücksdiskurse in der
deutschsprachigen Literatur des Mittelalters und löste ein, was sein Ankündigungstext versprach:
Vorstellung, Analyse und Interpretation von repräsentativen Texten der älteren deutschen Dichtung,
die sich explizit oder implizit mit der Frage nach dem Glück und dessen Erreichbarkeit auseinander-
setzen. Untersucht werden sollen Diskurse über das ‚gute Leben‘ des Einzelnen und des Kollektivs
speziell vor dem Hintergrund der christlichen Glaubenslehre, einschließlich des ‚guten Todes‘ als
wesentlicher Voraussetzung für das Heil der Seele resp. die Glückseligkeit im Jenseits.
Der bewusst breit gespannte Bogen an literarischen Zeugnissen reicht von Sprichwörtern über Mären
und höfische Dichtung bis hin zu religiös-didaktischen und mystischen Texten sowie zeitkritischen
Lehrschriften.45
Als ideale, sowohl theologisch als auch altgermanistisch ausgewiesene Lehrprojektpartnerin bot
dazu die Religionswissenschaftlerin Theresia Heimerl (gemeinsam mit ihrer Kollegin Lisa
Kienzl) ein kongeniales Seminar an: Diesseitiges Glück und ewige Glückseligkeit: Religion im Span-
nungsfeld von Jenseitshoffnung und diesseitigen Glücksgefühlen.46
Die angestrebte enge Verzahnung beider Seminare wurde durch eine gemeinsame Gestal-
tung von rund der Hälfte aller Seminareinheiten erreicht. Dazu zählte der fachlich grundlegen-
de Gastvortrag, den der Philosophiewissenschaftler, Antike-Spezialist und quellenkritisch ge-
schulte ehem. Germanist Harald Berger für die Seminarist:innen zum Thema „Denken über
Glück im Mittelalter – Erwartungsgemäßes und Überraschendes“ hielt. In der Tat bestand der
besondere interdisziplinäre Gewinn in diesem Modul aus manch ‚Überraschendem‘, nämlich
gleichsam aus vielen Glücks-Momenten wechselseitiger Spontaninspirationen und -assoziatio-
42 Siehe https://www.derstandard.at/lifestyle/essentrinken/ub-blog-historische-kulinarik.
43 https://www.derstandard.at/story/2000129041108/mittelalterliches-heilwissen-von-aderlaessen-winden-und-
zahnbeschwoerungen, veröffentlicht am 8.9.2021.
44 Das Potenzial dieses vieldimensionalen Themas hatte kurz davor eine (von Wernfried Hofmeister betreute) Lehramts-
studentin und spätere JMD-Studierende im Zuge ihrer Diplomarbeit ausgelotet, indem sie das damals medial frisch kur-
sierende Stichwort vom wünschenswerten ‚Unterrichtsfach Glück‘ aufgriff: Lisa Glänzer: Das Glück haben, glücklich zu
sein. Theoretische Überlegungen und praktische Handreichungen zur Vermittlung mittelalterlicher Texte im Unterrichts-
fach „Glück“. Graz, Diplomarbeit 2015. Online unter https://unipub.uni-graz.at/download/pdf/1255470.
45 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=413787&pSpracheNr=1.
46 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=413300&pSpracheNr=1.Mehrwertlehre 421
nen in den diskussionsfreudig ausgeloteten Komplementärfeldern von Textphilologie, Glau-
benslehre, Mentalitäts- und Kulturgeschichte.
Cold Cases: Der Leichnam als mittelalterliches Erzählmotiv,47 so lautete fürs WS 2017/18 der Titel
des zweiten Forschungsmodulseminars von Andrea und Wernfried Hofmeister. Als Modulpart-
ner, ja sogar als Themeninspirator fungierte diesmal der Mittelalterhistoriker Romedio Schmitz-
Esser dank seiner frisch gedruckten Habilitationsschrift „Der Leichnam im Mittelalter“.48 Das
darauf kooperativ Bezug nehmende geschichtswissenschaftliche Seminar von Schmitz-Esser trug
den Titel: Einbalsamierung, Forensik und medizinische Sektion im Mittelalter.49 Auch wenn die Lehrver-
anstaltungen räumlich diesmal weniger oft verbunden waren als beim erstgenannten Forschungs-
modul, ergaben sich zumindest für die in beiden Seminaren anwesenden JMD-Studierenden zahl-
reiche wertvolle Querimpulse.
Der spezielle Fokus des germanistischen Seminars lag darin, mit gewissermaßen kriminologi-
scher Energie in diversen Dichtungen Schilderungen einzelner Leichen zu finden und die dazu-
gehörigen Todesumstände aufzuklären. Wichtige allgemeine Hinweise zur professionellen Erkun-
dung von Tatorten lieferte ein Seminarvortrag des Historikers und Rechtskundlers Christian
Bachhiesl, in dem er Einblicke in die Sammlung des von ihm geleiteten Hans Gross Kriminalmu-
seums an der Universität Graz gab.50 Vor diesem Hintergrund konfigurierte die Seminarleitung
eine sog. Kriminalakte:51 Sie führte die Studierenden im weiteren Verlauf der Lehrveranstaltung
zielstrebig auf die Spur vielversprechender ‚Textleichen‘ und half dabei, diese resp. ihre mutmaß-
lichen Schicksale umfassend und einheitlich zu beschreiben. Als Beweismittel für die am Ende
durchwegs erfolgreichen Bemühungen entstand ein umfangreiches Seminar-Portfolio zu den
spannenden ‚Cold Cases‘ im Reinhart Fuchs, in Lied c 44 von Neidhart, in der Österreichischen
47 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=501913&pSpracheNr=1.
48 Romedio Schmitz-Esser: Der Leichnam im Mittelalter. Einbalsamierung, Verbrennung und die kulturelle Kon-
struktion des toten Körpers. Ostfildern 2014 (= Mittelalter-Forschungen; 48) (2., unveränd. Aufl. 2016). Der frü-
he Zeitpunkt für die JMD-Kooperation war gut gewählt, denn 2017 soeben erst nach Graz berufen, übernahm
Schmitz-Esser bereits 2020 den Heidelberger Lehrstuhl für Mittelaltergeschichte.
49 Siehe im Lehrveranstaltungsverzeichnis unter:
https://online.uni-graz.at/kfu_online/pl/ui/$ctx/wbLv.wbShowLVDetail?pStpSpNr=503455&pSpracheNr=1.
50 Siehe Näheres unter https://universitaetsmuseen.uni-graz.at/de/unsere-sammlungen-und-ausstellungen/hans-gross-
kriminalmuseum/.
51 Angelehnt an kriminologisches Fachvokabular galt es im literarhistorischen Kontext folgende ‚Indizien‘ zu dokumentieren
bzw. zu rekonstruieren, soweit eben möglich und plausibel: ‚Fahndungsfoto‘ (fallspezifische Abbildung durch eine Hand-
schriftenillustration), Allgemeine Kenndaten zum ‚Fall‘ (Text, Autor, Entstehungszeit, Überlieferungszeit, Gattungszuge-
hörigkeit), ‚Fahndungsvermerke‘ zur ‚Rasterfahndung‘ (Datenbanken, Lexika, andere/fremde Hinweise, persönliche Ent-
deckungen), ‚Autopsie‘-Befund der ‚Textleiche‘ (‚biometrische Daten‘ zu Geschlecht/Alter/Größe/Hautfarbe/Ver-
letzungsspuren, sozialer Stand), Spurensicherung am ‚Tatort‘ (Sicherung von narrativen ‚Fingerabdrücken‘ als Indizien für
Todesumstände bzw. -ursache, Tatzeitpunkt, Beschreibung der Kleidung, Tatortzustand, Fluchtindizien/-fahrzeug/-tier),
zeitgenössische ‚Zeugenberichte‘, Textpersonal, Erzähler/Autor (‚Detektivarbeit‘ mit alten und neuen ‚Sachverständigen-
gutachten‘), Aufspüren wissenschaftlicher Untersuchungen zum ‚Cold Case‘ bzw. zu vergleichbaren ‚Fällen‘ durch die
moderne Wissenschaft: Philologie/Geschichte/Archäologie/Theologie u. a. m., Todesursache (Ermittlung des Tat-
hergangs bzw. der – gewaltsamen oder natürlichen – Todesursache), ‚Profiling‘ (Tätererfassung/-beschreibung/-über-
führung, Einbeziehung allfälliger ‚Alibis‘, Schilderung des ‚Tatmilieus‘ und Tötungsmotivs gemäß Fallanalyse im narrati-
ven Zusammenhang, Mittäter, Nennung und Erhellung allfälliger ‚Komplizenschaften‘), narratives Motiv (Versuch einer
namentlichen Kategorisierung des ‚Falles‘ im motivgeschichtlichen Zusammenhang, ‚staatsanwaltliche‘ Gesamtbeurtei-
lung der ‚Ermittlerin‘/des ‚Ermittlers‘ mit Rekonstruktion des ‚Cold Case‘, durchformulierte Darstellung des ‚Tathergangs‘
mit ‚Plädoyers‘ für einen ‚Freispruch‘ oder für eine ‚Anklageerhebung‘ mit Hinweisen auf eine ‚gerechte Verurteilung‘
und/oder eine weitere Untersuchung des Falles mit ‚zweckdienlichen Hinweisen‘). – Diese ungekürzte Liste möge es
diversen ‚Nachahmungstäter:innen‘ erleichtern, ähnliche Forschungen zu betreiben!Sie können auch lesen