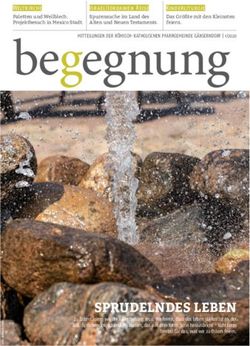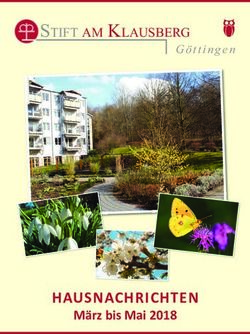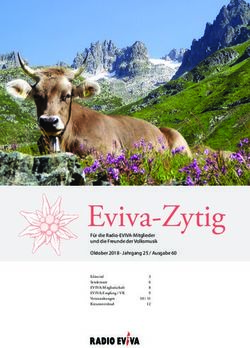Messe in h-Moll JOHANN SEBASTIAN BACH - Berliner Singakademie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin
Samstag, 11. Dezember 2021, 19 Uhr
2. Abonnementkonzert
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Messe in h-Moll
BWV 232
Johanna Knauth, Sopran
Henriette Gödde, Alt
Martin Lattke, Tenor
Philipp Kaven, Bass
Ensemble wunderkammer
Berliner Singakademie
Leitung: Achim Zimmermann4 Einführung
Nonplusultra der Chormusik
Johann Sebastian Bachs große Messe in h-Moll
Im Februar 1835 kam es in Berlin zu einer geschichtsträchtigen
Aufführung. Die Sing-Akademie unter ihrem Direktor Carl Fried-
rich Rungenhagen stellte Bachs große Messe in h-Moll vor, groß
und ganz. Kyrie und Gloria waren bereits im Jahr zuvor erklungen,
nun aber war das Werk zum ersten Mal überhaupt vollständig zu
erleben. Ein langwieriger Prozess war diesem Ereignis voraus-
gegangen: Bereits ab 1811 hatten die Sängerinnen und Sänger,
angeleitet von Carl Friedrich Zelter, an der Messe geprobt, ohne
dass jedoch eine öffentliche Darbietung ins Auge gefasst worden
wäre. Die Übungen dienten zwar dazu, intensiv diese so kunst-
voll ausgearbeitete Komposition kennenzulernen und Schritt für
Schritt in das Wunderreich der Bach'schen Musik vorzudringen,
jedoch sollte dies intern geschehen und nicht vor einem womög-
lich unsensiblen und sensationsgierigen Publikum.
Friedrich August II.Einführung 5 Dass man sich schließlich doch dazu entschloss, die Messe in h-Moll der interessierten Öffentlichkeit zu präsentieren, ist wesentlich dem Erfolg eines Unternehmens zu verdanken, das bei den Zeitgenossen viel Resonanz gefunden hat: die Wiederaufführung der Matthäus- passion im März 1829 auf Initiative des jungen Felix Mendelssohn Bartholdy. Dieses mit viel Aufmerksamkeit bedachte Ereignis, das als Initialzündung einer europaweiten Bach-Renaissance angese- hen werden kann, da – immerhin mehrere Jahrzehnte nach Bachs Tod – erstmals ein vokalinstrumentales Großwerk neu zum Leben erweckt worden war, gab auch der Beschäftigung mit der Messe in h-Moll starke Impulse. Dabei ist keineswegs auszuschließen, dass bereits um 1830, zumin- dest in privatem Rahmen, einzelne Teile der Messe (oder sogar das Werk als Ganzes) aufgeführt worden sind, gesicherte Informationen dazu sind jedoch bislang noch nicht bekannt geworden. Fest steht allenfalls, dass Bach selbst sein Werk nicht komplett hat hören kön- nen. Offenbar arbeitete er noch in seinen letzten Lebensmonaten an der Fertigstellung und fügte das Komponierte schließlich zu einem umfangreichen Konvolut zusammen, das der Nachwelt als die »Messe in h-Moll« bekannt geworden ist. Die überlieferte Partitur ist über einen Zeitraum von rund zwei Dut- zend Jahren entstanden. Drei wesentliche Schaffensphasen sind auszumachen: 1724 komponierte Bach ein Sanctus, das später in die Messe integriert wurde, 1733 folgten Kyrie und Gloria, während die Ausformung der übrigen Sätze nach den Erkenntnissen der Bach- Forschung wohl in die späten Jahre 1748/49 fällt. Das klangprächtige Sanctus, für sechsstimmigen Chor geschrieben, erklang während der Leipziger Weihnachtsgottesdienste von 1724 und wurde wahrscheinlich 1727 nochmals aufgeführt. Es ist eng verbunden mit Bachs Tätigkeit als Thomaskantor und städtischer Director musices, von dem man gerade an den hohen kirchlichen Feiertagen eine Musik von besonderem Glanz erwartete – Bach hat seine Dienstherren in dieser Hinsicht wahrlich nicht enttäuscht. Die Kyrie-Gloria-Kombination von 1733 besaß ihren Ursprung in Bachs offenkundigem Bestreben, in Dresden auf sich aufmerksam zu machen. Durch verschiedene Besuche kannte er das reichhal- tige Musikleben der sächsischen Residenzstadt – sowohl mit der protestantischen als auch der katholischen Kirchenmusikpflege war er vertraut, zu einigen seiner geschätzten Komponistenkolle- gen unterhielt er persönliche Kontakte. Eine Gelegenheit, sich mit seinen eminenten künstlerischen Fähigkeiten bei Hofe zu emp- fehlen, bot sich nach dem Tod des charismatischen sächsischen Kurfürsten August des Starken mit der Regierungsübernahme seines Sohnes Friedrich August II., der zugleich – wie bereits sein
6 Einführung
Vater – als König von Polen eine herausragende Stellung besaß
und als solcher den katholischen Glauben angenommen hatte.
Bach widmete dem neuen Monarchen eine aus Kyrie und Gloria
bestehende »Missa«. Uneigennützig geschah dies freilich nicht,
verband er doch damit das Gesuch, ihm den prestigeträchtigen
Titel eines »Hof-Compositeurs« zu verleihen. Bachs Bitte um »ein
Praedicat von Dero Hoff-Capelle« wurde zunächst abgeschlagen,
nach einem erneuten Versuch 1736 jedoch entsprochen. Dem
Ansehen des Leipziger Thomaskantors kam die Verleihung dieses
Ehrentitels jedenfalls merklich zugute.
Dass Bach seinem sächsischen Landesherrn gerade eine lateini-
sche »Missa« zueignete, ist von einer gewissen Logik. Zum einen
begab er sich in das Zentrum der katholischen Liturgie, zum ande-
ren befand er sich damit in Übereinstimmung mit den ihm geläu-
figen lutherischen Praktiken. Die einschlägigen Gottesdienstord-
nungen sahen es durchaus vor, dass Kyrie und Gloria, die beiden
ersten Teile des Messordinariums, die ohne Unterbrechung durch
das gesprochene Wort als geschlossene Einheit direkt aufeinander
folgen, mehrstimmig gesungen und von Instrumenten begleitet
werden konnten. In den späten 1730er-Jahren hat Bach vier allein
aus Kyrie und Gloria bestehende Messen für Aufführungen in den
beiden Leipziger Hauptkirchen eingerichtet, wobei er zumeist
schon bestehenden Kompositionen (in der Regel Sätze aus geist-
lichen Kantaten) die neuen Texte unterlegte, zugleich aber auch
Veränderungen der melodischen, harmonischen oder rhythmi-
schen Strukturen vornahm.
Von diesen vier Leipziger »Kyrie-Gloria-Messen« (BWV 233–236),
die mit einem eher bescheidenen Aufführungsapparat auskom-
men, unterscheidet sich die 1733 für Dresden geschriebene
Satzfolge spürbar. Zum einzigen Mal verwendete Bach das volle
Instrumentarium, einschließlich der Pauken und Trompeten, was
eine ausgesprochen farbenreiche und klangprächtige Musik her-
vorgebracht hat. Als er sich rund eineinhalb Jahrzehnte später dar-
anmachte, die bereits vorliegenden Teile Kyrie, Gloria und Sanctus
zu einer vollständigen Messe, einer »Missa tota«, zu ergänzen, griff
er gewiss nicht zufällig auf diese besonders eindrucksvoll gestal-
teten Stücke zurück – sie wurden zum Grundstock eines für Bach
und seine Zeit einzigartigen Werkes.
Die Komplettierung der h-Moll-Messe in den späten 1740er-Jahren
erfolgte dann prinzipiell nach dem Muster der vier Leipziger Ky-
rie-Gloria-Messen: In der Regel nahm er sich bereits existierende
Sätze aus seinen Kantaten vor und arbeitete sie textlich wie musi-
kalisch um, wobei er nicht selten die kompositorischen Strukturen
glättete und den Tonsatz auf eine neue qualitative Ebene hob.Einführung 7
Manche Abschnitte sind jedoch auch gänzlich neu geschaffen
worden, etwa Teile des Credo, das Bach mit »Symbolum Nicenum«
überschrieb und wohl von vornherein als zusammenhängende
Satzfolge entworfen hatte.
Autograph der ersten Seite des Credo
Die Originalpartitur, die Bach gegen Ende seines Lebens fertig-
stellte, besteht aus vier verschiedenen Abteilungen, die jeweils
für sich eine Einheit bilden: Kyrie-Gloria, Symbolum Nicenum,
Sanctus sowie die abschließenden Sätze Osanna, Benedictus,
Agnus Dei und Dona nobis pacem. Sie besitzen je ein eigenes Ti-
telblatt und dokumentieren auf diese Weise den inkonsistenten
Entstehungsprozess. Dadurch aber, dass Bach das gesamte Noten-
material zu einer Sammlung zusammengefügt hat, dürfte seine
grundsätzliche Intention, ein Ganzes von großen, ja riesenhaften
Dimensionen zu schaffen, außer Frage stehen.8 Einführung
Nach Johann Sebastian Bachs Tod gelangte die handschriftliche
Partitur in den Besitz seines zweitältesten, hoch angesehenen
Sohnes Carl Philipp Emanuel. Nach dessen Ableben 1788 sollte
sie nach Möglichkeit jemandem, der den Wert der Manuskripte zu
schätzen weiß, zur Aufbewahrung übereignet werden – wohl auch
mit dem Ziel, dass dem Werk eines Tages der Weg in die Öffent-
lichkeit geebnet wird. Carl Philipp Emanuel selbst hatte 1786 das
Credo für eine Aufführung in Hamburg bearbeitet, um zumindest
einen Teil der Messe zu präsentieren, der schon damals der Ruf
vorausging, eine ganz außergewöhnliche Komposition zu sein.
Zunächst bestand jedoch an der Handschrift kein Interesse. Erst
1805 erwarb der Schweizer Musikgelehrte Hans Georg Nägeli die
Noten. Der Züricher Schriftsteller, Komponist und Verleger plante
eine Veröffentlichung des Werkes in Gestalt einer Druckausgabe –
ein Vorhaben, das er über viele Jahre engagiert vorantrieb. An-
lässlich eines Aufrufs, Unterstützer und Käufer für seine Edition zu
finden, gab Nägeli der Messe in h-Moll, obwohl sie bis dato noch
nie erklungen war, ein euphorisches, geradezu überschwängli-
ches Urteil mit auf den Weg: Bei Bachs Komposition handele es
sich um nichts Geringeres als das »größte musikalische Kunstwerk
aller Zeiten und Völker«.
Obwohl man mit Superlativen generell vorsichtig sein sollte, um
andere, ebenfalls herausragende Werke nicht von vornherein zu
entwerten, hat sich seine Einschätzung – wenigstens in der Ten-
denz – als richtig erwiesen. Dies wirkt umso erstaunlicher, da er
und seine Zeitgenossen eine allenfalls ungefähre Vorstellung von
Bachs Komposition (und seinem Œuvre überhaupt) entwickelt
haben konnten; für eine umfassende Kenntnis und Beurteilung
bedurfte es jedoch zumindest einer Aufführung, die freilich noch
einige Jahre auf sich warten lassen sollte.
Von Nägelis Sachverstand im Hinblick auf Bachs Musik im Allge-
meinen und die Messe in h-Moll im Speziellen zeugen auch fol-
gende Formulierungen, die er seinem Aufruf zur Drucklegung
beigab: »Der über alle Vergleichung große Johann Sebastian Bach
hat nun in unserm Zeitalter eine Anerkennung gefunden, die es
möglich macht, zur Herausgabe desjenigen Werks zu schreiten,
das schon an Inhalt und Umfang, überhaupt aber an Größe des
Styls und Reichtum der Erfindung seine bisher gedruckten noch
eben so weit übertrifft, als diese, abgesehen von Zeitgeschmack
und Zufälligkeit der Kunstformen, diejenigen aller anderen Com-
ponisten übertreffen. Es ist dieß eine Fünfstimmige Missa mit
vollem Orchester […] In technischer Hinsicht enthält dieselbe in
sieben und zwanzig […] Sätzen alle Arten der contrapunctischen
Kunst in der an Bach immer bewunderten Vollkommenheit.«Einführung 9
Trotz aller Bemühungen um eine auf den erhaltenen Quellen
basierende Ausgabe kam der Druck von Partitur und Stimmen
jedoch zunächst nicht zustande – erst 1845, nach Nägelis Tod,
konnte die gesamte Messe veröffentlicht werden, während Kyrie
und Gloria bereits 1833 erschienen waren.
Hans Georg Nägeli
Bemerkenswert ist der Titel des Erstdruckes: Bachs Werk wurde da-
rin als »Hohe Messe« bezeichnet – ein deutliches Zeichen für die
enorme Wertschätzung, die man dieser in der Tat singulären Kom-
position entgegenbrachte. Zugleich wollten die Herausgeber da-
mit offenbar eine gewisse Nähe zu Beethovens Missa solemnis zum
Ausdruck bringen, die ähnlich monolithisch in der abendländischen
Musikgeschichte dasteht und eine ebenso große Expressivität und
Wirkung besitzt. Für eine inhaltliche Verbindung dieser beiden
Gipfelwerke spricht auch die Tatsache, dass Beethoven sich eine
Partiturabschrift von Bachs Messe zukommen ließ, um Tonsatz und
Instrumentation ausgiebig studieren zu können: Dass die daraus
gewonnenen Erkenntnisse sich in Beethovens eigener, zu Beginn
der 1820er-Jahre entstandener großangelegter Messkomposition
niedergeschlagen haben, ist jedenfalls allenthalben spürbar. Des-
gleichen hat sich seit den Zeiten Nägelis an der Bewunderung für10 Einführung
die »große catholische Messe« – mit dieser Bezeichnung wurde
nach dem Tod Carl Philipp Emanuel Bachs in dessen Nachlassver-
zeichnis das Werk seines Vaters versehen – im Grunde nichts geän-
dert: Vielen gilt das Werk als Bachs bedeutsamstes überhaupt und
zugleich als »Nonplusultra« der Chorliteratur.
Johann Sebastian Bach 1746
Der Grund dafür liegt vor allem in der wahrhaft staunenswerten
Kunstfertigkeit und stilistischen Vielfalt, die in der h-Moll-Messe
verwirklicht ist. Kompositionstechnisch steht das Werk auf einem
denkbar höchsten Niveau – die über lange Jahre erworbene Meis-
terschaft Bachs gelangt hier geradezu demonstrativ zur Erschei-
nung. Zudem wird ein Panorama unterschiedlichster Satzarten
vor dem Hörer ausgebreitet: Die vornehmlich vom späten Bach so
geschätzten Stücke im »stilo antico« stehen neben ausgesprochen
avanciert anmutenden Partien, die deutlich machen, dass Bach sehr
wohl die zeitgenössische Kirchenmusik aus dem zweiten Viertel des
18. Jahrhunderts (etwa diejenige des frühverstorbenen Giovanni
Battista Pergolesi) rezipiert hat. Einzelne Sätze – insbesondere das
»Et incarnatus est« und das »Crucifixus« im Credo – sind von einer
bemerkenswerten harmonischen Kühnheit und immensen Aus-Einführung 11
druckskraft, andere Teile wiederum gemahnen an die Kunst der
Alten Meister aus dem Zeitalter der Renaissance.
In ihrem originellen Nebeneinander von Traditionellem und Moder-
nem stellt sich die Messe in h-Moll keineswegs als ein Werk der Rück-
schau, sondern eher der Zusammenführung sehr unterschiedlicher
Entwicklungslinien und Tendenzen dar – zuweilen wirkt sie gar wie
ein Kompendium des Komponierens. Bachs durchgeformter poly-
phoner Tonsatz ist beeindruckend genug und lässt auf vielfache Wei-
se seine gestalterischen Kompetenzen und seine »Gelehrsamkeit«
erkennen. Der Notentext wirkt jedoch nie trocken nach Art ausge-
klügelter kontrapunktischer Übungen, sondern zeichnet sich stets
durch einen gewissen kreativen »Mehrwert« bzw. »Überschuss« aus.
Hinzu kommen schier überwältigende Klangwirkungen, die Bach
bewusst durch den Einsatz eines vollstimmigen Chores und eines
farbenreichen Instrumentalapparates einkomponiert hat. Bei den
Arien und Duetten schuf er zudem Abwechslung durch die Ver-
wendung charakteristischer Soloinstrumente mit ihren besonde-
ren Timbres und spieltechnischen Möglichkeiten (wie etwa das
Corno da caccia im »Quoniam«, die Violine im »Laudamus te«, die
Oboe d’amore im »Qui sedes« sowie die Flöte im »Domine Deus«
und im »Benedictus«).
In erster Linie aber ist die menschliche Stimme in den Mittelpunkt
gestellt. Den Vokalsolisten haben anspruchsvolle Aufgaben zu
erfüllen, der Chor in beinahe noch höherem Maße. Dadurch, dass
die Chorsätze den deutlich größten Anteil der Partitur einnehmen,
erhält das Werk einen klanglich weiträumigen Charakter und eine
spürbare Monumentalität. Kunstvoll gesetzte fünfstimmige Stücke
stehen neben Abschnitten in »normaler« Vierstimmigkeit, mitunter
greift der Tonsatz aber auch in die Sechsstimmigkeit (im Sanctus)
oder sogar in die Achtstimmigkeit aus (wie im doppelchörig an-
gelegten Osanna).
Worauf es Bach ganz offensichtlich ankam, war die Verwirklichung
eines Ideals von Kirchenmusik – nichts weniger als »Vollkommenheit«
dürfte dabei seine Leitlinie gewesen sein. Die Messe in h-Moll war ihm
Mittel zum Zweck, anhand einer allgemeingültigen, konfessionsüber-
greifenden Textvorlage die ganze Macht und Universalität der Musik
zu zeigen. Mit gutem Recht lässt sich sagen, dass die »große catho-
lische Messe« Bachs Vermächtnis als Komponist ist: Er zieht gleich-
sam Bilanz seines Schaffens, um Gott die höchste Ehre zu geben und
zugleich den Menschen und sich selbst zu beweisen, über welch
ein außergewöhnliches schöpferisches Vermögen er verfügte. Das
Ergebnis war ein gewaltiger musikalischer Bau, der den Interpreten
alles abverlangt und die Hörer in andächtigem Staunen zurücklässt.
Detlef Giese12 Text
Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Messe in h-Moll BWV 232
Kyrie
Coro
Kyrie eleison.
Duetto (Soprano/Soprano)
Christe eleison.
Coro
Kyrie eleison
Gloria
Coro
Gloria in excelsis Deo.
Coro
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Aria (Soprano)
Laudamus te. Benedicimus te.
Adoramus te. Glorificamus te.
Coro
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam.
Duetto (Soprano/Tenore)
Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe altissime.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Coro
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Aria (Alto)
Qui sedes ad dextram Patris, miserere nobis.
Aria (Basso)
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus altissimus, Jesu Christe.
Coro
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.Text 13
Kyrie
Chor
Herr, erbarme dich.
Duett (Sopran/Alt)
Christus, erbarme dich.
Chor
Herr, erbarme dich.
Gloria
Chor
Ehre sei Gott in der Höhe.
Chor
Und auf Erden Friede den Menschen guten Willens.
Arie (Sopran)
Wir loben dich. Wir preisen dich.
Wir beten dich an. Wir verherrlichen dich.
Chor
Wir sagen dir Dank wegen deiner großen Herrlichkeit.
Duett (Sopran/Tenor)
Herr Gott, himmlischer König, allmächtiger Gottvater.
Herr, eingeborener Sohn, erhabener Jesus Christus.
Herr Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters.
Chor
Der du auf dich nimmst die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Der du auf dich nimmst die Sünden der Welt, nimm an unser Gebet.
Arie (Alt)
Der du sitzest zur Rechten des Vaters, erbarme dich unser.
Arie (Bass)
Denn du allein bist heilig.
Du allein bist der Herr. Du allein bist der Höchste, Jesus Christus.
Chor
Mit dem Heiligen Geist, in der Herrlichkeit Gottes, des Vaters.
Amen.14 Text
Credo (Symbolum Nicenum)
Coro
Credo in unum Deum.
Coro
Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Duetto (Sopran/Alto)
Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia secula.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero genitum,
non factum, consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt,
qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Coro
Et incarnatus est de Spiritu sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Coro
Crucufixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Coro
Et resurrexit tertia die secundum scripturas.
Et ascendit in coelum, sedet ad dextram Dei Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cujus regni non erit finis.
Aria (Basso)
Et in Spiritum sanctum, Dominum et vivificantem,
qui ex Patre Filioque procedit,
qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per Prophetas.
Et in unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam.
Coro
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Coro
Et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi.
Amen.Text 15
Credo (Symbolum Nicenum)
Chor
Ich glaube an den einen Gott.
Chor
Ich glaube an den einen Gott.
Den allmächtigen Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde,
alles Sichtbaren und Unsichtbaren.
Duett (Sopran/Alt)
Und an den einen Herrn, Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn,
und geboren aus dem Vater vor aller Zeit.
Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott, vom wahren Gott gezeugt,
nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater,
durch den alles geschaffen ist,
der wegen uns Menschen und wegen unserer Seligkeit
herabgestiegen ist vom Himmel.
Chor
Und Fleisch geworden ist vom Heiligen Geist
aus der Jungfrau Maria, und Mensch geworden ist.
Chor
Gekreuzigt auch für uns unter Pontius Pilatus,
gestorben und begraben worden.
Chor
Und auferstanden am dritten Tag, nach der Schrift.
Und aufgefahren in den Himmel, sitzend zur Rechten des Vaters.
Und wird wiederkehren mit Herrlichkeit,
richten die Lebendigen und die Toten,
seines Reichs wird kein Ende sein.
Arie (Bass)
Und an den heiligen Geist, Herrn und Lebensspender,
der vom Vater wie vom Sohne ausgeht,
der mit dem Vater und Sohne zugleich angebetet und verherrlicht wird,
der gesprochen hat durch die Propheten.
Und an eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche.
Chor
Ich bekenne die eine Taufe zur Vergebung der Sünden.
Chor
Und erwarte die Auferstehung der Toten
und das Leben der kommenden Welt.
Amen.16 Text
Sanctus
Coro
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabbaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria ejus.
Coro
Osanna in excelsis.
Benedictus
Aria (Tenore)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Coro
Osanna in excelsis.
Agnus Dei
Aria (Alto)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Coro
Dona nobis pacem.Text 17
Sanctus
Chor
Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Heerscharen.
Himmel und Erde sind erfüllt von deiner Herrlichkeit.
Chor
Hosanna in der Höhe.
Benedictus
Arie (Tenor)
Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn.
Chor
Hosanna in der Höhe.
Agnus Dei
Arie (Alt)
Lamm Gottes, das du trägst die Sünden der Welt, erbarme dich unser.
Chor
Gib uns Frieden.18 Mitwirkende
Johanna Knauth
Die Sopranistin Johanna Knauth studierte Gesang bei Beatrice Nie-
hoff an der Universität der Künste Berlin und bei Jeanette Favaro-
Reuter an der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. Wichtige
musikalische Impulse erhielt sie auch in den Liedklassen von Eric
Schneider, Alexander Schmalcz und Axel Bauni. Meisterkurse u. a.
bei Christiane Iven, Dame Emma Kirkby, Klesie Kelly, Christiane Oel-
ze und Sibylla Rubens sowie Interpretationskurse u. a. bei Helmuth
Rilling und Hans-Christoph Rademann runden ihre Ausbildung
ab. Stimmlich wird sie derzeit von Margreet Honig in Amsterdam
betreut. Johanna Knauth ist sowohl als Konzertsolistin als auch im
Opern- und Liedbereich tätig. Insbesondere als Interpretin von
Barockmusik hat sie sich bereits einen Namen gemacht. Sie ist
Preisträgerin mehrerer internationaler Wettbewerbe, wie dem »Po-
dium Junger Gesangsolisten« des VDKC, wo sie 2017 den 1. Preis
gewann, dem Telemann-Wettbewerb und dem Bach-Wettbewerb
Greifswald. Beim Giulio-Perotti-Wettbewerb gewann sie 2013 u. a.
den »Sonderpreis für die schönste Sopranstimme«.
Henriette Gödde
Henriette Gödde startet die Saison mit Strawinskys Threni – id
est Lamentationes Jeremiæ prophetæ und dem RIAS Kammer-
chor Berlin und der Kammerakademie Potsdam (Justin Doyle).
Ein weiterer Höhepunkt bildet die erstmalige Zusammenarbeit
mit dem Collegium 1704 (Václav Luks). Mit dem ensemble frau-
enkirche dresden (Matthias Grünert) stehen mehrere Konzerte
bevor. Darüber hinaus freut sich Henriette Gödde sich über die
Aufführung von Bachs Weihnachtsoratorium, u. a. mit dem Dresd-
ner Kreuzchor (Roderich Kreile) im Konzerthaus Berlin. Henriette
Gödde studierte bei Prof. Egbert Junghanns an der HochschuleMitwirkende 19 für Musik Dresden und examinierte mit Auszeichnung. Wichtige Impulse im Genre Lied erhielt sie von KS Prof. Olaf Bär. Als Kon- zertsängerin etabliert sie sich auf nationalen und internationalen Podien. Einladungen renommierter Orchester und Ensembles wie der Akademie für Alte Musik Berlin, der Dresdner Philharmonie, dem Ensemble Modern (Kent Nagano), der Gächinger Kantorei (Helmuth Rilling, Hans-Christoph Rademann), dem Leipziger Gewandhausorchester (Ulf Schirmer), dem Orchestre National de Lyon (Leonard Slatkin), dem Radio Filharmonisch Orkest der Niederlande (Jaap van Zweeden) und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (Riccardo Muti) bereichern ihr künst- lerisches Schaffen. Neben ihrer Konzerttätigkeit gastiert sie immer wieder auf der Opernbühne, so etwa bei den Opernfestspielen St. Margarethen, am Opernhaus Leipzig, am Opernhaus Magdeburg, am Deutschen Nationaltheater Weimar, am Theater Erfurt und bei den Salzburger Festspielen. Eine wachsende Zahl von CD-Aufnahmen dokumen- tiert ihr künstlerisches Schaffen. Henriette Gödde ist u. a. 1. Preisträgerin des Robert-Schumann- Wettbewerbes und erhielt den 1. Preis des Concorso Internazio- nale »Musica Sacra« Rom. Martin Lattke Der Tenor Martin Lattke ist in Pirna/Sachsen geboren und erhielt mit sieben Jahren seine erste Gesangsausbildung. Er war Mit- glied des Thomanerchores Leipzig (1990-1999), Mitbegründer des Leipziger Vokalquintetts Calmus (1999-2006) und Mitglied des ensemble amarcord (2006-2013). Er ist 1. Preisträger meh- rerer internationaler Wettbewerbe und mit amarcord Preisträ- ger des Echo-Klassik 2010 für die CD »Rastlose Liebe« mit Mu- sik der Leipziger Romantik sowie Preisträger des Echo-Klassik
20 Mitwirkende
2012 für die CD »Das Lieben bringt groß Freud!« mit deutschen
Volksliedern.
Nach Abschluss seines Studiums zum Wirtschaftsingenieur stu-
dierte Martin Lattke Operngesang an der ältesten Musikhoch-
schule Deutschlands, der Leipziger Hochschule für Musik und
Theater »Felix Mendelssohn Bartholdy«, bei Prof. Hans-Joachim
Beyer. Sein Repertoire umfasst umfangreiche Ensemble- und
Liedliteratur von der Renaissance bis zur Moderne, Oratorien und
Kantaten, bevorzugt aus dem Schaffen Bachs, sowie Opernlite-
ratur. Konzerttourneen führten Martin Lattke im Rahmen seiner
sängerischen Tätigkeit mittlerweile in über 50 Länder auf allen
Kontinenten der Erde. Höhepunkte seiner bisherigen Sängertä-
tigkeit sind 2010 die Einspielung von Bachs Weihnachtsoratorium
für Decca mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter Leitung
von Riccardo Chailly, 2012 die Einspielung der Matthäuspassion
mit dem Gewandhausorchester Leipzig und 2013 die Einspielung
der Messe in h-Moll mit dem Freiburger Barockorchester unter
Leitung von Georg Christoph Biller auf DVD/Blu-ray. Zahlreiche
weitere CD- und Rundfunkproduktionen dokumentieren seine
künstlerische Arbeit.
Philipp Kaven
Philipp Kaven, Jahrgang 1984, wurde bereits im Rundfunkkin-
derchor Berlin als Knabensopran mit ersten solistischen Aufga-
ben betraut. Er absolvierte sein Studium an der Hochschule für
Musik in Dresden, zunächst bei Christiane Bach-Röhr, anschlie-
ßend in den Meisterklassen von KS Prof. Matthias Henneberg und
KS Prof. Olaf Bär. Dank wertvoller Anregungen für seine Arbeit
aus Meisterkursen bei Peter Schreier, Franz Grundheber, Edith
Wiens, Jorma Hynninen und Klaus Häger nahm er erfolgreich anMitwirkende 21 Wettbewerben teil und wurde Preisträger beim »Podium Junger Gesangssolisten«. Seit 2011 gehört der Bariton dem Collegium Vocale Gent an. Er debütierte mit dem Elias bei der Bachakademie Krasnojarsk und gab den dort Studierenden seinen ersten Meisterkurs. Während seiner Konzerttätigkeit musizierte Philipp Kaven mit namhaften Orchestern wie dem Concertgebouworkest Amsterdam, der Staatskapelle Dresden, der Lautten Compagney Berlin, der Kam- merakademie Potsdam, den Dresdner Philharmonikern, dem Bach-Kollegium Stuttgart und dem Berliner Konzerthausorches- ter. Wichtige Impulse vermittelte dabei besonders die Zusammen- arbeit mit Dirigenten wie Roger Norrington, Raphael Frühbeck de Burgos, Philippe Herreweghe, Hans-Christoph Rademann, Achim Zimmermann und Helmuth Rilling. Sein breit aufgestelltes Repertoire führte ihn an zahlreiche Kon- zertorte Europas wie in das Concertgebouw Amsterdam, nach Belgien, Frankreich, in die Schweiz und nach Polen. In Österreich trat er bei den Salzburger Osterfestspielen und dem Osterfestival Innsbruck auf. In Deutschland gastierte er u. a. in der Semperoper und der Frauenkirche Dresden, in der Alten Oper Frankfurt, in der Philharmonie Köln und im Konzerthaus Berlin. Konzertreisen führten ihn auch nach Chile und Russland. Mit einem Spezialensemble für alte Musik hat Philipp Kaven wäh- rend der Pandemie die Zusammenarbeit mit CD-Aufnahmen von Nicolas Gombert begonnen. Bei seiner Mitwirkung im NDR Vocalen- semble und des MDR stellt er seine Ensemblefähigkeit unter Beweis. Sein Liedrepertoire erweitert er kontinuierlich und gestaltet zu- sammen mit Almut Kaven am Klavier Liederabende. Einem aus- gesuchten Kreis von Schülerinnen und Schülern gibt er schon seit Jahren sein sängerisches Wissen weiter. Im Frühjahr 2022 wird er auf der Europa-Tournee des Collegium Vocale Gent eine Solopar- tie in der Matthäuspassion von Johann Sebastian Bach singen.
22 Mitwirkende
Ensemble Wunderkammer
Das Ensemble Wunderkammer wurde zur Jahreswende 2013/14
von vier Berliner Musikern gegründet und ist der historisch in-
formierten Aufführungspraxis verpflichtet. Im Selbstverständnis
der Alten Musik sind die Werke alter Meister im Unterschied zum
Selbstverständnis der Sinfonieorchester nicht »zeitlos aktuell«,
sondern eine dezidiert vergangene und daher der Rekonstruk-
tion bedürftige Kunst. Gerade im Nachspüren der Entstehungs-
und Aufführungsumstände erlangt die Musik wieder ihre Le-
bendigkeit, spricht die menschliche Erfahrung von Schönheit zu
uns. Diese Musikerfahrung möchte Wunderkammer mit seinem
Publikum teilen, oft geht es dabei neue Verbindungen mit zeitge-
nössischen Kompositionen von Peter Uehling oder literarischen
Texten ein. Uehlings musikalische Untermalungen zum gespro-
chenen Evangelientext der Bach'schen Markuspassion wurden
im Carus Verlag veröffentlicht.
Die CD-Einspielungen des Ensembles sind bei Coviello Classics
erschienen. So liegt dort auch ein Konzertmitschnitt mit Wun-
derkammer und dem Schauspieler Lars Eidinger als Evangelist der
eigenen Version der Markuspassion vor. Im Jahr 2020 erhielt Wun-
derkammer gemeinsam mit dem Dresdener Vokalensemble Ælbgut
einen Opus Klassik für ihre gemeinsame Aufnahme von Bachs Jo-
hannespassion in solistischer Besetzung. Das Ensemble war u. a.
zu Gast bei »Wege durch das Land«, bei den Uckermärkischen
Musikwochen und beim Festival der Batzdorfer Hofkapelle.
2021 ist das Ensemble bei der erstmals stattfindenden »Klang-
landschaft Prignitz« vertreten, 2021 und 2022 ist es mit Projekt-
förderungen vom Berliner Senat bedacht worden.Mitwirkende 23 Berliner Singakademie Die Berliner Singakademie ist einer der bedeutendsten Oratorien- chöre Deutschlands. Mit Aufführungen chorsinfonischer Werke und mit A-cappella-Konzerten gehört sie zu den maßgebenden Musikin- stitutionen der deutschen Hauptstadt. Im November 2019 wurde ihr, gemeinsam mit der Sing-Akademie zu Berlin, die Geschwister-Men- delssohn-Medaille des Berliner Chorverbands verliehen. Die Berliner Singakademie wurde 1963 gegründet. Konzeptionell und künstlerisch steht sie in der Tradition der 1791 von Carl Fried- rich Fasch und Carl Friedrich Zelter gegründeten Sing-Akademie zu Berlin. Infolge der Teilung Berlins musste die alte Sing-Akade- mie ihre Tätigkeit auf den Westteil der Stadt beschränken. Das galt insbesondere nach dem 1961 erfolgten Bau der Berliner Mauer, durch den die Spaltung der Stadt zementiert wurde. In dieser Situation ergriff der Cembalist und Kulturpolitiker Hans Pischner die Initiative zur Neugründung einer Singakademie für den Ostteil Berlins. Die Absicht war, das musikalische Erbe der Oratorienlite- ratur des 18. und 19. Jahrhunderts auch in der DDR zu bewahren und seine Pflege nicht ausschließlich den Kirchenchören sowie den professionellen Chören zu überlassen. Da »bürgerliche« Ver- eine in der DDR nicht zulässig waren, bedurfte der Chor einer in- stitutionellen Anbindung. Hans Pischner, der 1963 Intendant der Deutschen Staatsoper geworden war, ermöglichte es, dass eine Anbindung an dieses Opernhaus zustande kam. Für die Berliner Singakademie war das ein Glücksfall, denn sie konnte nicht nur ihre Proben in den Räumlichkeiten der Staatsoper abhalten, es kam auch zu Patenschaften einiger prominenter, an diesem Haus tätiger Gesangssolisten mit dem Chor. Ferner gelang es Pischner, den damals profiliertesten Chordirigenten der DDR, Helmut Koch, als Direktor – und damit als künstlerischen Leiter – zu gewinnen. Koch übte dieses Amt bis zu seinem Tod 1975 aus. Sein Nachfol-
24 Mitwirkende
ger wurde Dietrich Knothe. 1989 wurde Achim Zimmermann zum
Direktor der Berliner Singakademie berufen.
Seit 1984 finden die meisten Konzerte der Berliner Singakademie im
Konzerthaus Berlin, dem früheren Schauspielhaus am Gendarmen-
markt, statt. Aufführungsorte sind aber auch die Berliner Philharmonie
und ihr Kammermusiksaal, die Nikolaikirche in Berlin-Mitte, die Gethse-
manekirche in Berlin-Prenzlauer Berg und andere.
Von Beginn an nahm neben zahlreichen Werken unterschiedlicher
Komponisten die Musik Johann Sebastian Bachs, Georg Friedrich Hän-
dels und vor allem auch Felix Mendelssohn Bartholdys einen großen
Raum in den Konzertprogrammen des Chores ein. Achim Zimmer-
mann setzt diese Tradition und auch die schon unter seinem Vorgänger
Dietrich Knothe begonnene Pflege der Chormusik des 20. Jahrhun-
derts mit großem Engagement fort. Komponisten wie Honegger, Eisler,
Martinů, Martin oder Britten finden in der Proben- und Konzertarbeit
ihren festen Platz. Darüber hinaus wird auch der zeitgenössischen Mu-
sik Aufmerksamkeit gewidmet. Hinsichtlich der Pflege der Alten Musik
arbeitet die Berliner Singakademie immer häufiger mit Spezialensem-
bles, etwa dem Ensemble Wunderkammer, zusammen. Neben der
Aufführung chorsinfonischer Werke legt der Chor großen Wert darauf,
mindestens einmal im Jahr ein A-cappella-Konzert aufzuführen. Der
Chor tritt in unterschiedlichen Besetzungen auf.
2002 kam das Oratorium Medea in Korinth von Georg Katzer nach ei-
nem Libretto von Christa und Gerhard Wolf zur Uraufführung; zu Ehren
von Georg Katzers 80. Geburtstag fand 2015 eine Wiederaufführung
statt. Im Jahr 2014 wurde Das Glück von Helmut Zapf nach dem gleich-
namigen Gedicht von Friedrich Schiller uraufgeführt. Beides sind Auf-
tragswerke der Berliner Singakademie.
Die Berliner Singakademie gastierte bereits in vielen Ländern: Gast-
spielen in der früheren Sowjetunion, in Polen und der Tschechoslowa-
kei folgten nach 1989 Konzertreisen nach Spanien, Frankreich, Israel,
Schottland, Italien, Japan und Brasilien. Zuletzt gastierte der Chor im
Jahr 2015 in Südafrika (u. a. mit Beethovens Missa solemnis), im Jahr
2017 in Lettland (u. a. mit Mendelssohns Oratorium Paulus), und im
Oktober 2019 mit Brahms' Ein deutsches Requiem, dem Schicksalslied,
sowie einem A-cappella-Programm in Südkoreas Hauptstadt Seoul.
In Berlin arbeitet der Chor mit herausragenden Gesangssolistinnen
und -solisten und nahezu allen großen Orchestern der Stadt zusam-
men. Ständige Partner sind das Konzerthausorchester, das Orchester
der Komischen Oper Berlin sowie die Kammerakademie Potsdam.
Engagements erfolgten durch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin
und durch die Berliner Philharmoniker. Dabei arbeitete der Chor u. a.
mit Dirigenten wie Claudio Abbado, Marek Janowski, Kristjan Järvi,
Vladimir Jurowski, Yakov Kreizberg, Paul Mc Creesh, Kirill Petrenko,Mitwirkende 25 Markus Poschner, Helmuth Rilling, Heinz Rögner, Ainars Rubikis, Kurt Sanderling, Peter Schreier und Ottmar Suitner zusammen. Kooperatio- nen gibt es auch mit anderen Oratorienchören, darunter vor allem mit dem Philharmonischen Chor Berlin. Beide Chöre arbeiten seit 2005 in Abständen bei der Aufführung chorsinfonischer Werke, die einer sehr großen Besetzung bedürfen, zusammen. Achim Zimmermann Achim Zimmermann wurde 1958 in Dippoldiswalde bei Dresden geboren, war von 1969 bis 1977 Mitglied des Dresdner Kreuzchores und studierte an der Musikhochschule »Franz Liszt« in Weimar Chor- und Orchesterdirigieren. Darüber hinaus absolvierte er internationale Dirigierseminare bei Helmuth Rilling in Deutsch- land und in den USA. 1984 wurde Achim Zimmermann Chordirektor der Suhler Phil- harmonie sowie Leiter der Singakademie Suhl. 1989 wählte ihn die Berliner Singakademie als Nachfolger von Dietrich Knothe zu ihremDirektor. Mit diesem in variablen Besetzungen auftretenden Chor gilt seine Aufmerksamkeit der ganzen Breite und Vielfalt des Repertoires. Die Werke Bachs und Mendelssohn Bartholdys so- wie Chorsinfonik und A‑cappella-Literatur der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stehen dabei im Zentrum seiner Arbeit. Von 1991 bis 2001 unterrichtete Achim Zimmermann an der Berli- ner Hochschule für Musik »Hanns Eisler«, von 1993 bis 1998 hatte er hier eine Professur für Chorleitung inne. Seit Januar 2002 leitet er zusätzlich zu seiner Arbeit mit der Berliner Singakademie den Bach-Chor und das Bach-Collegium an der Kaiser-Wilhelm-Ge- dächtniskirche und damit die regelmäßigen Aufführungen der Bach’schen Kirchenkantaten. 2015 wurde er für sein Wirken mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande geehrt.
Unsere Konzertplanung bis Sommer 2022
Gastspiel Dienstag | 1. Februar 2022 · 20 Uhr
Konzerthaus Berlin
Johannes Brahms
zz Ein deutsches Requiem op. 45
cappella academica der Humboldt-Universität zu Berlin
Berliner Singakademie
Leitung: Christiane Silber
Gastspiel Freitag | 4. Februar 2022 · 20 Uhr
Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche Berlin
Johannes Brahms
zz Ein deutsches Requiem op. 45
cappella academica der Humboldt-Universität zu Berlin
Berliner Singakademie
Leitung: Christiane Silber
Abonnementkonzert 3 Dienstag | 12. April 2022 · 20 Uhr
Konzerthaus Berlin
Boris Blacher
zz Der Großinquisitor op. 21
Oratorium für Bariton, Chor und Orchester
nach »Die Brüder Karamasow« von Fjodor Dostojewski
Felix Mendelssohn Bartholdy
zz Christus op. 97
Egbert Junghanns, Bariton
Deutsches Kammerorchester Berlin
Leitung: Achim ZimmermannSonntag | 15. Mai 2022 · 12 Uhr
Körnerpark Neukölln
zz A-cappella-Serenade
Leitung: Achim Zimmermann
Abonnementkonzert 4 Samstag | 18. Juni 2022 · 20 Uhr
Kammermusiksaal Philharmonie
Georg Friedrich Händel
zz Alexander's Feast HWV 75
Ensemble Wunderkammer
Anna Palimina, Sopran
Julian Habermann, Tenor
Andreas Wolf, Bass
Leitung: Achim Zimmermann
Jubiläumskonzert Samstag | 2. Juli 2022 · 16 Uhr
Nikolaikirche Berlin
Werke von Heinrich Schütz und Johann Crüger
zz Zum 400. Jubiläum der Amtseinführung von Johann Crüger
an der Nikolaikirche, als Musiklehrer am Grauen Kloster und als
Berliner Musikdirektor
Leitung: Achim Zimmermann
Saison-Abschluss Dienstag | 5. Juli 2022 · 19.30 Uhr
Friedrich-Bergius-Schule
zz A-cappella-Serenade
Leitung: Achim Zimmermann
Kartenbestellung
• Veranstaltungen im Konzerthaus Tel.: 030 20309 2101
• online: www.berliner-singakademie.de
• per E-Mail: onlineticket@berliner-singakademie.de
• sowie an allen Konzert- und Theaterkassen zzgl. VVKKostenloser Newsletter unter: berliner-singakademie.de/konzertinfo
Herausgeber: Berliner Singakademie • Direktor: Achim Zimmermann
c/o Konzerthaus Berlin • Charlottenstraße 56 • D -10117 Berlin Mitglied im
Bildnachweis: commons.wikimedia.org
V.i.S.d.P.: Thomas Otto
Schutzgebühr: € 3,–Sie können auch lesen