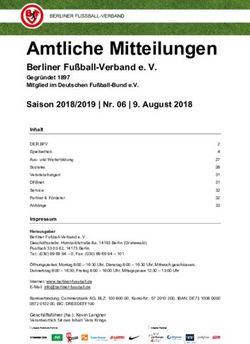Philhar Adam Fischer Rundfunkchor Berlin - Donnerstag 21.10.21 Freitag 01.08.2021, 19 Uhr 22.10.21 - Berliner Philharmoniker
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
moniker
Philhar
Adam Fischer
Rundfunkchor Berlin
Berliner
Donnerstag
21.10.21
Freitag
Freitag
01.08.2021, 19 Uhr
22.10.21
Samstag
Samstag
02.09.2021, 20 Uhr
23.10.21
Sonntag
03.09.2021, 20 UhrGroßer Saal Donnerstag, 21.10.21, 20 Uhr Freitag, 22.10.21, 20 Uhr Samstag, 23.10.21, 19 Uhr Berliner Philharmoniker Adam Fischer Dirigent Rundfunkchor Berlin Benjamin Goodson Einstudierung Kirill Petrenko Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Berliner P hilharmoniker Andrea Zietzschmann Intendantin der Stiftung Berliner Philharmoniker
Inhalt Wolfgang Amadeus Mozart (1756−1791)
Symphonie Nr. 33 B-Dur KV 319
Werkeinführungen4 1. Allegro assai
»Ein gewisses Sehnen, welches nie14 2. Andante moderato
befriediget wird« 3. Menuetto – Trio
Mozart zwischen Salzburg und Wien 4. Allegro assai
An der Grenze zum Schock 22 Dauer: ca. 20 Min.
Haydn und die Pauke
Gesangstexte24 Kyrie d-Moll KV 341
Die Berliner Philharmoniker26
Adam Fischer 30 für Chor und Orchester
Rundfunkchor Berlin 32 Andante maestoso
Dauer: ca. 7 Min.
Pause
Joseph Haydn (1732−1809)
Der Sturm
für Chor und Orchester Hob. XXIVa:8
Dauer: ca. 10 Min.
Symphonie Nr. 103 Es-Dur
»Mit dem Paukenwirbel«
Das Konzert am 23.10.21 Fotoaufnahmen, Die Auftritte der Berliner
wird live in der Digital Bild- und Tonaufzeich Philharmoniker mit 1. Adagio – Allegro con spirito
Concert Hall übertragen nungen sind nicht reduzierten Sitzabstän- 2. Andante più tosto allegretto
und wenige Tage später gestattet. Bitte schalten den werden ermöglicht 3. Menuetto – Trio
als Mitschnitt im Archiv Sie vor dem Konzert durch regelmäßige PCR-
veröffentlicht. Ihre Mobiltelefone aus. Testungen. Wir danken 4. Finale: Allegro con spirito
digitalconcerthall.com dafür unserem Partner Dauer: ca. 30 Min.
Centogene.
Die Stiftung Berliner
Philharmoniker
wird gefördert durch:
2 Saison 2021/22 3 ProgrammWolfgang Amadeus Mozart
Symphonie Nr. 33
Als Wolfgang Amadeus Mozart im Alter von 23 Jahren
seine Symphonie Nr. 33 vollendete, lag – rein statistisch
betrachtet – der Hauptteil seines symphonischen Ge-
samtwerks bereits hinter ihm. In den Jahren danach schuf
er nur noch wenige Symphonien: Aber was für welche!
Dies hängt offenbar mit der Abkehr von seiner Heimat-
stadt Salzburg zusammen, die auch Ort seiner ersten
festen Anstellung als Konzertmeister der Salzburger Hof-
kapelle war. Sein letztes Lebensjahrzehnt verbrachte
Mozart als freischaffender Künstler in Wien und widmete
sich vor allem der Oper, dem Singspiel und dem Klavier-
konzert.
Symphonien hatten damals unterschied
lichste Funktionen, von der Tafelmusik bis zur
Opernouvertüre.
Die Symphonie Nr. 33 ist jedenfalls beides: ein Salz-
burger und ein Wiener Werk. Denn Mozart komponierte
die ersten drei Sätze im Juli 1779 in Salzburg und ergänz- Wolfgang Amadeus Mozart, Gemälde von Joseph Grassi, 1785
te sie erst in Wien um ein parodistisch angeschrägtes
Menuett zur Viersätzigkeit. In dieser Endfassung e rschien
die Symphonie 1785 beim Wiener Verlagshaus Artaria als
eine von insgesamt nur drei Symphonien, die zu Mozarts
Lebzeiten gedruckt wurden. Es ist heute nicht bekannt,
für welche Gelegenheit und welchen Auftraggeber
Mozart sein Werk geschrieben hat. Symphonien k onnten
seinerzeit als Tafelmusik bei Hof oder einer privaten
Festivität gespielt werden, als »Sinfonia« am Beginn einer
Oper oder einer Schauspielmusik und sogar im Gottes-
dienst. Das Besondere an Mozarts Musik ist, dass sie sich
nicht eindeutig zuordnen lässt, dass sie sich zwischen
diesen gesellschaftlichen Schauplätzen ebenso bewegt
wie zwischen säkularer und sakraler Bestimmung. Sie
klingt einerseits wie eine auskomponierte Fanfare oder
Intrada, versteht sich andererseits aber auch auf den
ehrwürdigen kontrapunktischen »Kirchenstyl«.
4 Saison 2021/22 5 WerkeinführungenEine Eigenart, beinah ein Spleen der Symphonie
Nr. 33 ist der Hang ihres Komponisten, alles noch- und
Wolfgang Amadeus Mozart
nochmal zu sagen, also eine auffallende Neigung zu Kyrie d-Moll KV 341
Refrains und Erkennungsmelodien. Außerdem tritt in
jedem der vier Sätze, teils offen, teils versteckt, ein Vier-
tonmotiv in Erscheinung, das eigentlich eine Art Motto
aus der katholischen Kirchenmusik ist, nämlich aus dem
sonntäglichen Vesperhymnus Lucis creator optime.
Mozart verarbeitet das gleiche Motiv in seiner ersten
und seiner letzten Symphonie. Was ist das: eine Signatur,
eine Losung, ein magischer Spruch? Die geheimnisvolle Was sollen wir glauben? Die Entstehung von Mozarts
Mozart-Formel, eins – zwei – vier – drei? Oder doch eher Kyrie d-Moll KV 341 umgibt nichts als Zweifel, Unsicher-
ein Zufall, den die Nachwelt zum Zeichen erklärt? heit, offene Fragen und Rätsel. Lange Zeit war dieser
einzeln überlieferte Satz als »Münchner Kyrie« bekannt,
da Musikhistoriker vermuteten, das Werk sei 1781 in den
Wochen nach der Premiere von Mozarts Oper Idome-
Entstehungszeit neo am bayerischen Hof entstanden. Hört man das Kyrie,
1779 zunächst in einer dreisätzigen Fassung, meint man eine Nähe zu diesem düsteren Antikendrama
Menuett 1782 zu erkennen: zu seiner unheilvollen Sphäre von Schwur
Uraufführung und Orakel, Götterzorn und Kindesopfer. Heute jedoch
nicht nachgewiesen ordnet die Forschung das Werk Mozarts späten Wiener
Jahren um 1790 zu und versteht es als folgenlos geblie-
Bei den Berliner Philharmonikern benen Beginn einer monumentalen, nie vollendeten
erstmals am 8. April 1938, Dirigent: Herbert von Missa solemnis – einer großen, feierlichen Messe –, die
Karajan. Zuletzt Anfang März 2013 in drei Konzerten von Mozarts Kyrie theatralisch eröffnet worden wäre.
unter der Leitung von Andris Nelsons
Als Domkapellmeister hätte Mozart
statt der Zauberflöte Messen, Hymnen
und Offertorien hinterlassen.
Fakt ist: Nicht lange vor Mozarts Tod hatte der Magistrat
der Stadt Wien dem Komponisten – auf dessen eigenes
Ansuchen – das Amt des Domkapellmeisters an St. Ste-
phan in Aussicht gestellt. Es dürfte wohl den meisten von
uns schwerfallen, sich den freigeistigen, genussfreudigen,
mit einem geradezu dadaistischen Humor gesegneten
Künstler, den bekennenden Freimaurer, den Gast lite-
rarischer Salons, den Komponisten der Così fan tutte in
Amt und Würden eines Domkapellmeisters vorzustellen.
Mozart schwört der Zauberflöte ab und schreibt fortan
nur noch Messen, Hymnen, Offertorien und Lamentatio-
nen? Doch schon der erste Mozart-Biograf Franz Xaver
Niemetschek klärte seine Leserinnen und Leser auf, dass
die Kirchenmusik des Meisters »Lieblingsfach« gewesen
sei, dem er sich nur leider kaum habe widmen können:
6 Saison 2021/22 7 WerkeinführungenJoseph Haydn
Der Sturm
Im London des späten 18. Jahrhunderts, in den damals
berühmten Hanover Square Rooms, richtete der deut-
sche Geiger und Impresario Johann Peter Salomon
Subskriptionskonzerte aus, die freitags um zwanzig Uhr
anfingen und meist erst nach Mitternacht endeten. Im
Wettstreit um die Gunst des Publikums wollte Salomon
mit einem veritablen Star vom Kontinent auftrumpfen.
Und tatsächlich gelang es ihm, den lange erwarteten Jo-
seph Haydn für ein exklusives Gastspiel in der britischen
Hauptstadt zu gewinnen.
Haydn wurde in England für die Größe und Erha-
benheit seiner Musik bewundert. Insbesondere der Chor-
satz Der Sturm, der am 24. Februar 1792 uraufgeführt
Wolfgang Amadeus Mozart, Gemälde von Johann wurde, kam der Vorliebe des englischen Publikums für
Georg Edlinger, ca. 1790 »delightful horror« sehr entgegen: mit seinen plastischen
Schilderungen von heulenden Winden, krachenden Don-
nern und der Fürbitte der Menschen um V erschonung.
»Mozart würde in diesem Fache der Kunst seine ganze
Stärke erst gezeigt haben, wenn er die Stelle bey St. Ste-
phan wirklich angetreten hätte; er freute sich auch sehr »Ich muste schon 6 mahl ausspeisen, und
darauf.« Sein früher Tod verhinderte dies jedoch. könte wenn ich wolte täglich eingeladen seyn,
allein ich mus erstens auf meine Gesundheit,
Entstehungszeit und 2tens auf meine arbeith sehen.«
vermutlich 1787–1791 Joseph Haydn in einem Brief aus London vom Januar 1791
Uraufführung
nicht nachgewiesen Musikalisch orientierte sich Haydn einerseits an den
Seestürmen, Höllenfahrten und Furientänzen der Oper.
Bei den Berliner Philharmonikern Andererseits wechselte er für die Gebete ins geistliche
erstmalig am 21. April 1967, Dirigent: Eugen Jochum Fach, in einen andächtigen, empfindsamen Ton, ähnlich
mit dem RIAS-Kammerchor. Zuletzt bei den Osterfest- den Hymnen der anglikanischen Kirche. Bezüglich des
spielen in Salzburg im April 2000 unter der Leitung Librettos hieß es bei der Uraufführung: »The words by an
von Claudio Abbado mit dem Schwedischen Rund- eminent English author«. Hinter dieser mysteriösen An-
funkchor kündigung verbarg sich John Wolcot, der als gefürchteter
Satiriker viele Zeitgenossen bis hinauf zum König vor den
Kopf gestoßen hatte und deshalb besser unerkannt blieb.
8 Saison 2021/22 9 WerkeinführungenJoseph Haydn
Symphonie Nr. 103
»Mit dem Paukenwirbel«
Auch die Symphonie Nr. 103 schrieb Haydn für ein
Gastspiel in London, in diesem Fall für die Opera Con-
certs des italienischen Geigers Giovanni Battista Viotti.
Er verblüffte das Publikum der Uraufführung, die am
2. März 1795 im King’s Theatre stattfand, mit einem Solo
der Pauke gleich zu Beginn, womit die Pauke im wahrs-
ten Sinne des Wortes für einen riesen Wirbel sorgte.
Dieser außergewöhnliche Anfang, so teilte der Morning
Chronicle mit, habe die »größte Aufmerksamkeit« erregt.
Joseph Haydn auf dem Weg nach England 1791/92. Bildpostkarte nach einem Da sich weder in Haydns Autograf noch in dem von ihm
unbezeichneten Gemälde, koloriert, um 1890 autorisierten Stimmenmaterial der Uraufführung irgend-
eine dynamische Anweisung für diesen berühmten
ersten Takt der Symphonie finden lässt, schlägt hier die
Zurück in Wien bearbeitete Haydn das Werk für den Stunde der Interpreten. Eine zeitgenössische Bearbei-
deutschsprachigen Markt. Im März 1793 wurde es tung für Klaviertrio sieht ein Crescendo und anschlie-
erstmal in seiner Muttersprache aufgeführt. Durch die ßendes Diminuendo vor, während ein Arrangement für
nachträgliche Besetzung mit Klarinetten und Posaunen Klavierquintett einen direkten Fortissimo-Einsatz anzeigt.
gewann Haydns Sturmgemälde nochmals an Farbig- Weil Haydn das Paukensolo mit dem Wort »Intrada«
keit und Tiefe. bezeichnete und damit in die Nähe einer traditionellen
Eröffnungs- und Aufzugsmusik rückte, ist überdies die
Möglichkeit einer fanfarenartigen rhythmischen Improvi-
sation erörtert (und erprobt) worden.
Entstehungszeit
1792
Uraufführung »Meine anckunft verursachte grosses auf
24. Februar 1792 sehen durch die ganze stadt durch 3 Tag wurd
Bei den Berliner Philharmonikern
erst- und letztmalig am 18. Januar 1884 im Saal der
ich in allen zeitungen herumgetragen: jeder
Sing-Akademie unter der Leitung von Joseph Joachim man ist begierig mich zu kennen.«
mit dem Chor der Königlichen Hochschule für Musik Joseph Haydn in einem Brief aus London vom Januar 1791
Doch nicht wegen des Paukenwirbels allein ver-
dient die langsame Introduktion der Symphonie Nr. 103
die »größte Aufmerksamkeit«. In dem dunkel raunenden,
metrisch unbestimmten Unisono der Fagotte, Celli und
Kontrabässe zeichnet sich eine melodische Linie ab,
10 Saison 2021/22 11 Werkeinführungenderen Anfangstöne unverkennbar die Dies Irae-Sequenz
der lateinischen Totenmesse heraufbeschwören – eine
unheilvolle Einleitung zu einem so festlichen Ereignis wie
der Aufführung einer großen Symphonie in einem öffent
lichen Konzert. Und welch ein Kontrast zu dem tänzerisch
beschwingten Hauptthema des folgenden Allegro con
spirito. Doch der Schein unbeschwerter Ausgelassenheit
trügt, denn der Kopfsatz wirkt wie überschattet von der
»Grabesmusik« der vorangestellten Adagio-Takte, und
das unheilverkündende Dies Irae-Motiv greift als eine
beunruhigende, untergründig lenkende Instanz immer
wieder in das Geschehen an der heiteren Oberfläche ein.
Haydns Symphonie Nr. 103 wird als »Volkslied-Sym-
phonie« betrachtet: Die Variationen des Andante più
tosto allegretto basieren auf Melodien aus dem ost-
europäischen Raum, deren kroatischer oder ungarischer
Ursprung sich nicht mehr eindeutig rekonstruieren lässt;
das Menuett nimmt mit stilisierten Jodelrufen die alpen-
ländische Musikkultur auf; das Thema des Finales geht
auf ein altes kroatisches Volkslied zurück.
Entstehungszeit
1795
Uraufführung
2. März 1795 im King’s Theatre, London
Bei den Berliner Philharmonikern
erstmals am 19. Oktober 1885; Dirigent: Joseph
Joseph Haydn, 1795 im Jahr der Uraufführung
Joachim. Zuletzt Ende Oktober 2015 unter der Leitung
seiner Symphonie »Mit dem Paukenwirbel«. von Giovanni Antonini
Kupferstich nach dem Gemälde von John Hoppner
12 Saison 2021/22 13 Werkeinführungen»Ein gewisses Sehnen, welches
nie befriediget wird«
Mozart zwischen Salzburg und Wien
Die Kuppel des
Salzburger Doms
Wolfgang Amadeus Mozart war ein Getriebener.
Als gefeiertes Wunderkind ging er mit sieben Jahren
auf eine Konzertreise durch die deutschen Lande
und Westeuropa, die dreieinhalb Jahre dauerte.
Mit 13 ging es nochmals für dreieinhalb Jahre nach
Italien. Mit knapp 16 trat er seine erste Stellung als
Konzertmeister der Salzburger Hofkapelle an. Er
lernte die Abhängigkeit und die Enge dieser Stelle
zu hassen und wagte mit 25 Jahren den Umzug nach
Wien und den Schritt in die Selbstständigkeit. Seine
Kompositionen spiegeln diesen Umbruch wider, die
Symphonie Nr. 33 ist sowohl in Salzburg als auch
in Wien komponiert worden. War Mozart ein glück
licher Mensch? »Eine gewisse Leere – die mir halt
wehe thut«, wie Mozart kurz vor seinem Tod sagte,
scheint nicht dafür zu sprechen.
14 Saison 2021/22»Ich versichere sie«, schrieb Mozart Militäruniformen antraten und deren
seinem Vater 1778 aus Paris, »ohne Instrumente mit Standarten mit dem
reisen | wenigstens leüte von künsten Wappen des regierenden Fürsterz-
und wissenschaften | ist man wohl bischofs geschmückt waren. Hof-
ein armseeliges geschöpf!« Und in kapellmeister und Hoforganist, der
diesem leicht belehrenden, leicht Konzertmeister, Streicher und Bläser
theatralischen Ton ging es fort: »Ein der »Cammermusik«, die städtischen
Mensch von mittelmässigen Talent Turmbläser, eine stark besetzte Ge-
bleibt immer mittelmässig, er mag neralbassgruppe, die Hofsänger als
reisen oder nicht – aber ein Mensch Solisten, die Domchorvikare, Chor-
von superieuren Talent | welches ich sänger und Kapellknaben vereinten
mir selbst, ohne gottlos zu seyn, nicht sich zu einem laut- und leistungs-
absprechen kan | wird – schlecht, starken Ensemble von über achtzig
wenn er immer in den nemlichen ort Musikern. Diese irdischen Heerscha-
bleibt.« Zumal, wenn der nämliche ren musizierten nicht im kompakten
Ort Salzburg hieß. Aber schließlich Kollektiv, sondern mehrchörig auf
musste Wolfgang Amadeus Mozart die vier Emporen an den Pfeilern der
doch in seine Heimatstadt zurück- Domkuppel und den Hochaltarraum
kehren, im Januar 1779, unglücklich verteilt. Auf dem Prinzipalchor, dem
und widerwillig, wie geschlagen südöstlichen Balkon, saß der Hof-
nach dem Scheitern aller Hoffnun- organist an der Orgel. Im Jahr 1779
gen und Bewerbungen um eine neue war dies Wolfgang Amadeus Mo-
Stelle auf seiner großen Paris-Reise. zart. Räumlich betrachtet unter ihm,
In Salzburg wurde er vom Fürsterz- jedoch hierarchisch gesehen weit
bischof erneut eingestellt und zwar über ihm stand der Fürsterzbischof.
bei Verdreifachung des Gehalts, was Mozart sollte ihn zwei Jahre später
ein eindeutiges Zeichen der Wert- gehässig und in ehrlicher Aversion
schätzung war. Zu Mozarts Pflichten als »einen hochmüthigen, eingebil-
gehörte es nun, dass er »den Hof, deten Pfaffen« abtun, nicht zuletzt
und die Kirche nach Möglichkeit mit um den endgültigen Bruch mit dem
neüen von Ihme verfertigten Kompo- Salzburger Hof vor sich und seinem
sitionen bedienne«. Vater zu rechtfertigen.
Hieronymus Graf Colloredo, Fürsterzbischof von Salzburg. Salzburg und der Fürsterzbischof Was und wo ist Heimat?
Ölgemälde von Franz Xaver König, 1772 In der Person des Salzburger »Wo ist man daheim? Wo man
Fürsterzbischofs vereinte sich geist- geboren wurde oder wo man zu
liche und weltliche Souveränität, sterben wünscht?«, fragt Carl Zuck-
da er als Fürsterzbischof nicht nur mayer am Beginn seiner Lebens-
seiner Glaubensgemeinde vorstand, erinnerungen. Ob Mozart in Wien
sondern allen Bewohnern auch als zu sterben wünschte, wäre eine
Landesherr. Er verkörperte somit ziemlich hypothetische Überlegung
die doppelte, kaiserlich-katholische für einen Mann von Mitte Dreißig.
Herrlichkeit und wurde mit privile- Zweifellos aber wollte er dort leben,
giertem musikalischem »Lärm« emp- in der habsburgischen Metropole,
fangen, wenn er im Dom die Messe nachdem er 1781 den Schritt in die
zelebrierte: mit schmetternden Unabhängigkeit von Vater und Fürst
Fanfaren der Hoftrompeter nebst in die Existenz eines »freien Künstlers«
Pauken, die in eleganten schwarzen gewagt hatte. Salzburg hingegen,
16 Saison 2021/22 17 Mozart zwischen Salzburg und Wienwo er geboren war, sich aber nicht zu so müsste ich mich fast schämen. –
Hause fühlte, konnte er zuletzt kaum es ist alles kalt für mich – eiskalt.« Der
noch ertragen: »Kein ort für mein schroffe Künstlerstolz, das äußerst
Talent!« Und warum? »Erstens sind empfindliche Ehrgefühl, das bis zur
die leüte von der Musick in keinen an- Arroganz gesteigerte Selbstbe-
sehen, und zweytens hört man nichts; wusstsein dokumentieren Mozarts
es ist kein Theater da, keine opera!« Identitätskrise.
Weiter schimpfte er hemmungslos
über die »grobe, lumpenhafte und Wien als künstlerische Heimat
liederliche HofMusique«, also das Mozarts
Salzburger Orchester, dem er selbst »Ich versichere sie, daß hier
einige Jahre als Geiger und Konzert- ein Herrlicher ort ist – und für mein
meister angehört hatte. Metier der beste ort von der Welt«,
schwärmte Mozart in einem Brief aus
Die Heimat in sich selbst Wien an seinen Vater in Salzburg.
Die Geschichte jenes Wunders,
»welches Gott in Salzburg hat lassen
gebohren werden« – so Leopold
»Ich versichere sie,
Mozart über seinen Sohn –, verrät die daß Wien ein
Schattenseiten einer auf Konzertpo- Herrlicher ort ist –
dien und in Adelspalästen verbrach- Wohnhaus der Familie Mozart in der Getreidegasse in Salzburg.
ten Kindheit. Denn es scheint, als und für mein Metier Stahlstich, koloriert, um 1830
habe der sehr frühe Ruhm des Kindes der beste ort von
Mozart das spätere Dasein vergiftet.
Und der erwachsene Mozart musste
der Welt.«
zu seiner Ernüchterung bemerken, Wolfgang Amadeus Mozart
dass die Verehrer von einst dem
älteren Musiker kaum einen Bruchteil Sein »Heimatgefühl« war zuallererst,
der ursprünglichen Aufmerksamkeit ja ausschließlich professionell be-
schenkten. gründet: ein Reflex der künstlerischen
Erfolge, der Aufträge und Auftritte,
»Wenn die leute die er verbuchen oder wenigstens
erhoffen durfte. Und Wien bot als
in mein herz sehen Hotspot der besten Sängerinnen und
könnten, so müsste Virtuosen, mit seiner internationalen
Theaterszene, den Akademien, dem
ich mich fast Instrumentenbau und Verlagswesen,
schämen. – es ist den adligen Mäzenen und bürger-
lichen Musikenthusiasten einem zu-
alles kalt für mich – gereisten Komponisten aus Salzburg
eiskalt.« tatsächlich »herrliche« Aussichten,
Wolfgang Amadeus Mozart die Mozart zu nutzen verstand.
Ein untergründiges Gefühl von Ent- Salzburg in Mozarts Musik
täuschung und Fremdheit in der Welt Die Salzburger haben sich da-
begleitete Mozart bis ans Ende sei- mit abfinden müssen, dass ihre nach-
ner knapp bemessenen Tage: »wenn getragene Liebe zum berühmtesten
die leute in mein herz sehen könnten, »Sohn der Stadt« nicht auf Gegen-
18 Saison 2021/22 19 Mozart zwischen Salzburg und Wienseitigkeit beruhte. Heute ist Mozart Wo ist man also zu Hause? Im
in seinem Geburtsort in sämtlichen schlechtesten Fall nirgendwo, wie es
Erscheinungsformen der Verehrung bei Mozart der Fall gewesen zu sein
und Vermarktung allgegenwärtig – scheint. »Ich kann Dir meine Emp-
von der Kunst bis zur Kugel. Zwischen findungen nicht erklären, es ist eine
Getreidegasse und Robinighof, zwi- gewisse Leere – die mir halt wehe
schen Tanzmeisterhaus und Residenz thut, – ein gewisses Sehnen, welches
wandelt man fast wie von selbst auf nie befriediget wird, folglich nie auf-
Mozarts Spuren. hört – immer fortdauert, ja von Tag
zu Tag wächst«, schrieb Mozart in
Mozart ist heute einem Brief an seine Frau im Sommer
1791, wenige Monate, bevor er in
in Salzburg in Wien starb.
sämtlichen Erschei-
Wolfgang Stähr
nungsformen der
Verehrung und
Vermarktung prä-
sent – von der Kunst
bis zur Kugel.
Aber finden sich auch umgekehrt
Salzburger Spuren in Mozarts Musik?
Verraten etwa die in Salzburg kom-
ponierten Symphonien eine mehr
als nur zufällige Beziehung zum Ort
ihrer Entstehung? Der Schriftsteller
Stefan Zweig mochte es nicht als
Zufall gelten lassen, »daß gerade
der heiterste, der beweglichste, der
anpassungsfähigste, der beschwing-
teste aller Musiker, daß Mozart hier
geboren war. Die leichte Luft, die An-
mut der Lustgärten, das verschnör-
Der Stephansdom in Wien, Stich, 1724. Nicht weit davon entfernt kelte Barock der Bischofsbauten und
wohnte Mozart im »Figarohaus« von September 1784 bis April 1787 gleichzeitig die ewige Großartigkeit
der Landschaft, Mozart hat sie zur
ewigen Harmonie erhoben. Auf
welche Art – das ist sein unnachahm-
liches Geheimnis.« Dieser Gedanken
gang wirkt ebenso sympathisch
wie spekulativ, und man käme sich
nachgerade wie ein Spielverderber
vor, wenn man ihm widersprechen
wollte.
20 Saison 2021/22 21 Mozart zwischen Salzburg und WienAn der Grenze zum Schock Die Pauke nimmt in Haydns symphonischen Schaffen
Haydn und die Pauke eine Sonderstellung ein. Warum? Weil sie immer
mal wieder kräftig und unerwartet die Musik und
das Publikum aufwirbeln darf. Sie vermag es nicht
nur, die Zuhörenden aus ihren Sitzen aufzuschrecken,
sondern auch kriegerische Auseinandersetzungen
in den Konzertsaal zu holen. Musikalische Überra-
schungseffekte? Sicherlich. Aber nicht nur.
Noch vor der Symphonie Nr. 103 Österreich in wechselnden Koalitio-
»Mit dem Paukenwirbel« hatte nen gegen das revolutionäre Frank-
Joseph Haydn für das Londoner Pu- reich führte. Im zur Kompositionszeit
blikum seine Symphonie Nr. 94 »Mit aktuellen oberitalienischen Feldzug
dem Paukenschlag« komponiert. brachte General Napoléon Bona-
So heißt sie im deutschsprachigen parte den Österreichern eine Nie-
Raum, allerdings etwas unpräzise. derlage nach der anderen bei. Der
Denn auch alle anderen Instrumente Schlachtenlärm und das Anrücken
beteiligen sich lautstark am Überra- der feindlichen Truppen drang sogar
schungscoup, den diese Symphonie bis in den weihnachtlichen Frieden
zu Beginn des 2. Satzes bereithält, der Wiener Festgesellschaft, die sich
wenn nach einer leisen, lieblichen am 26. Dezember 1796 in der Kirche
Melodie das komplette Orchester Maria Treu versammelt hatte, um
plötzlich im Fortissimo losschlägt. In Haydns neue Messe das erste Mal
England wurde das Werk deshalb zu hören. Zum Erstaunen oder zum
mit dem programmatischen Titel Entsetzen der Anwesenden – man
»The Surprise« (Die Überraschung) weiß es heute nicht mehr – erklang
bedacht. Im Auditorium der Hano- im abschließenden Agnus Dei der
ver Square Rooms mag tatsächlich Trommelrhythmus der französischen
der eine oder die andere im ersten Armee, zuerst wie aus der Ferne,
Schreck vom Sitz aufgefahren sein – dann im bedrohlichen Crescendo
selbst von einer Ohnmacht wurde auf der Pauke geschlagen.
berichtet. Haydns Paukenschläge b oten
Ein anderes Werk, in dem die also immer mehr als nur einen
Pauke eine prominente Stellung originellen Effekt. Sie berührten die
einnimmt, ist die »Paukenmesse«, die Grenze zum Schock, zur Gefahr, zur
Haydn selbst »Missa in tempore belli« Gewalt und zum jähen Ende und
nannte. Der Titel »Messe in Zeiten machten Musik auf ungewohnt physi-
Der sechsjährige Haydn, April 1738. Holzstich nach einer des Krieges« verweist auf die kriege- sche Art erlebbar.
Zeichnung von Paul Thumann, spätere Kolorierung, 1878 rischen Auseinandersetzungen, die
22 Saison 2021/22 23 Haydn und die PaukeWolfgang Amadeus Mozart
Kyrie
Kyrie eleison, Herr, erbarme dich unser,
Christe eleison, Christus, erbarme dich unser,
Kyrie eleison. Herr, erbarme dich unser.
Frank Peter Zimmermann – eine musikalische
Freundschaft
Joseph Haydn
Der Sturm Frank Peter Zimmermann zählt zu den langjährigen Weggefährten der Berliner Philharmoniker,
die in der Zusammenarbeit immer wieder besondere Impulse setzen und anregende Perspektiven
eröffnen. Seine Auftritte knüpfen einen roten Faden zwischen Generationen von Musikerinnen und
Hört! Die Winde furchtbar heulen! Musikern – kaum ein für das Orchester prägender Dirigent dieser Jahre hat nicht mit dem Ausnah-
megeiger zusammengearbeitet.
Tief im finstern Abgrund tobt der Höllen Geist.
Der Donner rollt und kracht und mehrt die Angst. Die exklusive Edition präsentiert nun mit Violinkonzerten von Beethoven, Bartók und Berg vier
Von Wolke flieht zu Wolk’ erschreckt der Mond. herausragende Momentaufnahmen dieser intensiven musikalischen Freundschaft.
Jetzt verlischend und dann blitzend durch die Luft.
Weh’ uns! O sanfte Ruh’, o komm doch wieder.
O komm doch wieder, o sanfte Ruh’!
Deutscher Text von
Gottfried van Swieten
nach der englischen
Originalfassung
von Peter Pindar
(alias John Wolcot)
Berliner Philharmoniker Ludwig van Beethoven Alban Berg Béla Bartók
Frank Peter Zimmermann Konzert für Violine und Konzert für Violine und Konzert für Violine und
Orchester D-Dur op. 61 Orchester »Dem Andenken Orchester Nr. 1 Sz 36
Kadenzen: Fritz Kreisler eines Engels« Konzert für Violine und
2 CD · 1 Blu-ray Daniel Harding Kirill Petrenko Orchester Nr. 2 Sz 112
Alan Gilbert
Jetzt erhältlich unter
berliner-philharmoniker-recordings.com
und im Shop der Philharmonie Berlin
24 Saison 2021/22Die Berliner •Chefdirigent
Kirill Petrenko Christoph von der
Nahmer
Christoph Igelbrink
Solène Kermarrec
Philharmoniker Raimar Orlovsky Stephan Koncz
• Erste Violinen
Noah Bendix-Balgley
Simon Roturier
Bettina Sartorius
Martin Menking
David Riniker
1. Konzertmeister Rachel Schmidt Nikolaus Römisch
Daishin Kashimoto Armin Schubert Dietmar Schwalke
1. Konzertmeister Stephan Schulze Knut Weber
N. N. Christoph Streuli N. N.
1. Konzertmeister*in Eva-Maria Tomasi
Krzysztof Polonek
Konzertmeister
Romano Tommasini
N. N.
• Kontrabässe
Matthew McDonald
Zoltán Almási 1. Solobassist
Maja Avramović
Helena Madoka Berg
• Bratschen
Amihai Grosz
Janne Saksala
1. Solobassist
Simon Bernardini 1. Solobratscher Esko Laine
Alessandro Cappone N. N. Solobassist
Madeleine Carruzzo 1. Solobratsche Martin Heinze
Aline Champion- Naoko Shimizu Michael Karg
Hennecka Solobratscherin Stanisław Pajak
Luiz Felipe Coelho Micha Afkham Peter Riegelbauer
Luis Esnaola Julia Gartemann Edicson Ruiz
Sebastian Heesch Matthew Hunter Gunars Upatnieks
Aleksandar Ivić Ulrich Knörzer Janusz Widzyk
Hande Küden Sebastian Krunnies Ulrich Wolff
Rüdiger Liebermann Walter Küssner
Kotowa Machida
Álvaro Parra
Ignacy Miecznikowski
Martin von der
• Flöten
Mathieu Dufour
Johanna Pichlmair Nahmer Solo
Bastian Schäfer Allan Nilles Emmanuel Pahud
Dorian Xhoxhi Kyoungmin Park Solo
N. N. Joaquín Riquelme Michael Hasel
García Jelka Weber
• Zweite Violinen
Marlene Ito
Martin Stegner
Wolfgang Talirz
Egor Egorkin
Piccolo
1. Stimmführerin
Thomas Timm
1. Stimmführer
• Violoncelli
Bruno Delepelaire
• Oboen
Jonathan Kelly
Christophe Horák 1. Solocellist Solo
Stimmführer Ludwig Quandt Albrecht Mayer
Philipp Bohnen 1. Solocellist Solo
Stanley Dodds Martin Löhr Christoph Hartmann
Cornelia Gartemann Solocellist Andreas Wittmann
Amadeus Heutling Olaf Maninger Dominik Wollenweber
Angelo de Leo Solocellist Englischhorn
Anna Mehlin Rachel Helleur-
Simcock
26 Saison 2021/22 27 Die Berliner Philharmoniker• Klarinetten
Wenzel Fuchs
• Posaunen
Christhard Gössling
• Orchestervorstand
Stefan Dohr
Solo Solo Knut Weber
Andreas Ottensamer Olaf Ott
Solo
Alexander Bader
Solo
Jesper Busk Sørensen
• Medienvorstand
Stanley Dodds
N. N. Thomas Leyendecker Olaf Maninger
Hi-Res Audio
Andraž Golob Stefan Schulz
Bassklarinette Bassposaune • Oimrchestervertretung
Stiftungsrat
• Fagotte
Daniele Damiano
• Tuba
Alexander von
Andreas Wittmann
Martin Stegner
Klang ohne Kompromisse
Solo Puttkamer Vorsitzender des
Stefan Schweigert Personalrats Genießen Sie mit Hi-Res Audio ab sofort die Konzerte der Berliner Philharmoniker in
Solo
Markus Weidmann
• Pauken
Wieland Welzel
Ulrich Knörzer
Stellvertretendes
Studioqualität – unmittelbar, authentisch und ganz ohne Datenverlust. Zusammen mit
dem ultrahochauflösenden Bild unserer 4K-Kameras bieten wir Ihnen das bestmögliche
N. N. N. N. Mitglied audiovisuelle Konzerterlebnis.
Václav Vonášek Julia Gartemann
Kontrafagott • Schlagzeug
Raphael Haeger
Stellvertretendes
Mitglied,
• Hörner
Stefan Dohr
Simon Rössler
Franz Schindlbeck
Mitglied des
Personalrats
Solo Jan Schlichte
N. N. • Fünferrat
Solo
Johannes Lamotke
•Harfe
Marie-Pierre
Philipp Bohnen
Jesper Busk Sørensen
Georg Langlamet Cornelia Gartemann
Schreckenberger Raphael Haeger
Sarah Willis Gast Markus Weidmann
Andrej Žust • Orgel
N. N.
N. N.
Tobias Berndt • Gemeinschaft
der Berliner
Philharmoniker
• Trompeten
Guillaume Jehl
Philipp Bohnen
Klaus Wallendorf
Solo Sarah Willis
N. N.
Solo
Andre Schoch
• Ehrendirigent
Daniel Barenboim verlustfreier Klang in Studioqualität (FLAC)
Tamás Velenczei
N. N. • Dirigenten
unter den
ab sofort in den Mobil-Apps der Digital Concert
Hall und für Apple TV
Ehrenmitgliedern verfügbar für alle Archiv-Konzerte
Bernard Haitink keine Zusatzkosten
Zubin Mehta
Seiji Ozawa
Hi-Res Audio kann dank der Unterstützung und technologischen Beratung von Internet Initiative Japan Inc.
(IIJ), Streaming-Partner der Digital Concert Hall, angeboten werden. Zu einem späteren Zeitpunkt wird
28 Saison 2021/22 Hi-Res Audio auch für die Live-Übertragungen aus der Philharmonie Berlin angeboten.Adam Fischer
»Haydns Musik begleitet mich seit meinem vierten
Lebensjahr«, berichtet Adam Fischer. Damals besuchte
er mit seinem Vater ein Konzert, in dem die Symphonie
»mit dem Paukenschlag« aufgeführt wurde. Er freute sich
so auf den Paukenschlag und war bitter enttäuscht, weil
dieser nicht so laut ausfiel wie erwartet. Als er sich an-
schließend deswegen beim Orchesterleiter beschwerte,
riet ihm dieser: »Werde selbst Dirigent, dann kannst du
bestimmen, wie laut der Schlag sein soll.« Adam Fischer,
der aus einer ungarischen Dirigentenfamilie stammt,
beherzigte diesen Rat. Er studierte in seiner Geburts-
stadt Budapest und an der Wiener Musikhochschule bei
Hans Swarowsky. 1978 gelang ihm mit seiner Aufführung
des Fidelio an der Bayerischen Staatsoper der interna-
tionale Durchbruch. Er hatte Chefpositionen in Freiburg,
Kassel, Mannheim sowie an der Budapester Oper und
war Ehrendirigent der Wiener Staatsoper. 1987 – noch
vor dem Fall des Eisernen Vorhangs – gründete er mit
Musikern beider Länder die Österreichisch-Ungarische
Haydn-Philharmonie, mit der er neue Maßstäbe in der
Haydn-Interpretation setzte. Als langjähriger Chef des
Danish Chamber Orchestra beeindruckt er außerdem
durch seine Deutung der Symphonien Mozarts und Beet-
hovens: »Eine Symphonie muss wie eine Oper gespielt
werden, diese Vielfalt der Emotionen soll auch in einer
Symphonie zum Ausdruck kommen«, so die Überzeu-
gung des Dirigenten.
30 Saison 2021/22 31 Adam FischerRundfunkchor Berlin
Brillant, flexibel, transparent, wandlungsfähig, fantas-
tisch, präsent – mit diesen Worten beschreiben Konzert-
kritiker gerne den Klang des Rundfunkchors Berlin. »Es
gibt wohl keinen anderen Chor, der so viel Verschie-
denes so gut macht und der sich mit so einem breiten
Repertoire und so verschiedenen Formaten beschäfti-
gen kann«, schwärmt Gijs Leenaars, der in der Spielzeit
2015/16 das Amt des Chefdirigenten und künstlerischen
Leiters von Simon Halsey übernahm. Ein breit gefächer-
tes Repertoire, ein flexibles, reich nuanciertes Klangbild
und eine makellose Präzision machen den 1925 gegrün-
deten Rundfunkchor Berlin zum Partner bedeutender
Orchester und Dirigenten. Auch mit den Berliner Philhar-
monikern verbindet ihn eine langjährige Kooperation.
Zu den gemeinsamen Projekten der vergangenen Jahre
zählen die viel gerühmten szenischen Realisationen der
Matthäus- und der Johannes-Passion von Johann Sebas-
tian Bach mit Sir Simon Rattle und Peter Sellars sowie die
Aufführung von Beethovens Neunter Symphonie zum
Amtsantritt Kirill Petrenkos als Chefdirigent der Berliner
Philharmoniker. Darüber hinaus möchte der Chor mit
seinen Aktivitäten im Bildungs- und Erziehungsbereich –
etwa das jährliche Mitsingkonzert in der Philharmonie –
möglichst viele Menschen für das Singen begeistern.
»Wir sind hier in Berlin in einer Luxusposition«, meint Gijs
Leenaars. »Wir haben überhaupt keinen Mangel an
spannenden Projekten und nicht immer kann man alles
unter einen Hut bringen.«
32 Saison 2021/22 33 Rundfunkchor Berlin© Conny Maier, Courtesy of König Galerie
© A Gentil Carioca, Maxwell Alexandre
Blick auf die Conditio humana
Artists of the Year 2021 der Deutschen Bank
im PalaisPopulaire
Die Auszeichnung „Artist of the Year“ der Deutschen Bank wird zehn
Jahre alt. Junge Künstler*innen, die mit Papier oder Fotografie
arbeiten, werden seit 2010 durch Ankäufe ihrer Werke für die
Sammlung Deutsche Bank, einen Katalog und Einzelausstellungen
einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht. Anlässlich des
Jubiläums werden erstmals drei Künstler*innen ausgezeichnet,
die jetzt mit neuen Werken im PalaisPopulaire zu sehen sind. Das gewalt und schwarze Identität. Virtuos in der Farbgebung, kraftvoll und
Besondere: Alle drei kamen über ungewöhnliche Wege zur Kunst, nicht ohne Ironie knüpft die Berlinerin Conny Maier an die Traditionen
reflektieren elementare Themen wie Gemeinschaft, Spiritualität der französischen Fauvisten und des deutschen Expressionismus an.
und Umweltzerstörung. Der 30-jährige Maxwell Alexandre stammt Im Zentrum ihrer Malerei-Installation steht ein riesiges, im wahrsten
aus Rio de Janeiros größter Favela. Seine Gemälde, Performances Sinne überwältigendes Triptychon, dem sie den Titel „Dominanz“
und Installationen kreisen um Rassismus, Musik, Religion, Polizei- gegeben hat. Und genau darum geht es auch in ihren Bildern: um
den Konflikt zwischen moderner Zivilisation und Natur, die Frage, wer
wen beherrscht, die Oberhand behält. Der taiwanesische Künstler
Zhang Xu Zhan fertigt für seine Filme und Installationen filigrane
Figuren und Landschaften aus Pappmaschee an. Sein immersiver
Kosmos ist von märchenhaften Wesen, singenden Tieren und Pflanzen
© Zhang Xu Zhan, courtesy of the artist and Project Fulfill Art Space
sowie Naturgeistern bevölkert – und transformiert alte Fabeln für das
Internetzeitalter. Drei Statements zur Conditio humana, die radikales
Um- und Neudenken einfordern.
Deutsche Bank „Artists of the Year“ 2021
Maxwell Alexandre – Conny Maier – Zhang Xu Zhan
Bis zum 7. Februar 2022
PalaisPopulaire
Unter den Linden 5, 10117 Berlin
db-palaispopulaire.deKonzerttipps
Renaud Capuçon und die Karajan-Akademie
Ein heiter-melancholisches Programm mit dem franzö-
sischen Geiger Renaud Capuçon und der Karajan-Aka-
demie: Für den heiteren Aspekt sorgen zwei Werke Wolf-
gang Amadeus Mozarts, dessen Violinkonzert Nr. 3 G-Dur
und seine »Haffner-Symphonie«, die die Wiener Klassik
von ihrer lichten Seite zeigen. Melancholisch hingegen
Hier spielen
geben sich Richard Strauss’ Metamorphosen, in denen der
Komponist die Zerstörungen durch den Zweiten Weltkrieg
betrauert.
wir nur für
Sa 30.10.21 20 Uhr
Kammermusiksaal
Karajan-Akademie der Berliner Philharmoniker
Sie
Renaud Capuçon Violine und Leitung
Karten von 15 bis 35 Euro
Dreimal Mozart mit Leif Ove Andsnes
und dem Mahler Chamber Orchestra
Die Jahre 1785/86 bildeten eine entscheidende Phase
in Mozarts künstlerischer Entwicklung: Sein Stil wurde
dramatischer, sprechender und präsentierte eine neue
Art des Storytellings. Der Pianist Leif Ove Andsnes und das
Mahler Chamber Orchestra widmen sich in ihrem Projekt
Mozart Momentum Kompositionen jener Zeit. An diesem
Abend interpretieren sie die Klavierkonzerte Nr. 23 und
Nr. 24 sowie die »Prager« Symphonie: alles Werke, die
rund um Mozarts Le nozze di Figaro entstanden und in
ihrer Konzeption von der Oper beeinflusst sind.
Sa 13.11.21 20 Uhr
Kammermusiksaal
Mahler Chamber Orchestra
Leif Ove Andsnes Klavier und Leitung
Jetzt in Karten von 20 bis 45 Euro
Hi-Res
Audio
Offizieller Streaming-Partner
der Digital Concert Hall
digitalconcerthall.com
37 KonzerttippsKonzerttipps
Sir András Schiff und das Chamber
Orchestra of Europe
Klassik
Sir András Schiff und das Chamber Orchestra of Europe
verbindet eine langjährige, intensive künstlerische Freund-
schaft. Die gemeinsamen Proben und Konzerte – so der
ungarische Pianist und Dirigent – seien eine reine Freude,
ein fließender Strom von Geben und Nehmen: »Die
kollektive Intelligenz und Sensibilität dieser Gruppe ist
bewundernswert«. Als im wahrsten und besten Sinne des
Wortes eingespieltes Team führen sie die Zweite Orches-
erleben
tersuite und das Brandenburgische Konzert Nr. 5 von Bach
sowie das Klavierkonzert Nr. 17 und die g-Moll-Symphonie
von Mozart auf.
Fr 26.11.21 20 Uhr
Kammermusiksaal
Chamber Orchestra of Europe
András Schiff Klavier und Leitung
Lorenza Borrani Violine und Konzertmeisterin
Clara Andrada Flöte
Karten von 20 bis 45 Euro
Das Quatuor Ébène mit Haydn, Janáček
und Schumann
Manche Musikkritiker halten das Quatuor Ébène für das
beste Streichquartett der Welt – wegen seiner reichen
Palette an Klangnuancen, die vom wärmsten, intimsten
Moment bis zur aggressivsten, härtesten Attacke reicht.
Das Erfolgsrezept des Ensembles? »Wir haben viele
Streitigkeiten«, meint der Geiger Gabriel Le Magadure
Unterstützen Sie uns beim Kauf in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung. »Aber
hochwertiger Instrumente, bei der über allem steht die Liebe dazu, etwas gemeinsam zu
erschaffen.« Bei seinem Auftritt im Kammermusiksaal führt
Verbesserung der Ausstattung in das Quatuor Ébène sein Publikum mit Werken von Haydn,
Philharmonie und Kammermusiksaal Schumann und Janáček von der Wiener Klassik über die
Romantik bis zur Moderne.
oder bei der Förderung besonderer
Mi 01.12.21 20 Uhr
musikalischer Projekte.
Kammermusiksaal
Quatuor Ébène:
Pierre Colombet Violine | Gabriel Le Magadure Violine
Wir freuen uns auf Sie! Marie Chilemme Viola | Raphaël Merlin Violoncello
Karten von 15 bis 35 Euro
Freunde der Berliner Philharmoniker e. V.
berliner-philharmoniker.de/freunde
39 Konzerttipps
Ticketverkauf
• online unter berliner-philharmoniker.de
• t elefonisch unter +49 30 254 88-999
Montag – Freitag 9 –16 Uhr
• a n der Konzertkasse der Philharmonie
Montag – Freitag 15–18 Uhr
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11–14 Uhr
Impressum Newsletter und Social Media
Herausgegeben von der Berliner berliner-philharmoniker.de/newsletter
Philharmonie gGmbH für die Stiftung instagram.com/BerlinPhil
Berliner Philharmoniker facebook.com/BerlinPhil
Direktorin Marketing, Kommunikation und twitter.com/BerlinPhil
Vertrieb: Kerstin Glasow youtube.com/BerlinPhil
Leiter Redaktion: Tobias Möller (V. i. S. d. P.)
Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin
redaktion@berliner-philharmoniker.de
Redaktion: Anne Röwekamp
Mitarbeit: Stephan Kock, Hendrikje Scholl
Werkeinführungen, Mozart zwischen
Salzburg und Wien: Wolfgang Stähr
Biografien: Nicole Restle · Abbildungen: S. 5,
8, 10, 12, 16, 19, 20, 22 akg-images, S. 15
Alamy, S. 26 Monika Rittershaus, S. 31 Szilvia
Csibi, S. 33 S ebastian Hänel, S. 37 (o.) Dario
Acosta, (u.) Gregor H ohenberg, S. 39 (o.)
Joanna Bergin, (u.) J ulien Mignot · Artwork:
Studio Oliver Helfrich · Layout: Stan Hema
Satz: Bettina Aigner · Herstellung: Reiter-Druck,
12247 Berlin
Programm- und Besetzungsänderungen
vorbehalten
Einzelheftpreis: 3,50 Euro
PH 14, 2021/22
40 Saison 2021/22 Kol-Titel15.9.2021 – 7.2.2022
Deutsche Bank
“Artists of the Year”
MA XWELL
ALEXANDRE
CONNY
© Conny Maier. Courtesy of König Galerie
MAIER
ZHANG XU
ZHANSie können auch lesen