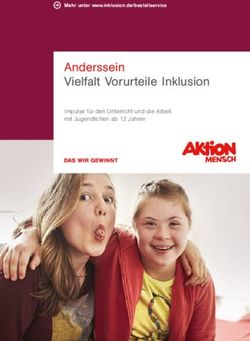Psychiatrische und psychotherapeutische Fragestellungen in der Arbeit mit geistig behinderten Patientinnen und Patienten - Psychiatrisches ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Psychiatrische und psychotherapeutische
Fragestellungen in der Arbeit mit geistig
behinderten Patientinnen und Patienten
Psychiatrisches Kolloquium 22.03.2013
Dr. med. J. Wagner
Psychiatriezentrum Männedorf„Die Unterscheidung in behinderte und nichtbehinderte Menschen
muss aufhören. Jeder hat gewisse Behinderungen und wir alle haben
emotionale Defekte.“
Bill Clinton
Schirmherr „My handicap“Definition Geistige Behinderung
ICD-10 Intelligenzminderung
„… eine sich in der Entwicklung manifestierende, stehen gebliebene oder
unvollständige Entwicklung der geistigen Fähigkeiten, mit besonderer
Beeinträchtigung von Fertigkeiten, die zum Intelligenzniveau beitragen, wie
z.B. Kognition, Sprache, motorische und soziale Fähigkeiten“
Einteilung in 4 Schweregrade (leicht / mittelgradig / schwer / schwerst),
abhängig vom IQDefinition Geistige Behinderung
DSM-IV Mental Retardation
• Deutlich unterdurchschnittliche intellektuelle Leistungsfähigkeit: ein IQ
von ca. 70 oder weniger bei einem individuell durchgeführten
Intelligenztest
• Gleichzeitige Defizite oder Beeinträchtigungen der gegenwärtigen
sozialen Anpassungsfähigkeit in mindestens zwei der Bereiche
Kommunikation, Eigenständigkeit, häusliches Leben,
soziale/zwischenmenschliche Fertigkeiten, Nutzung öffentlicher
Einrichtungen, Selbstbestimmtheit, schulische Fertigkeiten, Arbeit,
Freizeit, Gesundheit sowie Sicherheit
• Beginn der Störung liegt vor Vollendung des 18. LebensjahrsDefinition Geistige Behinderung
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF) / WHO 2001
• negative Wechselwirkung zwischen einer Person (mit einem
Gesundheitsproblem) und ihren Kontextfaktoren (Umwelt- und
personenbezogene Faktoren)
• Oberbegriff für Schädigungen (von Körperfunktionen oder –
strukturen), Beeinträchtigungen der Aktivität oder der Teilhabe
→ Behinderung als komplexes Zusammenspiel der Schädigungen
auf organismischer, individueller und gesellschaftlicher Ebene
→ bio-psycho-soziales Modell, Versuch der Zusammenführung des
medizinischen (lösungsorientierten) Versorgungsmodell oder dem
sozialen Modell der problematischen Integration.Definition Geistige Behinderung
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung
und Gesundheit (ICF)Begrifflichkeiten
Diskussion: - Menschen mit kognitiver Behinderung / Beeinträchtigung
- Menschen mit Lernschwierigkeiten
- Menschen mit besonderen Fähigkeiten / Anders Begabte
- intellectual (learning) disability
- intellectually challenged
Obsolet: - Schwachsinn
- Oligophrenie
- Debilität
- Imbezilität
- IdiotieGeistige Behinderung und Psychiatrie
• Wertung häufig zu beobachtender Persönlichkeitszüge und Verhaltensweisen als
Ausdruck der Behinderung selbst
• Typologie nach Kurt Schneider
•„der indolent Passive“
• „der faule Geniesser“
• „der sture Eigensinnige“
• „der kopflos Widerstrebende“
• „der aggressiv Losschimpfende“
• „der ständig Erstaunte“
• „der verstockte Duckmäuser“
• „der heimtückisch Schlaue“
• „der treuherzig Aufdringliche“
• „der selbstsichere Besserwisser“
• „der prahlerische Grosssprecher“
• „der chronisch Beleidigte”
• Typeneinteilung zumeist reduziert auf zwei Grundtypen:
• den „torbiden” (den stumpf-apathischen)
• den „erethischen” (den erregbar-aggressiven)Geistige Behinderung und Psychiatrie
Quelle: Lehrbuch der Psychiatrie, E. Bleuler; 12. Auflage, 1972Ursachen • Genetische Faktoren: z.B. Trisomie 21, Klinefelter Syndrom, Fragiles X- Syndrom, Phenylketonurie, Prader-Willi-Syndrom, Neurofibromatose • Pränatale Schädigungen: z.B. Alkohol, Röteln-Infektion, Strahlenexposition, intrauterine Mangelernährung • Perinatale Schädigungen: z.B. Hypoxie, Hirnblutungen, Enzephalitis • Postnatale Schädigungen: z.B. Mangelernährung (Iodmangel), Infektionskrankheiten (Masern, Meningitiden, …), Toxine (Blei, Quecksilber, …), Epilepsie, SHT, hormonelle Störungen, Hirntumore • Psychosoziale Schädigungen: schwere, chronisch-deprivierende Lebensverhältnisse • In vielen Fällen ungeklärt, vor allem je leichter die Behinderung
Epidemiologie
• in industrialisierten Ländern: 1-2,5% Menschen mit
geistiger Behinderung
• 0,1-0,3% mit schwerer geistiger Behinderung
• in Entwicklungsländern: vermutlich 5fach höhere
Prävalenzraten
• Down Syndrom häufigste Ursache (1:650-1000
Lebendgeborene)Goethe, Faust und Julia
Untergliederung psychischer Auffälligkeiten
• Psychische Störungen nach ICD-10/DSM-IV
• Problemverhalten
• Verhaltensphänotypen bei genetisch definierten
Syndromen; charakteristische Merkmale im
Verhalten, im neuropsychologischen Profil, im
Entwicklungsverlauf oder hinsichtlich besonderer
Prädispositionen für umschriebene psychische
StörungenGrundsätzliches Komorbide psychische Störungen sind sehr häufig (Prävalenz: 30-50%; 3-4 mal häufiger als bei Nichtbehinderten) Alle Formen psychischer Störungen kommen vor. Je schwerer die Intelligenzminderung ausgeprägt ist, desto grösser werden die diagnostischen Probleme und desto komplexer gestaltet sich die Behandlung.
Epidemiologie
Prävalenz psychotischer und affektiver Störungen nimmt mit der
Schwere der Behinderung ab.
Prävalenz ADHD, Autismus-Spektrum-Störungen,
Problemverhalten nimmt zu.
Beispiel: Emotionale Störungen (Depression, Angst, Zwang)
• 13,3% leicht behindert
• 9,7% schwer behindert
• 11,1% Total
Schwache bis deutliche Tendenz: Störungen häufiger bei Frauen
(ausser: Autismus-Spektrum-Störungen, Alkoholmissbrauch, Pica)
Cooper et al, 2007Demenz
• Prävalenz zweimal höher als in der Normalbevölkerung.
• Erkrankungsbeginn deutlich früher.
• Gen für Amyloid-Precursor-Protein auf Chromosom 21
→ Prävalenz DS < 65 Jahre: > 30%
→ Prävalenz DS > 65 Jahre: > 26-100%
• Grosse diagnostische Schwierigkeiten. Bei DS ws Beginn mit
Beeinträchtigungen im Frontalhirn, bunte Symptomatik
(Aggressives Verhalten, Affektive Komponenten,
Schlafstörungen, sozial unpassendes Verhalten, Regression)
• Es spricht grundsätzlich nichts gegen den Einsatz von
Antidementiva.
Coppus, Telbis-Kankainen, 2011Spezielle Risiken für die Entwicklung einer
psychischen Störung
Biologische Faktoren
• Genetisch bedingte Vulnerabilität
• Funktionsstörungen des Gehirns
• Epilepsie
• Erschwerte Interaktionen mit der Umwelt infolge von Störungen der
Motorik, Sensorik und Sprache
Sarimski 2007Spezielle Risiken für die Entwicklung einer
psychischen Störung
Psychologische Faktoren
• Beeinträchtigte Intelligenz und aller damit zusammenhängender
neuropsychologischer Funktionen (Adaptabilität)
• Beeinträchtigte oder erlernte dysfunktionale Problemlösungsstrategien
• Unreife Abwehrmechanismen in Konflikten und unter Belastungen
• Erlernte dysfunktionale oder ungewöhnliche Copingstrategien
• Entwicklungshemmende Bindungsstile, Kollusionen und Symbiosen mit
Bezugspersonen
• Schwierigkeit, eine Identität zu entwickeln
• Schwierigkeiten, erfüllende Beziehungen einzugehen
Sarimski 2007Spezielle Risiken für die Entwicklung einer
psychischen Störung
Soziale Faktoren
• Über- oder unterforderndes Milieu; Mangel an geeigneter sozialer
Herausforderung oder Unterstützung durch andere;
Überbetonung von Förderprogrammen („Förderterror“) zu
Lasten von individueller Stabilität und Identität; hohe Misserfolgs-
und Katastrophenerwartung der Eltern und Erzieher
(„Self-fulfilling prophecy“)
• Mangel angemessener kommunikativer Strategien und spezifischer Kenntnis
über individuelle kommunikative Besonderheiten im Umfeld
• Modelllernen in Gruppen mit nur behinderten KameradInnen
• Primäre und sekundär-reaktive psychosoziale Probleme der Bezugspersonen;
dysfunktionale Familienstrukturen
• Fehlende Integration in die Gesellschaft, Stigmatisierung und
Diskriminierung oder „Pseudointegration“ unter Leugnung
spezifischer Assistenznotwendigkeit
• Seelische, körperliche und/oder sexuelle Misshandlung
• Soziale und psychische Isolation
• Verlust allgemeingültiger Werte und Normen infolge von Diskriminierung oder
Gratifikation von „Behinderung“ Sarimski 2007
• Probleme, eine Arbeit oder Beschäftigung zu findenBindungsforschung
„Es liegt nahe anzunehmen, dass die frühe Bindungsentwicklung bei
Kindern mit Bewegungsstörungen gefährdet ist, weil sie in
bindungsrelevanten Situationen mehr Zeit benötigen, um die
Bezugspersonen zu erreichen, und im Spiel und täglichen Leben mehr und
länger auf Hilfe angewiesen sind als andere Kinder.“
Sarimski 2005
• Wenig Studien, Überbehütung der Eltern wird betont.
• Kinder mit Bewegungsstörungen bewerten ihre Fähigkeiten im
Durchschnitt negativer. Negative Selbstbewertungen gehen dabei häufig
mit depressiven Verhaltensweisen einher.
• Je schwerer die motorische Beeinträchtigung desto positiver die
Selbsteinschätzung (!)
Anderes Beispiel: Festhaltetherapie bei Kindern mit frühkindlichem
Autismus (Martha Welch, Jirina Prekop)Problemverhalten
Diagnosekriterien nach DC-LD = Diagnostic Criteria for psychiatric
disorders for use with adults with learning disabilities/mental retardation
Verbal-aggressives, tätlich-aggressives, zerstörerisches, selbstverletzendes,
sexuell unangemessenes, oppositionelles, forderndes, sich herumtreibendes,
gemischtes und anderes Verhalten.
A. Frequenz, Schwere oder Chronizität eines Problemverhaltens sind so
ausgeprägt, dass klinisches Assessment und spezielle Interventionen
erforderlich werden.
B. Das Problemverhalten darf nicht als unmittelbare Folge einer bestimmten
psychischen Störung, von Medikamenten oder körperlichen
Erkrankungen erklärbar sein.
C. Eines der folgenden Merkmale muss vorhanden sein:
• Das Problemverhalten beeinträchtigt wesentlich die Lebensqualität
der betroffenen Person oder anderer Personen.
• Das Problemverhalten stellt ein wesentliches Risiko für Gesundheit
oder Sicherheit der betroffenen Person und/oder anderer Personen dar.
D. Das Problemverhalten ist andauernd und schwerwiegend.Problemverhalten
• Bei 10-60% der Menschen mit geistiger Behinderung
• Nicht auf psychiatrische oder sonstige medizinische Kategorien
zurückzuführen
• Durch Psychopharmaka in aller Regel kaum beeinflussbar
• Ergebnis einer ungünstigen Wechselwirkung zwischen der Person (mit
ihrem biologischen und psychologischen Substrat) und ihrer physischen
und sozialen Umwelt
• Das Niveau der kognitiven, der sozialen, der emotionalen und der
Persönlichkeitsentwicklung ist wesentlich dafür, wie eine Person mit
geistiger Behinderung Belastungen und Anforderungen bewältigt.
Das Entwicklungsniveau einer Person zu kennen, kann bestimmte
Verhaltensweisen unter bestimmten Bedingungen erklären helfen.
• Assessment des Problemverhaltens, der Person, der Umwelt
• Hypothesengeleitete InterventionProblemverhalten
Doŝen A et al, 2010Geistige Behinderung und Psychotherapie
Bis weit in die 90‘er Jahre verbreitet
Geistig Behinderte sind seelenlose Menschen, die aufgrund ihrer
Oligophrenie nicht in der Lage sind:
• zu lernen
• Entwicklung zu machen
• Beziehungen aufzunehmen
• Gefühle zu erleben
→ daher nicht psychotherapiefähig sind !Vorraussetzungen für Psychotherapie
• Sozio-emotionaler Entwicklungsstand der
Wahrnehmung des eigenen Selbst als getrennt vom
Anderen, sich selbst als Handelnder mit Folgen für
die Umwelt erleben
-> Entwicklungsalter von ca. 2-3 Jahren (IQ 20-35)
• Kognitives Niveau: Anschauungsgebundenes
Denken, Nutzung von Sprache oder anderen
Lautäusserungen als Mitteilen konkreter Botschaften,
Lernen durch konkrete Vorbilder und Erfahrungen,
Möglichkeit des Vorausdenkens
-> Entwicklungsalter von ca. 4-7 Jahren (IQ 35-50)
Wunder, 2011Vorraussetzungen für Psychotherapie
• Ausreichende Motivation, sich einer Therapie zu
unterziehen
• Gewähr, regelmässig an den Sitzungen teilzunehmen
• Klarheit über die Notwendigkeit eines
Arbeitsbündnisses mit dem Therapeuten
• Vorhandensein oder schnell zu erarbeitende
Zielvorstellung, die realistisch ist
• Bereitschaft, sich in Frage zu stellen und zu verändern
Wunder, 2011Herausforderungen für Psychotherapie
• Menschen mit geistiger Behinderung sind es häufig
nicht gewohnt, über sich zu sprechen, über sich
nachzudenken.
• Sie sind es gewohnt, dass Entscheidungen über sie
getroffen werden.
• Alles um sie herum geht (zu) schnell, wirkt
unberechenbar, bedrohlich
→ Rituale, Stereotypien, Zwänge, Kopieren bringen
SicherheitGoethe, Faust und Julia
Psychotherapie – Rollenverständnis
• eher eklektisch, polypragmatisch
• Modifikation und Anpassung an die speziellen
Voraussetzungen von Menschen mit geistiger
Behinderung
• Aktivere Rolle des Therapeuten
• Multimodales Behandlungssetting
• Viel Zeit
Wunder, 2011Psychotherapie – Therapiekonzepte
• Operante Verfahren der Verhaltenstherapie
• Kognitiv-behaviorale Verfahren, dabei insbesondere modifizierte
DBT-Elemente
• CBASP, modifizierte Elemente
• Traumatherapie
• Personzentrierte Konzepte
• Elemente aus der systemischen Therapie
• (Modifizierte) Elemente aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie,
z.B. Puppenspiel, Rollenspiel, etc.
• Körper- und Bewegungstherapie, Entspannungsverfahren
• MusiktherapieBeispiel Wahrnehmung und Umgang mit Gefühlen
Schärfung der Wahrnehmung und Introspektion (Freude, Wut, Angst,
Scham, Stolz, Trauer):
• Wahrnehmen der damit verbundenen Gedanken,
Körpersensationen und Gesichtsausdrücke sowie Auslöser
(Einzel-/Gruppensetting)
Mögliche Medien:
• Bildmaterialien
• lebensnahe Beispiele
• Rollenspiele
• GefühlsprotokollQuelle: Barrett, B. F., Feuerherd, Ch. (2011): Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen bei Menschen mit geistiger Behinderung - Differentialdiagnostik und Therapie. In: Hennicke, K. (Hrsg.) (2011): Verhaltensauffälligkeiten, Problemverhalten, Psychische Störungen - Herausforderungen für die Praxis.
Integratives Modell
• Primär Beeinflussung der physischen und sozialen
Umwelt der Betroffenen
• Anpassung der Umwelt an die Ressourcen,
emotionalen und psychosozialen Bedürfnisse der
betroffenen Person
• Interdisziplinäre, multiprofessionelle Planung und
Umsetzung
• Ergänzung durch psychotherapeutische und
psychopharmakologische Komponenten
Doŝen A et al, 2010Krisenmanagement
• Prioritär: somatische Abklärung (somatische Probleme, z.B. Schmerzen
äussern sich häufig als Verhaltensauffälligkeiten!)
• Differentialdiagnose: Zahnschmerzen, Gelenk- und Rückenschmerzen,
Muskelschmerzen bei Spastik, nicht angepasste, unbequeme
Sitzversorgungen mit unphysiologischen Ausgangsstellungen, Anämie,
Schilddrüsenfunktionsstörungen, Schlafapnoe, Refluxbeschwerden,
Obstipation, Subileus oder Ileus, Überlaufblase,
Harnwegsinfekte,eingewachsene Zehennägel, Dekubitus, Analekzem
• Erhöhter Zeitbedarf, je nach dem Haus- oder Heimbesuche
• Stationäre Spital- oder Klinikbehandlungen sind selten indiziert!
• Einsatz vom Flying Teams
SAGB Arbeitsgruppe 'Krisenintervention'Psychopharmaka
• Orientierung an den gerontopsychiatrischen Leitsätzen
START LOW, GO SLOW
• Keine Evidenz für medikamentöse Beeinflussung des
Problemverhaltens
• Zum Einsatz kommen sämtliche gängigen Psychopharmaka
• Polypharmazie ist nach Möglichkeit zu vermeiden
• Cave Benzodiazepine: in niedrigen Dosierungen gehäuft
„paradoxe“ Reaktionen, gewünschter Effekt dann bei höherer
Dosierung
• Nebenwirkungsmonitoring unter Einbezug des etablierten
Helfersystems
• MedikamentenspiegelKlinische Beispiele
Zusammenfassung
• Intellektuelle Behinderung ist per se keine psychische Krankheit.
• Menschen mit intellektueller Behinderung können – wie alle anderen Menschen
auch – psychisch krank werden.
• In der Diagnostik psychischer Störungen bei Menschen mit intellektueller
Behinderung treten zusätzliche Probleme auf:
• Häufig ist die (verbale) Kommunikation erschwert, sodass das
psychiatrische Gespräch modifiziert werden muss.
• Die Symptomatik ist häufig „überformt“ oder „verkleidet“ durch
Aggression, Autoaggression, Somatisierung (overshadowing)
• Psychotische Einzelsymptome treten relativ häufig auch bei primär
reaktiven Störungen auf.
• Bei der Einschätzung der Symptome sind die spezifischen Lebensbedingungen
als pathoplastische Faktoren in besonderem Masse Rechnung zu stellen
• Für die Therapie ist das allgemeine Inventar psychiatrischer
Interventionsformen anzuwenden: Psychotherapie, soziale Therapie,
Pharmakotherapie, PädagogikNützliche Links
• Schweizerische Arbeitsgemeinschaft von Ärzten für Menschen mit
geistiger oder mehrfacher Behinderung
http://www.sagb.ch
• Deutsche Gesellschaft für seelische Gesundheit bei Menschen mit
geistiger Behinderung
http://www.dgsgb.de
• Elternorganisation insieme
http://www.insieme.ch
• pro infirmis, Die Organisation für behinderte Menschen
http://proinfirmis.chBuchtipp
Sie können auch lesen