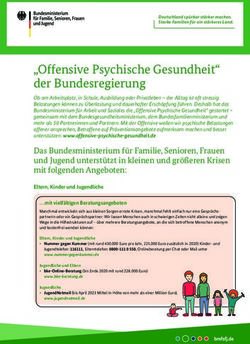Psychische Gesundheit und Flucht - Kurzvortrag Unterkunft Ukraine - Austauschabend für Gastgebende - GGG Benevol
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Psychische Gesundheit und Flucht
Kurzvortrag
Unterkunft Ukraine – Austauschabend für Gastgebende
GGG Benevol
Dipl.-Psych. Lalitha Chamakalayil, Institut Kinder- und
Jugendhilfe, Hochschule für Soziale Arbeit, FHNW
M. Sc. Bettina Moser, Flüchtlingsberatung Caritas Aargau
Dr. med. Serena Galli, Transkulturelle Sprechstunde ZPG
BinningenAblauf heute
Präsentation
►Psychische Gesundheit Geflüchteter
►Psychisches Trauma
►Traumafolgestörungen
►Ist ein Trauma unausweichlich? Nein!
►Welchen Beitrag können Helfende leisten?
►Welche Fachstellen können weiterhelfen?
2Psychische Gesundheit Geflüchteter allgemein • Psychische Erkrankungen treten in Population von Menschen mit Fluchtgeschichte häufiger auf • Prävalenz psychischer Erkrankungen bei Asylsuchenden in CH ca. 50- 60%, wovon in Deutschschweiz < 10% Behandlung erhalten (Müller et al. 2018) • Versorgungslücke in Bezug auf spezialisierte Therapieangebote (Oetterli et al. 2013) aufgrund vielfältiger Zugangsbarrieren (u.a. fehlende Deckung Dolmetscher*innenkosten durch Krankenkasse, Stigmatisierung auf Seiten der Betroffenen u.a.) • Diagnose von Traumafolgestörungen oft erst nach Jahren mit Chronifizierung und Generierung hoher gesellschaftlicher Folgekosten (Heiniger & Kaiser 2013) 3
Was ist ein psychisches Trauma?
• Objektive Perspektive: «Ein belastendes Ereignis oder eine Situation
kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung
oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe
Verzweiflung hervorrufen würde.» (ICD 10 Version 2019, WHO 1992)
• Subjektive Perspektive: «[…] ein vitales Diskrepanzerlebnis zwischen
bedrohlichen Situationsfaktoren und den individuellen
Bewältigungsmöglichkeiten, das mit Gefühlen von Hilflosigkeit und
schutzloser Preisgabe einhergeht und so eine dauerhafte
Erschütterung von Selbst- und Weltverständnis [und somit auch
Beziehungsverständnis!] bewirkt.» (Fischer & Riedesser 2020)
• Zwischenmenschliche Traumatisierungen (bspw. Gewalt im
Kriegskontext) prognostisch ungünstiger
4Traumafolgestörungen
• Traumafolgestörung: Überbegriff für verschiedene psychische
Erkrankungen, zurückführbar auf traumatische Erlebnisse
• Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) ist nicht die einzige
Traumafolgestörung!
• PTBS: Sich aufdrängendes Wiedererleben («Flashbacks») und Albträume;
körperliche Übererregung mit Schlafstörungen, Schreckhaftigkeit und Gereiztheit;
Abspaltung des Bewusstseins («Dissoziation); Vermeidungsverhalten und Rückzug,
emotionale Instabilität mit heftigen Emotionen oder emotionaler Abgestumpftheit
und Interessensverlust
• Schmerzstörungen, Depressionen, Angststörungen,
Abhängigkeitserkrankungen u.a. können auch Traumafolgestörungen sein
• Traumafolgestörungen können verzögert auftreten
• Bspw. erst Monate nach Ankunft in der Schweiz (initial Beschäftigung mit eigenem
„Überleben“, Erledigung administrativer Aufgaben u.a.) 5
• Aber…… ein Trauma ist NICHT immer die Konsequenz!
• Nicht jeder Mensch entwickelt nach einer traumatischen Erfahrung
eine Traumafolgestörung!
• Ob sich eine Traumafolgestörung entwickelt, ist von individuellen,
zwischenmenschlichen und kontextuellen Faktoren abhängig (ist
also ein variabler, beeinflussbarer Prozess)!
• Akute Belastungsreaktion (nach einem traumatischen Ereignis)
kann Wochen andauern und stellt ein gesunder Bewältigungsversuch
der Psyche dar („normale“ Reaktion auf „abnormale“ Belastung) –
keine (vorzeitige) Pathologisierung!
• Die Akute Belastungsreaktion kann sich wie eine PTBS äussern
6Was braucht es?
• In der Phase nach dem traumatischen Ereignis (Akute
Belastungsreaktion) ist die Vermittlung basaler Sicherheit und
Stabilität essentiell (genügend Schlaf und gesunde Nahrung;
räumliche Rückzugsmöglichkeiten; Aufrechterhaltung einer
Tagesstruktur; «angenehme» Tätigkeiten wie Kochen, Spazieren,
Gespräche; kein bedrängendes Nachfragen u.a.)
• Bei grossem Leidensdruck (bspw. schwere Beeinträchtigung im
Alltag, schwere Schlafstörung) oder längerer Beschwerdedauer ist
Inanspruchnahme professioneller Unterstützung empfohlen
7Wie können wir alle unterstützend sein? I
• Prozesshaftes Traumaverständnis: Traumatisierung als
prozesshaftes Geschehen, welches massgeblich mitgeprägt wird
durch Lebensbedingungen im Hier und Jetzt des
Aufnahmelandes Schweiz («sequentielle Traumatisierung» n.
Keilson 1979)
• Stichwort Postmigrationsstressoren: Erfahrungen und
Lebensrealitäten im Ankunftsland für posttraumatische
Prozesse prognostisch wichtig (Li et al. 2016)
• Gesellschaftspolitische Anerkennung des geschehenen
Unrechts, aber auch der psychosozialen Schwierigkeiten im
Aufnahmeland essentiell! (Varvin 2013)
8Wie können wir alle unterstützend sein? II
• Trauma als Beziehungsgeschehen: Hilfreiche
Beziehungserfahrungen als zentraler Schutzfaktor, um
die Entwicklung von Traumafolgestörungen zu verhindern
(vgl. Keilson 1979)
• Menschengemachte traumatische Erfahrungen als
Erschütterung des Grundvertrauens ins menschliche
Gegenüber (Trauma als «Beziehungsgeschehen») à
zentrale Rolle halt- und sicherheitsgebender,
empathischer Beziehungen! 9Wie können wir alle unterstützend sein? III
• Subjektstatus der Betroffenen: Kriegsgeflüchtete sind
Menschen mit komplexen persönlichen Geschichten, die vor
dem Krieg beginnen und nach dem Krieg weitergehen
• Keine Reduktion auf «traumatisierte Geflüchtete»
• Balanceakt zw. Anerkennung des geschehenen Unrechts
einerseits und Unterstützung bei der Selbstermächtigung
andererseits (Ermöglichung sinnstiftender Tätigkeiten und
Übernahme von Selbstverantwortung)
• Keine einseitige Viktimisierung/Schonung der Betroffenen;
Reflektion eigener Unterstützungsimpulse in Hinblick auf
deren Nachhaltigkeit
10… und nicht vergessen:
• Auch die Haltgebenden brauchen Halt: Selbstfürsorge,
Vernetzung!
11Weiterverweisung an Fachstellen
• Transkulturelle Ambulanz der Universitären Psychiatrischen Kliniken
Basel
• Transkulturelle Sprechstunde Zentrum für psychische Gesundheit
Binningen der Psychiatrie Baselland
• Stationäre Behandlung in den Universitären Psychiatrischen Kliniken
oder in der Psychiatrie Baselland
• …
12Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Literatur
Fischer G., Riedesser P. (2020). Lehrbuch der Psychotraumatologie. Ernst Reinhardt Verlag, München.
Li, S. S., Liddell, B. J., & Nickerson, A. (2016). The relationship between post-migration stress and
psychological disorders in refugees and asylum seekers. Current psychiatry reports, 18(9), 82.
Müller, F., Roose, Z., Landis, F., & Gianola, G. (2018). Psychische Gesundheit von traumatisierten
Asylsuchenden: Situationsanalyse und Empfehlungen. Bericht zuhanden des Bundesamts für
Gesundheit (BAG), Interface Politikstudien Forschung Beratung, Luzern.
Oetterli, M., Niederhauser, A., & Pluess, S. (2013). Ist-Analyse von psychosozialen Behandlungs-und
Betreuungsangeboten für traumatisierte Personen im Asyl-und Flüchtlingsbereich. Kurzbericht
zuhanden des Bundesamts für Migration BFM.
Steel, Z., Chey, T., Silove, D., Marnane, C., Bryant, R. A., & Van Ommeren, M. (2009). Association of torture
and other potentially traumatic events with mental health outcomes among populations exposed to
mass conflict and displacement: a systematic review and meta-analysis. Jama, 302(5), 537-549.
Varvin, S. (2013, September). Psychoanalyse mit Traumatisierten. In Forum der Psychoanalyse (Vol. 29,
No. 3, pp. 373-389). Springer Berlin Heidelberg.
14Sie können auch lesen