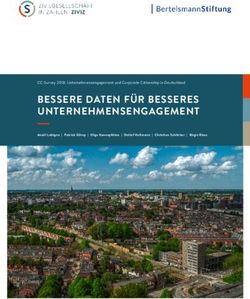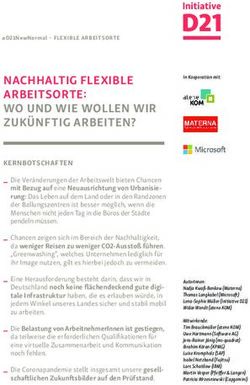Rede des Niedersächsischen Ministerpräsidenten Christian Wulff anlässlich des Deutschlandtreffens der Schlesier
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Rede des
Niedersächsischen Ministerpräsidenten
Christian Wulff
anlässlich des Deutschlandtreffens der Schlesier
am 1. Juli 2007, 11.30 Uhr, Messegelände Hannover
(Es gilt das gesprochene Wort!)
Sehr geehrter Herr Professor Pietsch,
sehr geehrter Herr Pawelka,
sehr geehrter Herr Weihbischof Pieschl,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
sehr geehrte Damen und Herren!
Ganz herzlich Willkommen bei uns in Hannover, in Niedersachsen!
Schlesiertreffen ist wieder in Niedersachsen
Ich grüße Sie, die Heimatvertriebenen und Flüchtlinge aus Schlesien und Ihre Angehörigen.
Ich grüße alle Aussiedler und Spätaussiedler.
Ich grüße Sie, die Sie aus ganz Deutschland hierher nach Hannover gekommen sind.
Mein besonderer Gruß gilt unseren Landsleuten, die aus dem schönen Schlesien zu uns nach Han
nover angereist sind. Schön, dass Sie da sind!
Sofort nach meiner Wahl zum Ministerpräsidenten im Jahr 2003 habe ich mich dafür eingesetzt:
Das Deutschlandtreffen der Schlesier gehört nach Hannover, die Landeshauptstadt ihres Paten
landes.
Leider konnte ich Sie 2005 noch nicht überzeugen. Da haben viele von Ihnen Nürnberg vorgezogen.
Aber viele Schlesier haben mir geschrieben, weil sie lieber wieder nach Hannover reisen wollten.
Jetzt hat es endlich geklappt! Mit Unterstützung von Hannover-Kongress kann das Schlesiertreffen
endlich wieder bei uns in Hannover stattfinden, im Herzen des Patenlandes der Schlesier.
Jetzt hoffe ich eigentlich, dass alle diejenigen, die mir geschrieben haben, heute auch hier! Wenn
ich mir hier die Halle anschaue, besteht da für mich kein Zweifel. Es gab einige Bericht im Vorfeld.
Dr. Herbert Hupka hat es in "Schlesien lebt" beschrieben: "Heute besteht die Gefahr, dass die Deut
schen Schlesien verleugnen, vergessen, Schlesien zur 'terra incognita' erklären, als fern, fremd und
unbekannt behandeln".
Und Hupka weiter: "Es wäre vermessen und töricht, wollten die einen nur die Gegenwart sehen, die
anderen nur die Geschichte in Erinnerung rufen".
Was tut die Landesregierung für die Patenschaft?
Meiner Landesregierung sind die Heimatvertriebenen und Spätaussiedler wichtig! Deshalb hat mei
ne Landesregierung die Weichen so gestellt:
• Wir haben einen Landesbeauftragten für Heimatvertriebene und Spätaussiedler, den Abge
ordneten Rudolf Götz, benannt.• Wir unterstützen Projekte unserer Heimatvertriebenen und Spätaussiedler!
• Wir geben unseren Schulen Lehrmaterialien, damit die Kinder und Jugendlichen erfahren
können von Schlesien und auch über die Vertreibungsschicksale.
• Wir pflegen intensive Kontakte in unsere Partnerregionen in Polen, vor allem auch nach
Niederschlesien!
Gedenktafel in der Landesvertretung Niedersachsens in Ber
lin
Wir haben auch die Patenschaft Niedersachsens zur Landsmannschaft Schlesien neu belebt.
Nicht nur mit finanzieller Unterstützung. Wir haben auch ein sichtbares Zeichen gesetzt. Seit drei
Jahren hängt in der Niedersächsischen Landesvertretung in Berlin eine bronzene Gedenktafel mit
den Wappen Niedersachsens und Schlesiens.
Ich erinnere mich gerne an den Tag. Die Enthüllung der Gedenktafel fand im Beisein des verstor
benen Ehrenvorsitzenden Ihrer Landsmannschaft Schlesien, Herrn Dr. Hupka, statt.
Die Gedenktafel wurde übrigens von Hans-Jürgen Zimmermann gestaltet. Einem Niedersachsen,
dessen Eltern aus Schlesien stammen.
Patenschaft zur Landsmannschaft Schlesien
Die Patenschaft, die Niedersachsen vor 57 Jahren übernommen hat, wird durch das heute hier statt
findende Deutschlandtreffen der Landsmannschaft Schlesien eindrucksvoll bekräftigt. Sie haben
viel für unser Land getan. Die Patenschaft war guten und schweren Zeiten ausgesetzt.
Und sie hat sich mit den Jahren verändert. Wir sehen sie heute als Teil einer Brücke zwischen Nie
dersachsen und Schlesien. In diesem Sinne ist die Patenschaft in den letzten Jahren gewachsen. Die
Ausgestaltung der Patenschaft war und ist ein Prozess, der in Bewegung bleiben muss und bleiben
wird.
Die Geschichte der Patenschaft
Niedersachsen hat im letzten Jahr seinen 60. Geburtstag gefeiert. Uns wurde dabei auch deutlich ge
zeigt: Die junge Geschichte Niedersachsens ist auch eine Geschichte der Vertriebenen und der
Flüchtlinge.
Erinnerungen an Flucht und Vertreibung/ Ende des 2. Welt
krieges
Der Krieg, den Adolf Hitler entfesselt hat, die Morde, die Grausamkeiten, die Deutsche verübt hat
ten, all das schlug häufig gnadenlos nach Ende des Krieges auf die Deutschen zurück. Mich hat sehr
bewegt eine Diskussion am 01.09.2004 mit dem damaligen polnischen Ministerpräsidenten Belka
und polnischen und deutschen Jugendlichen 65 Jahre nach dem Überfall auf Polen und dem Aus
bruch des 2. Weltkrieges.
Es wurde auch daran erinnert, dass viele jüdische schlesische Einwohner stolz auf ihre Heimat
Schlesien waren, aber Opfer des Holocaust wurden. Viele Demokraten, viele Regimekritiker, viele
Widerstandskämpfer, gerade große, bedeutende Schlesier sind umgekommen.
Gerader derer sollten wir gedenken, wenn ich z.B. an den Kreisauer Kreis denke. Wir sollten uns in
Erinnerung der großen Schlesier auch verdeutlichen, dass der Gründer der SPD, Ferdinand Lassalle
vermutlich - er stammt aus Breslau - ein solches Schicksal ereilt hätte, hätte er in dieser schreck
lichen Zeit, in dieser dunklen Zeit gelebt.
Die Überlebenden des Krieges standen vor Schreckensszenarien, die sich heute keiner mehr vorstel
len kann: Millionen Tote hatten sie zu beklagen, ungezählte Kriegsversehrte, die Verwüstung und
den Verlust ihrer Heimat. Millionen Menschen suchten ihre Angehörigen. Es gab kaum eine Familie in Polen und Deutschland, die nicht von Tod und Verletzungen betroffen war. Flucht und Ver
treibung forderten allein zwei Millionen Todesopfer, 14 Millionen Menschen verloren ihre Heimat.
Es fehlte an allem: Wohnung, Kleidung, Nahrung, Arbeit und vielem mehr.
Es war der erste Ministerpräsident des Landes Niedersachsen, Hinrich Wilhelm Kopf, damals noch
Oberpräsident der Provinz Hannover, der 1945 ausrief: „Es ist Menschen- und Christenpflicht, für
diese bedauernswerten Mitmenschen zu sorgen!“
Aufbaujahre - Schwere Jahre
Sie erlebten viele Jahre der Entbehrungen. Sie kamen in ein Land, das vom Nationalsozialismus be
freit war, doch dessen Städte in Schutt und Asche lagen. Die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen
kamen als Bettler, in Lumpen gekleidet. Halb tot vor Hunger und Erschöpfung drängten sie in zer
störte Städte und überfüllte Dörfer. Sie mussten sich, oft über Jahre hinweg, mit behelfsmäßigen
Unterkünften in Lagern, Baracken, Ställen oder in engen Wohnungen begnügen. Hinzu kam, dass
die aufnehmende Bevölkerung sie nicht überall mit offenen Armen empfing. Sie wurden teilweise
beschimpft und oft genug als Belastung empfunden. Wer seine Trauer über die verlorene Heimat
nicht bei sich behielt oder die Gräuel der Flucht zu schildern versuchte, setzte sich dem Verdacht
der Vergeltungssucht aus.
Die Westdeutschen waren noch einmal davongekommen und wollten von den Erlebnissen der
Flüchtlinge häufig nichts wissen.
Viele von Ihnen hier im Saal haben das am eigenen Leibe erfahren: Jahrelang mussten mehrere Fa
milien unter einem Dach wohnen oder zwei Familien teilten sich eine Wohnung. Für uns ist das
heute unvorstellbar.
Die damalige Stimmung im Lande wird anhand von Zitaten deutlich, die im Rahmen der Veröffent
lichung „Hier geblieben“ in Niedersachsen dokumentiert wurden:
• „Die Flüchtlinge und die Kartoffelkäfer, die werden wir nie mehr los“!
• „Wir merkten bald, dass wir ungebetene Eindringlinge waren“.
• „Die sind nichts und die haben nichts“, sagten Bürger über Flüchtlinge und Vertriebene.
Es gab aber auch viele Beispiele von großer Hilfsbereitschaft. Auch die Wohlfahrtsverbände wie In
nere Mission, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz und Arbeiterwohlfahrt halfen. Sie versorgten Fami
lien, Kinder, Kriegsversehrte und die vielen alten Menschen, die vielfach ihr Hab und Gut, bis auf
das Wenige, das sie tragen konnten, zurücklassen mussten. Es gab Menschen, die gaben Arbeit oder
unterstützten Familien mit Kindern. Sie halfen oder hörten einfach zu.
Übernahme der Patenschaft
In diesen Zeiten unterschrieb 1950 Heinrich Albertz, damals Niedersächsischer Minister für Ver
triebene, Sozial- und Gesundheitsangelegenheiten, die Patenschaftsurkunde für die Landsmann
schaft Schlesien. Dies war der Beginn einer ganz besonderen Verbindung.
1950 hatte Niedersachsen 2,3 Millionen Einwohner mehr als vor Kriegsausbruch, nämlich 6,8 Mil
lionen. Die meisten Zuzügler kamen aus Schlesien. Etwa 700.000 Schlesier blieben in Niedersach
sen und haben hier ihre neue Heimat gefunden.
Heinrich Albertz setzte damit ein Zeichen, das man etwa so zusammenfassen könnte:
• Wir müssen zueinander stehen!
• Nur gemeinsam können wir den Aufbau schaffen!
Der Wiederaufbau/ Seite an Seite in ein neues Leben
Sicher unterstützte der schnelle und dringend notwendige Wiederaufbau des zerstörten Deutsch
lands die Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen in der neuen Heimat.• Neubauprogramme für Flüchtlinge und Vertriebene ließen in niedersächsischen Ortschaften
Ein- und Mehrfamilienhäuser wachsen.
• Straßen wurden nach den Herkunftsgebieten der Flüchtlinge und Vertriebenen benannt und
erinnerten an ihre alte Heimat.
• Viele neue Existenzgründungen symbolisierten den Willen, sich auf Dauer in der neuen Hei
mat niederzulassen.
Das galt im Kleinen wie im Großen.
Was wäre Niedersachsen ohne die schlesischen Fleischer und Bäcker? Was wären wir ohne die vie
len schlesischen Unternehmer, die hier bei uns in Niedersachsen ihre Firmen wieder aufgebaut ha
ben?
Viele Firmen verlegten gezwungenermaßen ihren Sitz. Geschäftsführung, Facharbeiter und die Ge
schäftsfelder von z.B. in Schlesien ansässigen Firmen wurden mit den Menschen vertrieben. In Nie
dersachsen hat nach dem Krieg beispielsweise die Waggonbaufirma Linke-Hoffmann-Busch in
Salzgitter ihre Arbeit aufgenommen. Sie hatte vormals in Breslau ihren Sitz.
Auch und gerade die vielen Menschen aus Handwerk und Bergbau haben einen großen Anteil an
dem gehabt, was wir auch heute noch respektvoll „das Wirtschaftswunder“ nennen.
Ob der Gärtnermeister mit seinem neu gegründeten Betrieb in der Nähe von Braunschweig oder der
Hüttenfacharbeiter aus Oberschlesien, der in Salzgitter wieder Arbeit fand, ob der Fleischer aus
Neisse oder der Bäcker aus Glogau.
Sie haben nach der Vertreibung, ich sage dies bewusst, Bewundernswertes vollbracht. Sie haben
nicht nur Ihr eigenes Schicksal gemeistert und das zerstörte Deutschland aus Trümmern, Schutt und
Asche mit aufgebaut, sondern Sie haben die Hand zur Versöhnung gereicht. Ihnen hat unser Land
Enormes zu verdanken.
Diese Erfolgsgeschichte der Integration so vieler Menschen lässt hoffen, dass wir auch die heute
vor uns liegenden Probleme lösen werden.
Familienglück oder: Warum haben so viele Niedersachsen schlesische
Wurzeln?
Die Liebe - sie war es, die Einheimische und Flüchtlinge und Heimatvertriebene immer mehr zu
sammenband. Die Heimatvertriebenen fanden nicht nur ihre neue Heimat zwischen Borkum und
Hannoversch-Münden, sondern vielfach auch die Liebe ihres Lebens- wie man so schön sagt.
Schon 1950 hatten die Vertriebenen zu mehr als der Hälfte mit einheimischen Partnern den Bund
der Ehe geschlossen. Niedersachsen kann heute wesentliche Beiträge zur Ökumene leisten gerade
wegen der Katholiken, die nach Niedersachsen kamen.
Fragen Sie heute mal einen Niedersachsen, woher seine Eltern stammen. Mir kommt es so vor, als
ob fast jeder, dem ich diese Frage stelle, wenigstens einen schlesischen Elternteil hat. Mir werden
dann häufig sofort schlesische Familientraditionen, schlesische Gerichte genannt, wie schlesischer
Butterkuchen oder die leckeren schlesischen Würste.
Medienberichte und der Film „Flucht und Vertreibung“
Immer dann, wenn die Geschehnisse als Einzelschicksal einen Namen erhalten, z.B. durch die im
familiären Kreis vermittelten Erlebnisse der Großeltern oder Eltern, wird das Ausmaß von Flucht
und Vertreibung auch für die Jüngeren deutlich. Ein besonderer Beitrag war in diesem Jahr mit Si
cherheit der Film „Die Flucht“.
Gut 12 Millionen Menschen verfolgten am Fernseher diesen Film, der deutlich machte, dass die Be
troffenen und Opfer im Wesentlichen Frauen und Kinder waren. Auch die anschließenden Informa
tionssendungen hatten außergewöhnlich hohe Einschaltquoten.Überall in Deutschland erschienen in Zeitungen Zeitzeugenberichte.
Die Bild-Zeitung brachte das Buch „Deutsche auf der Flucht“ mit 102 Zeitzeugenberichten heraus.
Die Leser sind zutiefst erschüttert. Viele von denen, die ihre Vertreibungserlebnisse schildern, bra
chen jetzt - 60 Jahre später - erstmals ihr Schweigen. Darunter vielleicht auch der eine oder andere
von Ihnen. Die meisten dieser Berichte stammen von denen, die damals noch Kinder waren. Die
Kriegskinder haben Schlimmes erlebt, Unfassbares gesehen. Diese Kinder sahen Menschen erfrie
ren, ihre Geschwister sterben. Sie sahen, wie Frauen vergewaltigt und Menschen erschossen wur
den. Und es entstand der Auftrag: Nie wieder, nie wieder Krieg.
Auch die Hannoversche Allgemeine Zeitung hat Erinnerungen ihrer Leser veröffentlicht, die im
Sonderdruck „Der lange Weg“ herausgegeben wurde.
Allein die Überschriften machen das Ausmaß der Tragödien, die sich abspielten, deutlich. „Jeder
wollte nur seine Familie retten“, „Ich wollte mit 14 Jahren noch nicht sterben“.
Die Berichte handeln von unvorstellbarem Leid, aber auch von Lebenswillen und von der Hoffnung
auf eine bessere Zukunft. Heute leben wir in Frieden und Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlich
keit und immer mehr halten dies für selbstverständlich.
Schule, Schulmaterial und Schulexkursionen
Was weiß man eigentlich über das Schicksal der über 14 Mio. geflüchteten und vertriebenen Deut
schen, was will man überhaupt noch wissen? Nachrichten über Vertreibungen und Völkermord er
reichen uns längst nicht mehr nur von fernen Kontinenten. Über viele Jahre wurde das Thema in
den Medien totgeschwiegen und als Thema in den Schulen vernachlässigt.
Wir sorgen für eine angemessene Behandlung des Themas in unseren Schulen.
• Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport hat die Schulen mit der DVD „Die
große Flucht“ ausgestattet. Sie enthält umfangreiches Filmmaterial und Aussagen von Zeitzeu
gen.
• Außerdem haben wir die in Baden-Württemberg entstandene Dokumentation „Umsiedlung,
Flucht und Vertreibung der Deutschen als internationales Problem“ in einer Auflage von 5.000
Exemplaren nachgedruckt und den niedersächsischen Schulen zur Verfügung gestellt.
Die Dokumentation ist auf ein breites Interesse gestoßen. Das gilt vor allem für die Lehrer, aber
auch für viele Bürger, die aus der Presse von der Herausgabe der Dokumentation erfahren haben.
Aber auch der Besuch von Gedenkstätten ist ein wichtiger Baustein, um Geschichte erfahrbar zu
machen.
Schülerinnen und Schüler sollen weiterhin diese „Orte des Erinnerns“ in Exkursionen besuchen.
Einrichtung einer Gedenkstätte in Friedland
Die Landesregierung möchte in Friedland eine Gedenkstätte einzurichten, die die historische Be
deutung dieses Ortes für die deutsche Nachkriegsgeschichte auch jüngeren Menschen nahe bringen
soll.
Friedland hat viele Schicksale gesehen. Wie kein anderer Ort ist Friedland geeignet die Geschichte
von Flucht und Vertreibung und die Aufnahme der Spätheimkehrer als zentrale Themen aufzuneh
men. In einem ersten Schritt soll das in Niedersachsen befindliche Kulturgut der Vertriebenen gesi
chert werden. Es wird heute überwiegend ehrenamtlich in sog. Heimatstuben verwahrt. In manch ei
ner Heimatstube befinden sich wahre Schätze.
Wenn einzelne Einrichtungen nicht mehr weiterbetrieben werden können, werden die Exponate in
Friedland aufgenommen, katalogisiert und ausgestellt. Der hierfür eingerichtete Beirat, dem auch
der ehemalige Landtagspräsident Horst Milde angehört, wird zu seiner zweiten Sitzung im Herbst
dieses Jahres zusammentreffen.Durch dieses Projekt sorgt bundesweit erstmals eine staatliche Stelle außerhalb der landsmann schaftlichen Museen dafür, dass das Kulturgut der Vertriebenen für die Zukunft erhalten wird. Tidofelder Gnadenkirche Ich begrüße auch Initiativen, wie die der „Stiftung Tidofelder Gnadenkirche“ in Norden. Es soll eine Dokumentationsstätte entstehen, die die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen dar stellt. Die Hannoversche Landeskirche stellt das Gebäude und das Grundstück unentgeltlich zur Verfü gung. Die Gnadenkirche Tidofeld wurde 1961 an Stelle einer Barackenkirche erbaut, die den evan gelischen und katholischen Vertriebenen eines der größten Vertriebenenlager in Norddeutschland eine Heimat bot. Für ein Zentrum gegen Vertreibungen Ein Zitat von Wilhelm von Humboldt lautet: „Wer keine Vergangenheit haben will, der hat auch keine Zukunft.“ Ich frage Sie, liebe Schlesier, sind wir nicht alle überzeugt, dass die Zukunft keine gute sein kann, wenn die Vergangenheit weggeschlossen wird? Zukunft gelingt nur, wenn die Vergangenheit darin nicht mehr rumort und weiterwühlt. Die Vergangenheit muss aufgearbeitet und in die Zukunft eingearbeitet und somit geheilt werden. Erinnerungen gehören zu unserem Leben dazu. Wir erinnern uns gerne an die schönen Momente des Lebens: Als uns die Liebe begegnete. Als wir unsere Kinder zum ersten Mal im Arm halten konnten. Als wir eine gute Arbeit fanden. Genauso gibt es Erinnerungen, die uns das Herz zerrei ßen. Seelischer Schmerz, der kaum auszuhalten ist. Diese sind es, die fest verschlossen im Inneren ruhen. Irgendwann dann bahnen sie sich ihren Weg nach draußen. Sie lassen sich nicht mehr fest halten. Ihre Erinnerungen an die Vertreibung dürfen nicht vergessen werden. Aus zahlreichen per sönlichen Gesprächen mit Betroffenen und den Landsmannschaften sowie aus einer Vielzahl von schriftlichen Veröffentlichungen weiß ich: Sie wollen schlicht keine Tabuisierung oder Verharmlo sung erlittenen Unrechts. Sie wollen daraus Lehren für die Zukunft. Solange die Menschen der Erlebnisgeneration berichten können, müssen kostbare Erinnerungen ge sammelt werden. Wird ein Mensch von seinem Haus und Boden vertrieben, ist das traumatisch und gräbt sich bis an das Lebensende in seine Seele ein. Vertreibungen - von wem auch immer sie ausgehen - sind durch nichts zu rechtfertigen. Um es mit den Worten von Altbundespräsident Roman Herzog zu sagen: „Ein Verbrechen bleibt ein Verbrechen, auch wenn ihm ein anderes vorausging“. Deshalb unterstützt meine Landesregierung den Bau eines Zentrums gegen Vertreibungen. Nicht um Geschichte umzudeuten oder aus Tätern Opfer zu machen. Die Schuld Deutschlands am zweiten Weltkrieg und an den Kriegsfolgen ist unbestritten und unbestreitbar! Aber: Das Unrecht an Vertriebenen zu dokumentieren, zu erinnern und zu mahnen - und zwar nicht ausschließlich auf Deutschland bezogen, sondern europaweit - ist wichtig und notwendig, um zu künftig Vertreibungen zu verhindern. Denn nach wie vor gibt es millionenfach Vertreibungen ohne entsprechende Ächtung. Vertreibungen müssen weltweit geächtet werden. Das 20. Jahrhundert war, wie keines zuvor, ein Jahrhundert der Vertreibungen. Fassungslos verfolgen wir auch heute noch Bilder von Menschen, die ebenfalls ihrer Heimat beraubt, geschunden und getötet werden. Besonders nahe gegangen sind uns die Bilder der 90er Jahre, als wir die Vertreibungen der Menschen im ehemaligen Jugoslawien miterlebten. Vertreibungen europaweit zu dokumentieren ist Aufgabe eines solchen Zentrums. Eine nachhaltige
Wirkung kann dieses Zentrum nur entfalten, wenn die nachfolgenden Generationen Gelegenheit ha ben, sich mit diesem Thema und den Ereignissen im Geiste der Aussöhnung auseinandersetzen. Ein solches Zentrum kann nur in Berlin stehen. Wie in keiner anderen Stadt wurde in Berlin die Ge schichte des 20. Jahrhunderts sinnfällig und deutlich: Die Brüche und die Wendepunkte des Jahr hunderts wurden hier markiert. Ausbruch und Ende des Ersten Weltkriegs, Hitlers Machtergreifung, die Entfesselung des Zweiten Weltkrieges, die Planung des Mordes an Abermillionen Menschen, die Eroberung durch die Rote Armee, Mauerbau und Mauerfall, das Ende der Spaltung Europas - Berlin ist der Geschichtsort für den ganzen Kontinent. Und gerade weil das 20. Jahrhundert nicht nur ein Jahrhundert der Kriege war, sondern auch ein Jahrhundert von Flucht und Vertreibung - gerade deshalb passt ein solches deutsches und europä isches Zentrum gegen Vertreibung nach Berlin. Durch wissenschaftliche Auswertung der Vertreibungsereignisse in Europa und der Welt müssen wir einen Beitrag dazu leisten, dass Vertreibungen sich nicht wiederholen. Charta der Heimatvertriebenen Sie haben sich bereits im Jahre 1950 in der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen", für ein ge eintes Europas ausgesprochen „in dem die Völker ohne Furcht und Zwang leben können". Für mich ist diese Charta eines der bedeutendsten Dokumente deutscher Nachkriegsgeschichte, denn Sie haben Gewalt und Vergeltung für immer abgeschworen. Das ist ein Dokument des Frie dens. Perspektive Europa Heute, mit der Erweiterung der Europäischen Union um die mittelosteuropäischen Staaten sind wir der damaligen Vision von einem geeinten Europa sehr nahe gekommen. Besuche in der alten Hei mat sind für viele von Ihnen schon lange zur Selbstverständlichkeit geworden. Die Verbundenheit der Heimatvertriebenen zu ihren Heimatorten in Schlesien hat zu vielfältigen Kontakten geführt, aus denen sich zahlreiche Schul- und Städtepartnerschaften entwickelt haben. Kontakte und Begeg nungen, die auch die jüngeren Generationen beider Seiten miteinander verbinden. Dieses Engagement vieler Vertriebener in der Heimat ist die wirklich tragende Brücke in eine Zu kunft in einem gemeinsamen Europa. Durch den Beitritt Polens zur Europäischen Union haben wir eine Freizügigkeit erreicht, die es Ih nen möglich macht, Ihre alte Heimat regelmäßig zu besuchen. Ich möchte an dieser Stelle an Ihren ehemaligen Ehrenvorsitzenden der Landsmannschaft Schlesien, Herrn Dr. Herbert Hupka erinnern. Herbert Hupka hat über Jahrzehnte nicht nur für die Vertrie benen hier im Westen gekämpft und gearbeitet. Er hat sich besonders aktiv auch für die heute noch in Schlesien lebenden Deutschen eingesetzt, für ihre Kultur, für ihr Recht auf Selbstbestimmung. Immer wieder hat er das Gespräch, die Verständigung mit Polen gesucht. Herbert Hupka hat sich um die deutschen Heimatvertriebenen, um die Deutschen im Osten verdient gemacht. Er erzählte mir einmal eine kleine Anekdote, die deutlich macht, wie sehr er mit Schlesien verbun den ist und bleiben wird. Er führte aus (Zitatanfang): „Als ich von einer jungen polnischen Journalistin gefragt wurde, wie es sein könne, dass ich mich heute noch als Schlesier fühle, obwohl ich nunmehr 60 Jahre in der Bun desrepublik lebe, habe ich geantwortet: „Ein Schlesier bleibt immer ein Schlesier, wie ein Bayer im mer ein Bayer bleibt, gleich ob er in Bayern oder an einem anderen Ort lebt“. (Zitatende) Dieses Gefühl werden Sie alle nachempfinden können. Sie alle fühlen sich - wie er - Ihrem Land Schlesien an der Oder verbunden. Verbunden mit den Städten Breslau, Oppeln, Hindenburg, Rati bor, Glogau, Liegnitz, Neisse oder dem schönen Annaberg. Schlesien ist Teil der Geschichte
Deutschlands. Es ist unsere Aufgabe, dieses Bewusstsein unseren Nachkommen zu erhalten. Dr. Herbert Hupka ist in Ratibor aufgewachsen, wurde 1945 vertrieben. 1998 wurde er im heutigen Polen, in seiner Stadt Ratibor "verdienter Bürger der Stadt Ratibor (Racibòrz)". Er ist stets auf Men schen zugegangen, um zu verbinden - nicht, um zu trennen! Rechtsextremismus Sehr geehrte Damen und Herren, dabei müssen sich aber gerade die Vertriebenen davor hüten, mit Menschen in Kontakt gebracht zu werden, die sie für ihre Zwecke missbrauchen. Rechtsextreme Zeitungsverlage oder einzelne Per sonen ziehen die Belange und die berechtigten Interessen der Heimatvertriebenen und die Vergan genheit in den Schmutz. Zeigen Sie deutlich, dass Sie mit rechtsextremem Gedankengut nichts zu tun haben! Der Blick nach vorn oder „Auto fahren“ Herbert Hupka forderte in seinem letzten Buch „Schlesien lebt“ - zu dem er mich um ein Geleitwort gebeten hat - dazu auf, den Blick nach vorn zu richten. Genauso wie ein Autofahrer nicht nur mit dem Blick in den Rückspiegel fahren kann, darf auch Schlesien nicht nur in der Vergangenheit gesehen werden. Schlesien braucht uns auch in Zukunft. Niedersachsen setzt auf die Zusammenarbeit, um der gemeinsamen Verantwortung der deutschen und der polnischen Seite für Schlesien und seine Kultur gerecht zu werden. Kulturpreis Schlesien Ein Zeichen der besonderen Verbundenheit Niedersachsens mit den Schlesiern und mit Schlesien ist der Kulturpreis Schlesien, der jährlich im Wechsel in Niedersachsen und Schlesien verliehen wird. Er ist für die polnische und die niedersächsische Seite aber auch für die Heimatvertriebenen ein ver bindendes, auf Aussöhnung gerichtetes Ereignis. Der Kulturpreis Schlesien ist zu einer festen Insti tution im vielfältigen Kulturaustausch nicht nur zwischen Niedersachsen und Niederschlesien, son dern zwischen Deutschland und Polen insgesamt geworden. In diesem Jahr wird der Preis - übri gens zum 30. Mal - verliehen. Wieder in Niedersachsen - diesmal in Wolfsburg. Nachbarschaftliche Projekte/ Partnerschaft mit den Woje wodschaften Über die Patenschaft Schlesien und den Kulturpreis Schlesien haben sich zwischen Niedersachsen und Schlesien, insbesondere Niederschlesien, gute Kontakte entwickelt. Sie sind die Basis für die heute bestehende gute und lebendige Partnerschaft zwischen Niedersach sen und der Woiwodschaft Niederschlesien. Wegbereiter waren auch hier die Vertriebenen, die - so bald es möglich war - ihre alte Heimat besucht haben. In vielen Fällen haben sich daraus Partner schaften auf kommunaler Ebene entwickelt. Niedersachsen hat 1993 als eines der ersten Länder der Bundesrepublik Deutschland Partnerschafts vereinbarungen mit den damaligen Woiwodschaften Breslau und Posen abgeschlossen. Partner schaften, die so erfolgreich waren, dass sie nach der polnischen Verwaltungs- und Gebietsreform - aus 49 Woiwodschaften wurden 16 - mit den beiden sehr viel bedeutenderen und größeren Woi wodschaften Niederschlesien und Großpolen erneuert wurden. Wir müssen uns mit Polen befassen: mit dem Land, mit den Menschen, mit den unterschiedlichen Positionen, mit den Befürchtungen und Sorgen unserer unmittelbaren Nachbarn. Solange wir den Austausch pflegen und fördern und uns für einander interessieren, sind wir auf dem richtigen Weg.
Kontakte nach Schlesien
Es bestehen vielfältige Kontakte auf den unterschiedlichsten Ebenen zu Niederschlesien, von denen
ich nur einige nennen möchte:
• Niedersächsische Vertragslehrer sind in Niederschlesien nach wie vor zur Unterstützung des
Deutschunterrichtes tätig. Durch Seminare in Niedersachsen für künftige polnische Deutschleh
rer werden mittelbar niedersächsisch-niederschlesische Schulpartnerschaften gefördert.
Mit über 165 niedersächsischen Schulen, die mit polnischen Schulen zusammenarbeiten, kön
nen wir uns sehen lassen.
• Der Niedersächsische Landtag hat seinen europäischen Schülerwettbewerb für nie
derschlesische Schulklassen geöffnet.
So haben zwei Schulklassen aus Niederschlesien 2006 an der Preisverleihung zum europäischen
Schulwettbewerb und der sich anschließenden Diskussionsveranstaltung mit Europa- und
Landtagsabgeordneten im Niedersächsischen Landtag teilgenommen.
• Auch die Zusammenarbeit der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel mit der TU
Breslau wird intensiviert: durch Studentenexkursionen, Stipendien für polnische Diplomanden
und gemeinsame Ausbildungsmodule. So wird ermöglicht, Teile des Studiums in Breslau und
Niedersachsen zu absolvieren.
• Die Jugendbegegnungsstätte Kreisau in Niederschlesien wird von Niedersachsen unterstützt.
Ich persönlich bin Gründungsmitglied der Freya von Moltke-Stiftung für das neue Kreisau und
Mitglied im Stiftungskuratorium.
Der deutsche Widerstand des 20. Juli 1944 hat hier eine große Wirkung in die Zukunft hinein.
• Darüber hinaus bestehen zahlreiche Städtepartnerschaften, z.B. Langenhagen-Glogau, Lüne
burg-Oels, und Barsinghausen-Brieg.
Die Zusammenarbeit Niedersachsen - Niederschlesien ist aus meiner Sicht eine Erfolgsgeschichte.
Auch wenn es in der großen Politik das eine oder andere Mal Irritationen gibt.
Ich freue mich, dass unsere polnischen Freunde gleichberechtigtes Mitglied der Europäischen Uni
on sind.
Besuch des Marschalls der Wojewodschaft Niederschlesien
im Herbst
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Niedersächsische Landesregierung legt Wert auf sehr gute und intensive Beziehungen zu un
seren polnischen Nachbarn. Diese sind zu beiderseitigem Nutzen.
Auch wenn die derzeitige polnische Regierung eine Zusammenarbeit erschwert, weiß ich aus vielen
Begegnungen mit den Menschen in Polen: Ihnen ist an einem guten Kontakt zwischen Polen und
Deutschen gelegen.
Deshalb freue ich mich, dass der neue Marschall der Wojewodschaft Niederschlesien im September
dieses Jahres Niedersachsen besuchen wird. Es zeigt, das beide Seiten der seit 1993 bestehenden
Partnerschaft des Landes Niedersachsen mit der Wojewodschaft Niederschlesien eine besondere
Bedeutung zumessen.
Aus dem gleichen Grund wird sich Niedersachsen mit einer Informationsveranstaltung in Nieder
schlesien und Großpolen präsentieren.Motto „Schlesien verpflichtet“ Denn: Schlesien verpflichtet! Niedersachsen fühlt sich Schlesien und den Schlesiern verpflichtet. Wir wollen gemeinsam mit den heute in Schlesien lebenden Polen und den dort verbliebenen Deutschen die Kultur Schlesiens pfle gen und bewahren. Sie ist Teil der deutschen Kulturgeschichte und wird es bleiben. Preußische Treuhand Kräften, die Trauer und Erinnerung als Vorwand für eine neue Spaltung Europas missbrauchen und damit diesen Prozess stören wollen, sollten wir auch im Interesse Schlesiens eine klare Absage er teilen. Wir müssen jetzt den Blick auf die gemeinsame Zukunft in der Europäischen Union richten. Ich glaube, dass jede Form von materieller Aufrechnung zur Verhärtung der Fronten zwischen Deutsch land und Polen führen. Eine Konkurrenz unter den Opfern beider Seiten bringt uns auf unserem ge meinsamen Weg nicht weiter. Mehr denn je brauchen wir den Dialog mit unseren Nachbarn auf dem Weg in eine gemeinsame europäische Zukunft. Die Initiative der „Preußischen Treuhand“ leh ne ich deshalb ausdrücklich ab. Die Worte der Danziger Erklärung, der sich auch unser Bundespräsident Prof. Horst Köhler bei sei nem Besuch in Polen angeschlossen hat sind eindrucksvoll: „Es darf keinen Raum mehr geben für Entschädigungsansprüche, für gegenseitige Schuldzuweisungen und für das Aufrechnen der Verbre chen und Verluste. Wir sollten unsere Kräfte darauf konzentrieren, gemeinsam die Zukunft Europas zu gestalten“. 60. Geburtstag der Patenschaft 2010 Das Schicksal der Vertriebenen ist nicht vergessen. Nur in vollständiger Aufarbeitung der jüngeren deutschen und europäischen Geschichte kann die Aussöhnung mit unseren Nachbarn gelingen. Sie können sicher sein, dass die Niedersächsische Landesregierung sich den Vertriebenen in Kennt nis ihres schweren Schicksals und des bedeutenden Beitrags, den sie zum Aufbau unseres Landes geleistet haben, in besonderem Maße verbunden fühlt. Und eines verspreche ich Ihnen: Den 60. Geburtstag der Patenschaft Niedersachsens und der Lands mannschaft Schlesien werden wir 2010 mit einem großen Fest feiern. Ich freue mich schon darauf! Für Ihr Deutschlandtreffen hier bei uns in Hannover wünsche ich Ihnen viel Freude, interessante Begegnungen und ein herzliches Schlesien, Glück auf!
Sie können auch lesen