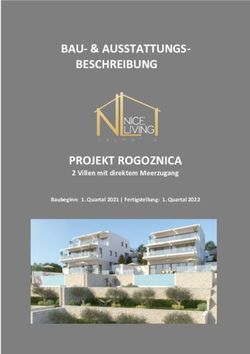Reorganisation der Lehre: Mehr Lehr- und Lernqualität durch veränderte Studiengangsstrukturen - Hochschul-Symposium 2019 Hochschule Emden/Leer ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Reorganisation der Lehre:
Mehr Lehr- und Lernqualität
durch veränderte
Studiengangsstrukturen
5. Hochschul-Symposium 2019
Hochschule Emden/Leer
01.07.2019
Dr. Christiane Metzger
01.07.19 Seite 1Agenda § Erkenntnisse aus Workload-Erhebungen § Reorganisation der Lehre: geblockte Module § Motivationstheoretischer Hintergrund 01.07.19 Seite 2
Lehrzeit und Lernzeit.
Studierbarkeit der BA-/BSc- und MA-/MSc-
Studiengänge als Adaption von Lehrorganisation
und Zeitmanagement unter Berücksichtigung
von Fächerkultur und Neuen Technologien
Universität Hamburg
Universität Mainz
Prof. Dr. Rolf Schulmeister
Prof. Dr. Stefan Aufenanger
Zentrum für Hochschul-
Pädagogisches Institut
und Weiterbildung
TU Universität Ilmenau Universität Hildesheim
Prof. Dr. Heidi Krömker Prof. Dr. Erwin Wagner
Institut für Medientechnik Center for lifelong
learning
01.07.19 Seite 4Workload
§ Vergabe von ECTS-Leistungspunkten
- Präsenz
- Selbststudium (inkl. Vor-/Nachbereitung von
Lehrveranstaltungen, Prüfungsvorbereitung, Praktika etc.)
§ 30 Leistungspunkte pro Semester
§ 1 Leistungspunkt entspricht 25-30 Arbeitsstunden
§ 1 Semester = 22,5 Wochen bei 3,5 Wochen Urlaub
Semester 750-900 Std.
September Oktober November Dezember Januar Februar
Woche à 33-40 Std.
01.07.19 Seite 5Workload-Erhebung durch Zeitbudgets
Interdisziplinäre Streuung
40
35
30
M Std. pro Woche
25
20
15
10
5
0
a
ik
1
1
g
h
P1
P2
1
M
f
s1
s2
L
ik
UK
i1
i2
he
It
eu
ru
nf
BW
m
n
c
ch
ha
Im
hn
Kd
W
W
ys
is
is
Ar
at
aD
SO
SO
uI
Be
M
eo
gI
Te
ec
Ku
Ku
zW
zW
Ph
ec
M
Ba
M
In
hr
G
M
ed
Et
Er
Er
hr
Le
M
Le
Studiengänge
Workload M pro Woche Selbststudium M pro Woche
01.07.19 Seite 7Interindividuelle Streuung
Präsenz Selbststudium
40
32
M Std. pro Woche
24
16
8
0
Pbn01 Pbn10 Pbn19 Pbn28 Pbn37 Pbn46 Pbn55 Pbn64
Präsenz und Selbststudium von 70 Maschinenbau-Studierenden
über 5,5 Monate
01.07.19 Seite 9Einfluss der Lehrorganisation 01.07.19 Seite 10
Mittlere Workload im Semesterverlauf
BSc Geomatik BSc BWL
45 45
40 40
35 35
M Std/Pbn
30 30
M Std/Pbn
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
2
4
6
8
44
46
48
50
52
10
12
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
SS 2011, M = 22 Std/Woche WS 2010/11, M = 25 Std/Woche
BSc Mechatronik BA Medien- u. Komm.wiss
45 45
40 40
35 35
30 30
M Std/Pbn
M Std/Pbn
25 25
20 20
15 15
10 10
5 5
0 0
…
…
…
…
…
…
2
4
6
8
45
47
49
51
53
10
12
1
3
5
7
9
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
KW
WS 2009/10, M = 24 Std/Woche WS 2009/10, M = 25 Std/Woche
01.07.19 Seite 1101.07.19 Seite 12
01.07.19 Seite 13
01.07.19 Seite 14
01.07.19 Seite 15
Abhängigkeiten von Variablen in Bezug zur Workload
aus: Schulmeister, 2014, S. 199
01.07.19 Seite 16Reorganisation der Lehre 01.07.19 Seite 17
Herkömmliche Lehrorganisation
Mo Di Mi Do Fr
Nebenfach
Wahlfach B
Modul A: Modul B: Seminar
Vorlesung Vorlesung Modul C
Seminar
Modul B Modul A
Seminar Tutorium
NF: Übung
Modul B
Tutorium
Modul A
Seminar
Wahlfach A
Modul C:
Tutorium
01.07.19 Seite 18Herkömmliche Lehrorganisation
April Mai Juni Juli Aug Sept
Unternehmens-
praktikum
Urlaub
Prüfungen
01.07.19 Seite 19Lehrorganisation in geblockten Modulen
Mo Di Mi Do Fr
Modul A: Modul A:
Vorlesung Vorlesung Nebenfach
Modul A: Wahlfach B
Seminar
Selbst-
studium
Modul A: Modul A:
Selbst- Selbst-
studium studium Nebenfach
Modul A: Tutorium
Tutorium Wahlfach A
Modul A: Modul A:
Seminar Modul A: Seminar
Seminar
01.07.19 Seite 20Lehrorganisation in geblockten Modulen 01.07.19 Seite 21
Ziele Maßnahmen
‣ keine Konkurrenz zw. ‣ organisationale
Modulen Trennung von Modulen
‣ Konzentration auf einen bzw. ‣ Verzahnung von
wenige Themenkomplexe Präsenz- und
Selbststudienphasen
‣ Reduktion von ungenutzten
Zeitlücken im Stundenplan ‣ zeitnahe Rückmeldung
(individuell,
‣ höhere, gleichmäßigere exemplarisch)
Zeitinvestition in
Auseinandersetzung mit ‣ studienbegleitendes
Studieninhalten Prüfen
‣ bessere Orientierung im
Lernprozess
‣ Reduzierung der
Durchfallquote
01.07.19 Seite 22Umsetzungsbeispiel:
FH St. Pölten
01.07.19 Seite 23Ausgangssituation
§ Kampf um die „Ressource“ Student/in
- Der „Stärkere“ gewinnt.
- Studierende lernen nur für Prüfungen.
- Die geplante Belastung/der Zeitaufwand stimmt
nicht mit der Realität überein.
§ Unzufriedenheit über Selbstlernphasen
- Es kommt zu Belastungsspitzen durch gleichzeitige
Vergabe von Projektaufträgen.
- Großzügige Fristen führen zur „aufschiebenden“
Wirkung bei den Studierenden.
§ erzielte Kompetenz trifft nur teilweise die im Curriculum
geplanten Ziele
01.07.19 Seite 24Rahmenbedingungen für die Reorganisation der Lehre § Umfang der Präsenzzeit bleibt gleich § keine Vorgaben bzgl. der Verteilung und Länge der Präsenzzeiten § Auswahl der Blöcke § Festlegung der Reihenfolge der Blöcke § organisatorische Rahmenbedingungen: Umgang mit Krankheit, Räumen, Lehrbeauftragte etc. 01.07.19 Seite 25
Rekonzipierung der Teilmodule § Gab es Veränderungen beim Lehr-/Lernstoff? (Umfang, Anordnung, …) § Mit welchen Methoden wird sicher gestellt, dass die Studierenden zeitnah Rückmeldung erhalten? § Nach welchen Kriterien wurden die Aufgaben für das Selbststudium entwickelt? § Welche Prüfungsformate eignen sich besonders? 01.07.19 Seite 26
Geblockte Module:
Die Umstellung des 1. Semesters
Wintersemester 2011/12
26.09.2011 19.02.2012
Recht
Recht
Netzwerk- Betriebs- Programmie- Weihnachts- Betriebs- vorlesungs-
Mathematik
technik systeme 1 ren ferien systeme 2 freie Zeit
22.12.- 28.01.-
27.01.
26.09.-21.10. 24.10.-11.11. 14.-30.11. 05.-21.12. 09.-25.01.
02.12
26.-
01.- 08.01. 19.02.
• Prüfung jeweils am Ende jedes Blocks
• Englisch fortlaufend parallel
01.07.19 Seite 28Verzahnung von Präsenz- und
Selbststudium
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
Theorie Theorie Theorie
Selbst- Selbst-
studium studium
Labor- Labor- Labor-
(Protokoll und (indiv.
übung übung übung
Analyse) Übungs-
aufgaben)
Labor- Gruppen- Gruppen-
übung arbeit arbeit
01.07.19 Seite 29Erzielte Ergebnisse 01.07.19 Seite 30
Eindrücke der Lehrenden
§ höhere subjektive Belastung durch zeitnahe
Rückmeldung
§ höhere eigene Motivation durch:
§ näheren Kontakt zu Studierenden
- größeres Verantwortungsgefühl für Lernprozesse
- bessere Mitarbeit der Studierenden
§ Vorteil: vor und nach dem Block Zeit für Forschung
01.07.19 Seite 31Eindrücke der Studierenden
stimme voll und ganz zu stimme überwiegend zu
stimme teilweise zu stimme nicht zu
Mir ist deutlich geworden, welche Rele-vanz
Das Wintersemester hat mir Ich bin zufrieden mit dem, was ich
die Inhalte der Lehrveranstaltungen für den
insgesamt gut gefallen. gelernt habe.
späteren Beruf haben.
7 3 1
1 1
21 2 2 5
5
Ich wusste, was ich in den In den Selbststudienphasen wurde Es gab ausreichend Rückmeldung zu
Selbststudienphasen zu tun ausreichend Unterstützung durch dem, was in den Selbststudienphasen
hatte. Lehrende bzw. Tutoren geboten. erarbeitet wurden.
11 1 6
5 8 1
1
1 1
2 8 1
1 1
01.07.19 Seite 32Auswirkungen auf die Workload
Präsenz Selbststudium
75
WS 2011/12
M = 33,2 Std/Woche
60
45
M ̄Std/Pbn
30
15
0
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06
KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW KW
Netzwerke u.
Programmieren
Recht
Recht
Betriebs- Betriebs-
Mathe verteilte
Systeme
systeme
1 systeme
01.07.19 Seite 33Auswirkungen auf Prüfungsleistungen 01.07.19 Seite 34
Warum funktioniert‘s?
Motivationstheoretischer
Hintergrund
01.07.19 Seite 35Integriertes Handlungsmodell
Martens & Rost (1998), Martens (2012)
Moti- Inten-
Volitions-
vierungs- Motivation tions- Intention Handlung
phase
phase phase
Seite 36Integriertes Handlungsmodell
Martens & Rost (1998), Martens (2012)
Moti- Inten-
Volitions-
vierungs- Motivation tions- Intention Handlung
phase
phase phase
Soll-Ist- Sensitives Verantwortungs-
Lernmotivation
Diskrepanz Coping übernahme
01.07.19 Seite 37Integriertes Handlungsmodell
Martens & Rost (1998), Martens (2012)
Moti- Inten-
Volitions-
vierungs- Motivation tions- Intention Handlung
phase
phase phase
Handlungs-
Handlungs- Kompetenz-
Ergebnis- Lernintention
suche Erwartung
Erwartung
01.07.19 Seite 38Integriertes Handlungsmodell
Martens & Rost (1998), Martens (2012)
Moti- Inten-
Volitions-
vierungs- Motivation tions- Intention Handlung
phase
phase phase
Persistente Selbstkon- Emotions- u. Planen- u. Imple-
Zielver- gruente Ziel- Motivations- Problem- men- Lernhandlung
folgung verfolgung regulation lösen tation
01.07.19 Seite 39Pragmatische Lernmotivation (25.9%)
Fünf Typen der Strategische Lernmotivation (20,5%)
motivationalen Regulation Angstbestimmte Lernmotivation (20%)
Rezessive Lernmotivation (17,1%)
Selbstbestimmte Lernmotivation (16,6%)
7
6
5
4
3
2
1
0
in g
g
)
(R)
io n
ti on
en
s
g
lten
ien
me
z
(R
uen
r
rtu n
tun
Pee
rl eb
Co p
nah
teg
ul at
t
ion
hh a
ntra
ngs
war
ngr
rwa
a
l gs e
inat
ber
g
ives
ns tr
lgs a
urc
stk o
ze
ns re
r
nz e
i s-E
Kon
Erfo
gsü
ras t
D
ress
L er
o
Sel b
otio
e
ebn
serf
ng -
tun
pet
k
-
R ep
Pro
(R)
Em
g
Mis
gu
wor
Ko m
s-Er
tren
u ng
an t
ng
enk
Ans
dlu
V er
Abl
Han
01.07.19 aus: Metzger, Schulmeister & Martens (2012) Seite 40System der geblockten Module
Konsekutive, exklusive Durchführung von Modulen mit Verzahnung von Präsenz- und Selbststudium
Didaktische Elemente Auswirkungen
• keine Konkurrenz zwischen den
Konzentration auf ein Modulen
Thema • kontinuierliches Selbststudium
Individuelle Variablen • Festigung von Wissen und
(Lernmotivation)
{
Fertigkeiten durch Verzahnung
Aufgabe
• Bedrohungswahrnehmung Selbst-
von Lernen und Anwenden
• Emotionsregulation • Angstreduktion durch
studium
• Verantwortungs- Anwendung • Rückmeldung zum individuellen
übernahme Lernstand
• Kompetenzerwartung • Kompetenz-/Erfolgserleben
• Ablenkungsneigung Rückmeldung • Sicherheit, gut vorbereitet zu
• Aufschiebeverhalten sein
(Prokrastination) • studienbegleitende Prüfungen
• Durchhaltevermögen Prüfung • soziale Einbindung in
• selbstkongruente und am Ende des
Arbeitsgruppen
persistente Zielverfolgung Modulblocks,
• keine Ballung von Prüfungen am
Ende der Vorlesungszeit
Anerkennung von
Im Versuch in IT Security:
Selbststudien-
leistungen als • bessere Noten
Prüfungsleistung
• weniger Durchfaller
• früherer Studienabbruch
01.07.19 Seite 41Literatur Martens, T. (2012). Was ist aus dem Integrierten Handlungsmodell geworden? In. W. Kempf & R. Langeheine (Hrsg.), Item-Response-Modelle in der sozialwissenschaftlichen Forschung. Berlin: Regener – S. 210-229. Martens, T. & J. Rost (1998). Der Zusammenhang von wahrgenommener Bedrohung durch Umweltgefahren und der Ausbildung von Handlungsintentionen. Zeitschrift für Experimentelle Psychologie, 45, 4, 345-364. Martens, T. & Metzger, Ch. (2017). Different Transitions towards Learning at University: Exploring the Heterogeneity of Motivational Processes. In E. Kyndt, V. Donche, K. Trigwell & S. Lindblom-Ylänne, (Eds.), Higher Education Transitions: Theory and Research. Earli Book Series "New Perspektives on Learning and Instruction" (pp. 31-46). London: Routledge. Metzger, Ch. (2018). Zur motivationalen Heterogenität Studierender. Auswirkungen auf Lernverhalten und Workload. In N. Auferkorte-Michaelis & F. Linde (Hrsg.), Diversität lernen und lehren – ein Hochschulbuch (S. 53-73). Leverkusen-Opladen [u.a.]: Verlag Barbara Budrich/Budrich UniPress. Metzger, Ch., R. Schulmeister & T. Martens (2012): Motivation und Lehrorganisation als Elemente von Lernkultur. In: Euler, D. & T. Brahm (Hrsg.): Zeitschrift für Hochschulentwicklung Jg. 7, Nr. 3, 36-50. Online: www.zfhe.at/index.php/zfhe/article/view/433. Metzger, Ch. & Haag, J. (2016). Determinanten studentischen Lernerfolgs. Geblockte Module als Reaktion auf eine heterogene Lernmotivation. In AQ Austria (Hrsg.), Beiträge zur 3. AQ Austria Jahrestagung 2015 (S. 73-88). Wien: facultas. Metzger, Ch. & Vollmer, A. (2017): Reorganisation der Lehre: Verblockung von Modulen als Reaktion auf eine heterogene Lernmotivation. In B. Berendt, B. Szczyrba, A. Fleischmann, N. Schaber & J. Wildt (Hrsg.), Neues Handbuch Hochschullehre. Griffmarke J 2.22. Berlin: DUZ Medienhaus. Schulmeister, Rolf (2014). Auf der Suche nach Determinanten des Studienerfolgs. In J. Brockmann & A. Pilniok (Hrsg.), Studieneingangsphase in der Rechtswissenschaft (S. 72-205). Baden-Baden: Nomos. Schulmeister, R. & Ch. Metzger (Hrsg.) (2011): Die Workload im Bachelor: Zeitbudget und Studierverhalten. Eine empirische Studie. Münster [u.a.]: Waxmann. 01.07.19 Seite 42
Sie können auch lesen