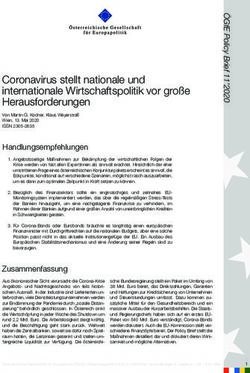Schengen-Europa: Abgeschottet oder mit offenen Türen?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Unterrichtsvorschlag aus:
Sicherheitspolitik. Sicherheitsstrategien, Friedenssicherung, Datenschutz
Herausgegeben vom Forum Politische Bildung – Informationen zur Politischen Bildung, Bd.25
Innsbruck, Wien, Bozen: Studien Verlag 2006
Herbert Pichler
Schengen-Europa: Abgeschottet oder mit offenen Türen?
Lehrplanbezug 8. Kl. AHS, Geschichte und Sozialkunde/Politische Bildung
Europäische Integrationsbestrebungen und Globalisierungsprozesse – Chancen und
Konfliktpotenziale
Akteure der internationalen Politik, zentrale Konfliktfelder und neue Formen von
Sicherheitskonzepten und -strukturen
5. u. 6. Kl. AHS, Geographie und Wirtschaftskunde
Gliederungsprinzipien der Erde nach unterschiedlichen Sichtweisen (nach natur-
räumlichen, kulturellen, politischen und ökonomischen Merkmalen aufzeigen; Ein-
sicht gewinnen, dass Gliederungen immer einem bestimmten Zweck dienen, dass
Grenzen Übergangszonen und die abgegrenzten Gebiete meist nicht einheitlich sind)
Raumbegriff und Strukturierung Europas
Konvergenzen und Divergenzen europäischer Gesellschaften (erkennen, dass sich
Europa zum Einwanderungskontinent entwickelt hat)
7. Kl. AHS, Geographie und Wirtschaftskunde
Veränderungen der geopolitischen Lage Österreichs (die unterschiedliche Qualität
der Grenzen Österreichs seit dem 20. Jahrhundert in ihrer Wirkung auf Verkehr,
Wirtschaft und Migration erfassen)
8. Kl. AHS, Geographie und Wirtschaftskunde
Politische und ökonomische Systeme im Vergleich (die Asymmetrie zwischen der
ökonomischen Macht auf der einen Seite und den sozialen und politischen Interes-
sen auf der anderen Seite erkennen; Ursachen und Auswirkungen sozialer und öko-
nomischer Disparitäten auf globaler Ebene beurteilen und Möglichkeiten von Ver-
besserungen durch Entwicklungszusammenarbeit diskutieren, Zusammenschlüsse
auf wirtschaftlicher und politischer Ebene vergleichen)
Lernziele Schengen soll von SchülerInnen als eines von mehreren realpolitischen Europa-Kons-
trukten wahrnehmbar und in seinen lebensweltlichen Auswirkungen begreifbar werden.
Es soll bewusst werden, dass (und wie) durch das Schengen-Abkommen jenseits des
Kriteriums EU-Mitgliedschaft der Zutritt zum und die Bewegungsfreiheit im Schen-
genraum geregelt wird (Freiheit des Personenverkehrs).
Die SchülerInnen sollen die Ziele und Inhalte des Schengen-Abkommens kennen um
ermessen zu können, dass dieses über den Abbau der Binnengrenzen hinaus weit
reichende Konsequenzen im Bereich der Kooperation in sicherheitspolitischen Fra-
gen hat. Diese Ziele und Konsequenzen sollen auch hinterfragt werden.
Die Folgewirkungen eines verstärkten Abschottens der Schengen-Staaten nach
außen sollen im Kontext globaler Disparitäten sowie von Migrations- und Flucht-
strömen (Stichwort: Einwanderungskontinent Europa) kritisch reflektiert werden.
Anhand von konkreten Fallbeispielen sollen die ethischen und moralischen Fragen
diskutiert werden, die durch die verschärfte Abschottung und Überwachung der
Außengrenze bzw. eine Abwehr von Flüchtlingen auftreten.
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 63
www.politischebildung.comHerbert Pichler
Visionen, Ideen und Szenarien für alternative bzw. ergänzende Politiken der
„Kooperation“ mit den Nachbarländern an den Schengen-Außengrenzen bzw. mit
den Herkunftsländern der MigrantInnen und Flüchtlinge sollen diskutiert werden.
Die SchülerInnen sollen Grenzen und Gefahren eines europäischen Sicherheits-Infor-
mations-Systems ( SIS) und dessen möglicher Ausweitung analysieren.
Die Ziele und Initiativen von NGOs gegen die teilweise Menschen verachtenden
Auswirkungen der Überwachung der Schengen-Außengrenze sowie gegen den fort-
schreitenden Datenaustausch und die Überwachung durch SIS sollen beleuchtet wer-
den. Möglichkeiten zivilgesellschaftlichen Engagements sollen damit aufgezeigt
werden.
Zentrale Welche konkreten lebensweltlichen Auswirkungen hat das Schengen-Abkommen für
Fragestellungen mich?
Welche Qualitäten und Konsequenzen hat das räumliche Konstrukt „Schengen-
Land“ im Vergleich zur Europäischen Union?
Welche sicherheitspolitischen Bereiche regelt das Schengen-Abkommen mit welchen
Konsequenzen?
Was bedeutet das verstärkte Überwachen der Schengen-Außengrenze für Schen-
gen-Mitglieder, für die Nachbarländer, aber auch für Flüchtlinge und MigrantInnen?
Wie legitimieren Schengen-Länder den Einsatz von Staatsgewalt (Militär, Sperranlagen
etc.) und wiederholte Todesfälle beim Versuch, die Schengen-Grenze zu überwinden?
Wie weit geht „Europa“ bei der „Sicherung“ der Außengrenzen gegenüber illega-
len Grenzübertritten in der Wahl der Mittel? (Beispiel Exklaven Melilla und Ceuta)
Welche alternativen Möglichkeiten eines politischen Umganges des Einwanderungs-
kontinents Europa mit (illegaler) Immigration und Flüchtlingen wären denkbar und wün-
schenswert? Welche Vor- und Nachteile sind mit diesen Lösungsansätzen verbunden?
Welche Politikbereiche wären davon betroffen und könnten vernetzt werden?
Welchen Nutzen und welche Gefahren beinhaltet das Schengener-Informations-
System (SIS) und soll es ausgeweitet werden? Ist ein transnationales Informations-
system ein weiterer Schritt zum „Gläsernen Menschen in Schengen-Land“?
Mit welchen Zielsetzungen und Motiven engagieren sich NGOs allgemein und
Menschenrechtsorganisationen speziell gegen das Schengen-Informationssystem
sowie gegen das Schengen-Abkommen?
Methodisch- Der Themenkomplex „Schengen“ wird in den Medien häufig auf die Öffnung der Bin-
didaktische nengrenzen verkürzt. Ein Ziel der Auseinandersetzung im Unterricht wäre also das
Vorbemerkungen Erschließen und kritische Hinterfragen der weit reichenden Wirkungsfelder von Schengen
im Bereich der inneren und äußeren Sicherheit.
Sicherheit stellt in der EU ein zunehmend brisantes gesellschaftspolitisches Thema dar, das
auch vermehrt von politischen Parteien aufgegriffen wird. Im Kontext eines steigenden Migra-
tionsdruckes und verstärkter Versuche von Flüchtlingen, in Europa Fuß zu fassen, wird die
Sicherung der EU-Außengrenzen, aber auch die Öffnung der Binnengrenzen zu einem kon-
trovers diskutierten, hoch emotionalisierten Bereich. Hier prallen die Werte des Humanismus
und der Nächstenliebe sowie Weltoffenheit auf Bedenken und Ängste gegenüber dem Ande-
ren, Sicherheitsbedenken und unterschiedliche ökonomische Sichtweisen. Diese unterschied-
lichen, zum Teil unvereinbaren Sichtweisen gilt es, zu Wort kommen zu lassen und nach ihrer
Gebundenheit an Interessen zu befragen. Die vorhandene Emotionalität kann nicht ausge-
blendet werden. Erst das Zulassen und Transparentmachen von Emotionen, Ängsten, Vorur-
teilen ermöglicht eine möglichst entemotionalisierte Analyse der Fragestellungen.
Für Österreich sind diese Fragestellungen als (noch) Schengen-Außengrenzland beson-
ders aktuell. Die direkte Betroffenheit von Jugendlichen ist momentan u.a. auch dadurch
64 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
gegeben, dass Präsenzdiener des Bundesheeres im so genannten Assistenzeinsatz die
österreichische Ostgrenze sichern. Wenn die Schengen-Außengrenze im Zuge der
Umsetzung von Schengen sich an die Ostgrenzen der Nachbarländer Österreichs ver-
schiebt, bleibt der Kern der Fragestellungen freilich erhalten.
E1 Grenzannäherung
Erstellen Sie in Einzelarbeit eine Mind Map zum Thema „Grenze“. Präsentieren und kom-
mentieren Sie Ihr Ergebnis und vergleichen Sie es mit KollegInnen.
E2 Grenzen ausloten: Grenzen schließen ein, Grenzen schließen aus, grenzen ab
Loten Sie die Bedeutungsebenen, unterschiedlichen Qualitäten und Konsequenzen von
Grenzen für alle Betroffenen aus. Sie können dabei von Ihrem unmittelbaren Lebensum-
feld (Schule, Familie, Freizeitbereiche etc.) ausgehen. Verarbeiten Sie Ihre Gedanken,
Assoziationen und Gefühle in kreativer Form. Sowohl grafisch-zeichnerische Formen, frei
zu wählende Textsorten, szenische Darstellungen, aber auch eine Gestaltung als Video
sind möglich. Je nach gewähltem Produkt kann die Erarbeitung einzeln, in PartnerInnen-
oder Gruppenarbeit erfolgen.
E3 Grenzgedanken (Assoziationsfragen)
„Wenn ich an Schengen denke, dann ...“
Im Zusammenhang mit der Öffnung der Binnengrenzen in der EU sehe ich folgende Vorteile:
Im Zusammenhang mit der Öffnung der Binnengrenzen in der EU sehe ich folgende
Nachteile/Probleme:
Im Zusammenhang mit Schengen habe ich folgende Fragen:
A1 Schengen konkret
Verschaffen Sie sich im Rahmen einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit einen ersten Über-
blick über die wichtigsten Informationen zum Schengener Abkommen (vgl. M1–M5).
Erstellen Sie Plakate, mit deren Hilfe Sie Ihre Ergebnisse vor der Klasse präsentieren.
Leitfragen zur Ausarbeitung:
Woher kommt die Bezeichnung Schengener Abkommen? (siehe M1)
Welche Bereiche der Sicherheitspolitik sind vom Schengener Abkommen betroffen?
Welche Ziele werden mit dem Schengener Abkommen verfolgt?
Wie betrifft mich das Schengener Abkommen persönlich?
Was versteht man unter dem Schengener Informationssystem? (SIS)
Eigene Fragestellungen:
A2 Abgrenzung: Wo ist Schengen-Land?
Erstellen Sie in PartnerInnenarbeit auf Basis einer stummen Europakarte (M6) und mit
Hilfe des Atlasses und der Materialien M2 und M5 eine thematische Karte von Schengen-
Land. Arbeiten Sie mit unterschiedlichen Farben und überlegen Sie sich eine passende
grafische Umsetzung folgender Informationen, die in der Karte dargestellt werden sollen:
Schengen-Vollmitglieder
Eingeschränkte Mitgliedschaft
Geplantes Inkrafttreten der Mitgliedschaft voraussichtlich 2007–2008
Schengen-Mitglieder, die nicht EU-Mitglieder sind
Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla (vgl.: M8)
Schengen-Binnengrenzen
Schengen-Außengrenze
Beschriften Sie die Karte mit dem für Sie hilfreichen topographischen Namensgut. Legen
Sie unter der Karte auch eine Legende der verwendeten Farben, Linienarten und Symbole
(Signaturen) an.
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 65
www.politischebildung.comHerbert Pichler
M1 Was heißt überhaupt Schengen?
Das Abkommen mit weit reichenden Folgen für die Grenzkontrollen in Europa ist nach
einem kleinen luxemburgischen Weinbaudorf (ca. 1.400 Ew.) an der Mosel benannt.
Hier im Dreiländereck zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg unterzeichneten
am 14. Juni 1995 fünf EU-Mitgliedsländer (Benelux, Deutschland, Frankreich) auf einem
Mosel-Schiff das Abkommen zum Abbau der Binnengrenzen. Am Moselufer bei Schen-
gen erinnert heute ein Denkmal an dieses Ereignis. Im Übrigen sind alle wichtigen
Abkommen, Verträge und Initiativen in der EU nach den Städten oder Orten benannt, an
denen sie beschlossen oder unterzeichnet wurden (Bsp.: Verträge von Rom, Amsterdam,
Maastricht-Kriterien, Lissabon-Ziele etc.). Dies dürfte wohl eine Strategie sein, die oft kom-
plexen und sperrigen Inhalte mit bekannten und sich einfacher zu merkenden „Marken“
zu versehen.
Herbert Pichler, Quelle u.a. http://de.wikipedia.org/wiki/Schengen
M2 Schritt für Schritt nach Schengen-Land
Bereits mit den Verträgen von Rom 1957, von Beginn des europäischen Einigungspro-
zesses an, war die Idee der Freizügigkeit der Personen und Güter eine der Grundideen
und Säulen. Es dauerte bis zum 14. Juni 1985, bis die Bundesrepublik Deutschland,
Frankreich, Belgien, Luxemburg und die Niederlande das Abkommen von Schengen
über den schrittweisen Abbau der Personenkontrollen an den Binnengrenzen unterzeich-
neten. Mit der geplanten Öffnung der Grenzen tauchten jedoch auch Sicherheitsfragen
auf wie zum Beispiel unterschiedliches Asylrecht, die Verfolgung von Straftätern über
Grenzen, unterschiedliche Waffen- und Drogengesetze und viele andere. Diese Sicher-
heitsfragen verlangten daher eine genaue Regelung, wie das Schengener Abkommen,
also die Öffnung der Grenzen, in der Praxis durchgeführt werden sollte. Am 19. Juni
1990 wurde daher das Übereinkommen zur Durchführung des Schengener Abkommens
(Schengener Durchführungsübereinkommen – SDÜ, auch Schengen II genannt) unter-
zeichnet. Gegenstand des Abkommens sind Maßnahmen, die infolge der Abschaffung
der Binnengrenzkontrollen einen einheitlichen Raum der Sicherheit und des Rechts
gewährleisten sollen. (vgl. M3)
Das Schengener Durchführungsübereinkommen trat am 1. September 1993 in Kraft, die
praktische Anwendung seiner Einzelbestimmungen erfolgte jedoch erst nach Schaffung
der erforderlichen technischen und rechtlichen Voraussetzungen (z.B. Einrichtung von
Datenbanken und der dafür erforderlichen Datenschutzbehörden) ab 26. März 1995,
zunächst zwischen den Parteien des Schengener Abkommens sowie Spanien und Portu-
gal. Seit 1995 traten Italien, Griechenland, Österreich, Dänemark, Finnland und Schwe-
den dem Schengener Durchführungsübereinkommen bei, wobei das Übereinkommen für
die drei nordischen Staaten erst am 25. März 2001 in Kraft gesetzt wurde. Mit den nicht
der EU angehörenden Mitgliedern der Nordischen Passunion (Norwegen und Island) wur-
den 1996 Schengen- Kooperationsabkommen geschlossen. Auch Norwegen und Island
wenden das Schengen-Regelwerk seit dem 25. März 2001 an. Mit Unterzeichnung des
Vertrages von Amsterdam wurde das Schengen-Abkommen in das EU-Recht integriert. Mit
der vollständigen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen kann sich der Inhaber eines
gemeinsamen Visums während des Gültigkeitszeitraums, längstens jedoch 3 Monate pro
Halbjahr in den o.a. 15 Staaten, die das Schengener Durchführungsübereinkommen
anwenden, aufhalten.
Bearbeitet nach http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/schengen_html
sowie http://www.europainfo.at/hm_a/detail.asp?show=27
66 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
M3 Schengen ist mehr als offene Binnengrenzen
Dieses Schengener Abkommen regelt nicht nur den Entfall aller Personenkontrollen an
den Grenzen zwischen den Vertragsstaaten, sondern vor allem neue Formen der Zusam-
menarbeit und Ausgleichsmaßnahmen wie zum Beispiel:
Vereinbarungen zur polizeilichen Zusammenarbeit
Errichtung des Schengener Informationssystems (SIS) (grenzübergreifendes automati-
siertes Fahndungssystem)
Intensive Überwachung der Außengrenzen einschließlich der Flug- und Seehäfen
Schaffung und Einführung eines einheitlichen Schengen-Visums (gemeinsame Liste
der Drittstaaten, deren Staatsangehörige visumpflichtig sind):
StaatsbürgerInnen von Schengen-Ländern können die Binnengrenzen der
Anwenderstaaten an jeder Stelle und kontrollfrei überschreiten.
Drittstaatsangehörige, die über ein von einem Schengen-Land ausgestelltes, in
der räumlichen Gültigkeit nicht beschränktes Visum (Besuchs- und Geschäfts-
aufenthalte von bis zu drei Monaten pro Halbjahr sowie Transit- und Flughafen-
transitvisa) verfügen, dürfen sich im Rahmen der Gültigkeit und des Zwecks der
Visa auch in denanderen Schengen-Staaten aufhalten; bei Passieren der Binnen-
grenzen unterliegen auch sie keinen Kontrollen.
Alle Angehörigen dritter Staaten, die sich mit einer gültigen Aufenthaltsgenehmi-
gung legal in einem Schengen-Vollanwenderstaat aufhalten, können mit einem gül-
tigen Reisepass visumfrei bis zu 3 Monate pro Halbjahr in die anderen Schengen-
Vollanwenderstaaten reisen.
Erleichterung der internationalen Rechtshilfe und Auslieferung
Festlegung gemeinsamer Kriterien für die interne Aufteilung von AsylwerberInnen
nach dem Erstasyllandsprinzip
Zusammenarbeit in der Bekämpfung der Drogenkriminalität
Vereinbarungen zur grenzüberschreitenden Verfolgung und Observation Tatver-
dächtiger (Schleierfahndung, grenzüberschreitende polizeiliche Nacheile etc.)
Bearbeitet nach http://www.europainfo.at/hm_a/detail.asp?show=27
sowie http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/schengen_html
M4 Einreisevoraussetzungen für das Passieren der Außengrenzen ins „Schengen-Land“
EU- und EWR-BürgerInnen unterliegen lediglich der Identitätsfeststellung.
Bei Angehörigen von Staaten außerhalb der EU und des EWR ist das Vorliegen fol-
gender Voraussetzungen zu prüfen:
der/die Einreisewillige darf im Schengener Informationssystem nicht zur Einreise
verweigerung ausgeschrieben sein
und keine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, nationalen Sicherheit oder der
internationalen Beziehungen eines Vertragsstaates darstellen
gültige, von allen Vertragsstaaten anerkannte Reisedokumente
sofern erforderlich ein gültiges Visum
ausreichend finanzielle Mittel zur Bestreitung des Lebensunterhaltes
Bei Nichtvorliegen der Einreisevoraussetzungen ist jede/r Drittland-Angehörige zurück-
zuweisen.
Bearbeitet nach http://www.europainfo.at/hm_a/detail.asp?show=27
sowie http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/willkommen/einreisebestimmungen/schengen_html
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 67
www.politischebildung.comHerbert Pichler
M5 Schengen: direkte, indirekte und eingeschränkte Mitgliedschaften
Land Beitritt Umsetzung Anmerkungen
Andorra 1995 Keine Unterzeichnung, bereits zuvor
keine Grenzkontrollen zu Nachbarländern
(Spanien und Frankreich).
Belgien 1990 1995
Dänemark 1996 2001 Auch Grönland und Färöer durch Nordische
Passunion Mitglieder
Deutschland 1990 1995
Estland 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Finnland 1996 2001
Frankreich 1990 1995
Griechenland 1992 2000 Spätes Inkrafttreten wegen
Sicherheitsbedenken anderer Mitglieder
Irland 2000 Eingeschränkte Teilnahme: Polizeiarbeit,
Strafverfolgung, keine Reisefreiheit
Island 1996 2001 Kein EU-Mitglied, aber Mitglied der
Nordischen Passunion
Italien 1990 1997
Lettland 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Liechtenstein Wegen Zollunion mit Schweiz ab Inkraft-
treten in der Schweiz ca. 2008
Litauen 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Luxemburg 1990 1995
Malta 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Monaco 1995 Keine Grenzkontrollen zu Frankreich,
kein eigentlicher Beitritt
Niederlande 1990 1995
Norwegen 1996 2001 Kein EU-Mitglied, aber als Mitglied der
Nordischen Passunion bei Schengen
Österreich 1995 1997
Polen 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Portugal 1991 1995 Für Fußball-EM 2004 Schengen außer Kraft
gesetzt
San Marino 1997 Keine Unterzeichnung, aber keine
Grenzkontrollen zu Italien
Schweden 1996 2001
Schweiz 2004 Inkrafttreten voraussichtlich 2008
Slowakei 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Slowenien 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Spanien 1991 1995
Tschechien 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Ungarn 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Vatikanstadt 1997 Keine Unterzeichnung, aber keine
Grenzkontrollen zu Italien
Vereinigtes 2000 Eingeschränkte Teilnahme: Polizeiarbeit,
Königreich Strafverfolgung, keine Reisefreiheit
Zypern 2004 Grenzkontrollen entfallen frühestens 2007
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen, eigene Bearbeitung
68 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
M6 Stumme Karte: Wo ist Schengen-Land?
Maßstab 1: 30.000.000
A3 Grenzüberschreitung
Beantworten Sie folgende Fragen unter Zuhilfenahme der Informationen aus M2–M5
sowie M15.
Welche Bedeutung und Folgen hat das Schengen-Abkommen für Länder mit Binnen-
grenzen?
Welche Bedeutung und Folgen hat das Schengen-Abkommen für Länder mit Außen-
grenzen?
Welche Bedeutung und Folgen hat das Schengen-Abkommen für Personen aus Dritt-
ländern?
A4 Grenzenlos? Was heißt denn eigentlich Sicherheit?
Bereiten Sie sich in Kleingruppen auf eine Diskussion über die Folgen der Öffnung nach
Innen und der Abschottung nach außen vor (vgl. M7).
Erhöht Abschottung nach außen kurzfristig die soziale Sicherheit im Inneren? (ille-
gale Zuwanderung reduziert, Stimmungslage der Bevölkerung etc.)
Schadet Abschottung langfristig der sozialen Sicherheit im Inneren? (Altersentwick-
lung der europäischen Bevölkerung, Finanzierung der Pensionssysteme, schrump-
fendes Arbeitskräftepotenzial etc.)
Braucht der Einwanderungskontinent Europa Zuwanderung?
Internationale Stabilität: Welche Politik wäre neben der Abschottung nötig, um die
Ursachen des Migrationsdruckes zu mildern?
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 69
www.politischebildung.comHerbert Pichler
M7 Abgeschottetes Haus der offenen Türen
Haus der offenen Türen
Nik Ebert
Bundesrepublik
Deutschland
25. März 1995
Federzeichnung,
21 x 29,7 cm
Haus der Geschichte,
Bonn
EB-Nr.:
1998/11/0500.0480
Quelle: http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/WegeInDieGegenwart_karikaturSchengen/index.html
A5 Grenzgang: Festung Europa
Flüchtlinge bezahlen Unsummen, liefern sich Schleppern und Schleusern aus, riskieren ihr
Leben beim Versuch, die Schengen-Außengrenzen zu überwinden, Schätzungen von
NGOs sprechen von insgesamt über 5.000 Toten. Verfassen Sie eine Reportage oder
einen Kommentar für eine Schülerzeitung zu folgenden Fragen (vgl. M8–M11, M15):
Welche Mittel sollen zur Sicherung der Außengrenzen (des eigenen Besitzstandes
und Wohlstandes), zur Gewährleistung der Sicherheit und zur Aufrechterhaltung des
sozialen Friedens erlaubt sein/angewendet werden?
Dürfen/sollen die EU-Außengrenzen mit „Gewalt“ gegen illegale Grenzübertritte gesi-
chert werden? Welches „Verbrechen“ begehen „illegale“ GrenzüberschreiterInnen?
Wie soll die EU auf die tödlichen Zwischenfälle an den Grenzzäunen in Ceuta und
Melilla reagieren?
M8 Europa auf afrikanischem Boden: Die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla
Die an der Nordküste Afrikas (Marokko) gelegene Stadt Melilla (68.000 EinwohnerIn-
nen, 13,4 km2) wurde im Rahmen der Reconquista 1497 von Spanien erobert und
gehört seither zu Spanien. Das ca. 300 km weiter westlich gelegene Ceuta (75.000
EinwohnerInnen, 18,5 km2) wurde 1580 von den Portugiesen übernommen. Seit der
Unabhängigkeit Marokkos 1956 sieht die marokkanische Regierung beide spanischen
Exklaven zwar als Bestandteil ihres Territoriums an. Praktisch wird die Zugehörigkeit zu
Spanien jedoch nicht angefochten, 1995 haben die beiden Gebiete einen Autonomie-
status bekommen. Die beiden Städte sind zu einem Großteil Militärstützpunkte, die ans
Mittelmeer und an Marokko grenzen. Damit stellen sie die einzige Landgrenze der EU
zum afrikanischen Kontinent dar. Im Zuge des Schengen-Abkommens wurde ab 1995
begonnen, dieses Stück EU in Afrika mit modernsten Grenzanlagen abzusichern. Kon-
trolltürme, Überwachungskameras und Sensoren an den 2 bis zu 6 Meter hohen Zaun-
reihen (ein dritter Hightechzaun ist geplant) sollen ein illegales Eindringen in die EU ver-
hindern. Durch mehrere Todesfälle am Grenzzaun ist die Weltöffentlichkeit im
September 2005 auf die Problematik der Abschottung dieses Außenpostens der EU auf-
merksam gemacht worden.
Eigene Bearbeitung nach http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185, ID4805862_REF1_NAV_BAB,00.html;
http://www.migration-info.de/migration_und_bevoelkerung/artikel/050902.htm
70 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
M9 Die Festung Europa kann tödlich sein
Auf den Massenansturm von Flüchtlingen reagiert Spanien mit der Entsendung von Soldaten.
Wie viele Experten sieht die EU-Kommission in der Abschottung jedoch keine Lösung,
sondern das Problem.
Die Grenze zwischen Ceuta und Marokko
Stacheldraht, meterhohe Zäune, Infrarotkameras, bewaffnete Sicherheitskräfte – an der
Grenze der beiden spanischen Exklaven Ceuta und Melilla an Marokkos Küste ist die
„Festung Europa“ nicht nur eine Metapher. Nach dem Massenansturm afrikanischer
Flüchtlinge in den vergangenen Nächten will Spanien nun zusätzlich Soldaten dorthin
schicken. Er habe vom Ministerpräsidenten die Anordnung erhalten, die Küstenwache in
den Exklaven mit Truppen zu verstärken, erklärte Verteidigungsminister José Bono am
Donnerstag (29.9.2005). Wie viele Soldaten stationiert werden sollen, konnte er
zunächst nicht sagen. In der Nacht zuvor waren mindestens fünf afrikanische Flüchtlinge
gestorben, als bis zu 600 Menschen versuchten, den Grenzzaun von Ceuta mit Leitern
zu überwinden.
Auf dem Weg nach Europa sterben Tausende
Das Flüchtlingskommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) versuche derzeit heraus-
zufinden, wie es zu den Todesfällen kommen konnte, sagt der UNHCR-Sprecher Rupert
Colville. Allerdings betreffe das Problem nicht nur die beiden Exklaven, sondern die
ganze EU: „Bei dem Versuch, nach Europa zu kommen, stirbt eine schockierende Zahl
von Menschen.“ In den vergangenen zwölf Jahren seien 6.300 Fälle dokumentiert wor-
den – und dies sei wahrscheinlich nur die Spitze des Eisberges, da die Toten oft nicht
gemeldet oder gefunden würden.
Eine Patentlösung gebe es wegen der Komplexität des Problems nicht – die Fragen reich-
ten von der Entwicklung in Afrika über das Seerecht bis hin zu den Asylgesetzen, sagt
Colville. Klar sei aber: „Die Staaten müssen sich des Problems stärker als bisher anneh-
men.“ Der europäische Umgang mit Einwanderung erinnere an die Prohibition in den
Vereinigten Staaten, sagt Colville: So wie das Verbot von Alkohol mafiöse Strukturen
begünstigt habe, so spiele die Abschottung in die Hände von Schleusern.
Kein legaler Weg
Wer einen Asylantrag in Europa stellen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als illegal ein-
zuwandern – es sei denn, er kommt mit dem Flugzeug oder per Schiff. Genau das sei für
politisch Verfolgte jedoch kaum möglich: „Wer aus einem Staat flieht, in dem er verfolgt
wird, kann dort keinen Pass beantragen, um legal auszureisen“, erklärt Colville. Der Ver-
such, so genannte Wirtschaftsflüchtlinge fern zu halten, habe dazu geführt, dass es für poli-
tisch Verfolgte kaum noch einen Zugang gebe. „Europa hat den Fehler gemacht, sich in
eine rein defensive Abschottungsmentalität zu verbeißen“, sagt auch Wolfgang Bosswick,
Geschäftsführer des Europäischen Forums für Migrationsstudien. „Es gibt derzeit keinen
legalen Weg, als Arbeitsmigrant nach Europa zu kommen, sieht man von Programmen wie
der Greencard im hoch qualifizierten Bereich ab.“
Restriktive Politik
Langfristig führe wegen der demographischen Entwicklung in Europa ohnehin kein Weg
an einer Einwanderungspolitik vorbei, sagt Bosswick. In Deutschland beispielsweise
werde die Bevölkerungszahl bis 2050 auch dann von gegenwärtig rund 82 Millionen
auf 60 bis 70 Millionen sinken, wenn weiterhin rund 200.000 Menschen pro Jahr ein-
wandern. Länder wie Kanada hätten dagegen längst Systeme entwickelt, um die Ein-
wanderung sowohl von qualifizierten als auch von ungelernten Arbeitskräften zu lenken.
Zwar sei Einwanderung ein ambivalenter Prozess, aber: „Die Einwanderung trägt dort
stark zur wirtschaftlichen Dynamik bei, weil die Migranten oft als Unternehmer in eigener
Sache agieren.“
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 71
www.politischebildung.comHerbert Pichler
Auch die EU-Kommission sieht einen Zusammenhang zwischen den Ereignissen in Ceuta
und Melilla und der restriktiven Politik der europäischen Staaten. „Diese Tragödie zeugt
einmal mehr von der dringenden Notwendigkeit eines echten und wirksamen Manage-
ments in Migrationsfragen“, sagte die Kommissionssprecherin Françoise Le Bail am Don-
nerstag. Für die Eindämmung der illegalen Einwanderung sei ein klarer rechtlicher Rah-
men für die legale Migration nötig. (30.9.2005)
Quelle: http://www.dw-world.de/dw/article/0,2144,1725302,00.html
M10 Massive Einreiseversuche in Exklaven
Rund 4.000 Menschen versuchten seit Ende August (2005, Anm. d. Red.), die Grenz-
zäune um die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla in großen Gruppen zu überwin-
den. Sie kamen größtenteils aus Staaten des subsaharischen Afrika. Etwa 1.000 Men-
schen ist die Einreise in spanisches Territorium gelungen. Gleichzeitig kamen 14
Menschen ums Leben. Die Reaktionen der spanischen, vor allem aber der marokkani-
schen Behörden wurden scharf kritisiert. Im Zeitraum vom 27. September bis 6. Oktober
waren die Einreiseversuche in die spanischen Exklaven auf nordafrikanischem Boden am
stärksten. In nur 10 Tagen versuchten über 3.000 Afrikaner, ohne Genehmigung in die
spanischen Territorien einzureisen, v. a. nach Melilla. Über 900 Versuche waren erfolg-
reich. Hunderte Migranten trugen allerdings Verletzungen davon. Bis Mitte Oktober fan-
den 14 Menschen den Tod. Einige starben an den Folgen von Schussverletzungen durch
marokkanische oder spanische Grenzbeamte, die in Ausnahmefällen Gummigeschosse
verwenden. Schädigungen der inneren Organe können dabei zum Tod führen. Andere
erlagen ihren Verletzungen, die sie sich beim Klettern über den Zaun zugezogen hatten,
oder sie wurden überrannt.
Die Migranten stammen überwiegend aus den westafrikanischen Staaten Ghana, Gui-
nea-Bissau, Kamerun, Mali, Nigeria und Senegal. Das Phänomen der illegalen Einreise
in die spanischen Exklaven ist nicht neu. In den ersten acht Monaten des Jahres 2005
wurden rund 11.000 Versuche am Grenzzaun der Stadt Melilla gezählt, so die für den
Grenzschutz zuständige Gendarmerie (Guardia Civil). Eine neue Dimension wurde
dadurch erreicht, dass die Migranten in Gruppen von bis zu 500 Personen versuchten,
die Grenzanlagen zu überwinden. Bislang waren die Gruppen wesentlich kleiner. Ein
möglicher Hintergrund für die vermehrte Zahl illegaler Einreiseversuche in besonders
großen Gruppen war die Ankündigung der spanischen Behörden, die Grenzzäune im
gesamten Grenzabschnitt von drei auf sechs Meter zu erhöhen. Bis Ende 2005 sollen die
Bauarbeiten an den Grenzanlagen um Ceuta und Melilla abgeschlossen werden.
Die Guardia Civil geht inzwischen davon aus, dass es in den kommenden Monaten wei-
terhin zu massiven Einreiseversuchen kommen wird. Die verzweifelten Versuche einer
Erstürmung der Grenzanlagen gingen von Menschen aus, die bereits seit Monaten in
Wäldern nahe der spanischen Exklaven campierten. Die provisorischen Lagerstätten wur-
den inzwischen von den marokkanischen Behörden geräumt. Nach Angaben der
Europäischen Kommission sind derzeit weitere 30.000 Personen in Marokko und Alge-
rien in Richtung Europa unterwegs.
Nach den massiven Einreiseversuchen Ende September setzte die spanische Regierung
480 bereits in den Exklaven stationierte Soldaten und Fremdenlegionäre zur Verstärkung
des Grenzschutzes ein. Außerdem kündigte Innenminister José Antonio Alonso (PSOE)
die Errichtung eines dritten vorgelagerten Grenzzaunes an. Während eines bilateralen
Treffens im andalusischen Sevilla Ende September kündigte auch die marokkanische
Regierung die Entsendung von insgesamt 1.600 zusätzlichen Polizei- und Militärkräften
in die Grenzregionen an. Zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Migranten begannen
marokkanische Einheiten bereits mit der Abholzung von am Grenzstreifen gelegenen
Waldgebieten.
Auf scharfe Kritik stieß die Entscheidung der spanischen Regierung unter José Luis Zapatero
72 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
(PSOE), ein 1992 mit Marokko geschlossenes Rücknahmeabkommen wiederzubeleben
und im Fall der nach Ceuta und Melilla eingedrungenen Migranten anzuwenden. Am 6.
Oktober schoben die spanischen Behörden mindestens 73 Personen nach Marokko
zurück. Das Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen (UNHCR) gab zu
bedenken, dass unter den Zurückgeschobenen auch Personen sein könnten, die einen
berechtigten Anspruch auf Asyl hätten. Spanien breche mit seiner Vorgehensweise das
Abschiebeverbot der Genfer Flüchtlingskonvention („non-refoulement“, Art. 33). Nach
Angaben des UNHCR betrug die Anerkennungsquote von Asylbewerbern in Ceuta bis-
lang etwa 10 %. Vertreter des UNHCR kündigten eine Sonderuntersuchung an.
Die marokkanischen Behörden begannen unterdessen, sowohl die aus Spanien zurück-
geschobenen Personen als auch auf marokkanischem Boden aufgegriffene Migranten
festzusetzen und abzuschieben. Über 2.500 Personen wurden in Flugzeugen in ihre Hei-
matländer abgeschoben, davon 1.135 nach Mali, 1.121 in den Senegal, 129 nach
Kamerun, 93 nach Guinea und 60 nach Gambia. Weitere 1.500 Migranten wurden in
Bussen in die Nähe der algerischen und mauretanischen Grenzen (West-Sahara)
gebracht. Vertreter der Nichtregierungsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“, die den Bus-
konvois folgten, berichteten von unzumutbaren Zuständen. Demnach waren die Insassen
per Handschellen aneinander gekettet und es wurden zu wenige Pausen beim Transport
eingelegt.
Der Versuch Marokkos, einen Teil dieser Migranten nach Mauretanien abzuschieben,
misslang, da die mauretanische Regierung eine Übernahme ablehnte. Mindestens 250
Migranten galten mehrere Tage als in der West-Sahara verschollen. Helikopter der Ver-
einten Nationen überflogen tagelang die Wüstenregion um nach ihnen zu suchen.
Während die marokkanische Regierung das Aussetzen von Migranten in der Wüste
dementierte, bestätigte die west-saharische Befreiungsarmee Polisario, dass sie kleinere
Gruppen von erschöpften Menschen gefunden habe.
Nach Bekanntwerden dieser Maßnahmen stellte die spanische Regierung die Rück-
führung von subsaharischen Migranten nach Marokko vorerst ein. Auch die marokkani-
sche Regierung sah sich angesichts des internationalen Drucks, u.a. seitens der Afrikani-
schen Union (AU), dazu veranlasst, die Migranten wieder aus den Wüstenregionen
zurückzuholen.
Gekürzt nach http://www.migration-info.de/migration_und_bevoelkerung/artikel/050902.htm
M11 Weitere Online-Berichte zu den Vorfällen in Ceuta und Melilla
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4804992_REF1,00.html
http://www.tagesschau.de/aktuell/meldungen/0,1185,OID4803558_TYP1_NAV_REF
1,00.html
http://www.dw-world.de/dw/article/0,1564,1724909,00.html?maca=de-newsletter_top
themen-312-html
http://www.migration-info.de/migration_und_bevoelkerung/artikel/050902.htm
http://no-racism.net/article/1262/
A6 Big Schengen is watching you!
Kaum im öffentlichen Bewusstsein ist die Tatsache, dass in Schengen auch das Schenge-
ner Informationssystem (SIS) integriert ist. Diese länderübergreifende Datenbank soll zu
Fahndungserfolgen geführt haben, lässt aber bei DatenschützerInnen und Bürgerrechtle-
rInnen aufgrund von mangelnder Transparenz und Kontrolle die Alarmglocken läuten. In
der EU wird über SIS II nachgedacht, eine Datenbank, die vielfältige Datenbestände ver-
netzen und auch als Recherchedatenbank funktionieren soll. Droht uns die Überwachung
durch das Schengener Informationssystem? Ist die Metapher vom „Gläsernen Menschen“
in Schengenland bald Realität?
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 73
www.politischebildung.comHerbert Pichler
1) Informationsphase: Informieren Sie sich anhand der Materialien (M12– M14) und der
angegebenen Internetadressen über das Schengener Informationssystem (SIS).
2) Fertigen Sie einen Schummelzettel für die Diskussion an, der die für Sie wichtigsten
Informationen enthält.
3) Vorbereitungsphase in Meinungsgruppen: Finden Sie sich je nach Ihrer Einstellung zur
Nutzung und zum Ausbau des Schengener Informationssystems (für strengeren Daten-
schutz, für kontrollierte Nutzung als Fahndungshilfe, für eine möglichst umfangreiche
europäische Datenbank etc.) in Gruppen zusammen und bereiten Sie in der Gruppe
Ihre Argumentationslinien für die Diskussion vor.
4) Diskussionsphase: Pro- und Kontra-Diskussion zum Thema: Soll das Schengener Infor-
mationssystem ausgebaut werden? Brauchen wir eine europaweit vernetzte Daten-
bank auch als Rechercheinstrument? (Eventuell als Fish-Bowl der GruppensprecherIn-
nen mit einem freien Platz, der immer wieder von neuen MitdiskutantInnen
eingenommen werden kann.) Auf die Argumente der anderen Gruppen soll einge-
gangen werden.
5) Bei Bedarf kann die Diskussion zur Klärung wichtiger offener Fragen unterbrochen
werden und nach einer weiteren Recherche fortgesetzt werden.
M12 Wanted! Der SIS-Steckbrief
Im Schengener Informationssystem befinden sich bereits mehr als 11 Millionen Einträge,
die die folgenden persönlichen Informationen enthalten:
Name und Vorname, wobei mögliche Aliasnamen getrennt eingetragen werden
mögliche objektive und ständige physische Besonderheiten
erster Buchstabe des zweiten Vornamens
Datum und Geburtsort
Geschlecht
Nationalität
ob die betreffende Person bewaffnet sei
ob die betreffende Person gewalttätig sei
Grund des Berichtes
zu ergreifende Maßnahme
Weiters beinhaltet die Datenbank Informationen über
verlorene oder gestohlenen Waffen
verlorene oder gestohlene ausgestellte Personaldokumente sowie leere,
unausgefüllte Personaldokumente
verlorene oder gestohlene Kraftfahrzeuge
verlorene oder gestohlene Banknoten
Bearbeitet nach: http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Informationssystem
M13 Links zum Thema SIS und Datenschutz
http://www.argedaten.at (österreichische Interessensvertretung für Datenschutz)
http://www.dsk.gv.at/ (Österreichische Datenschutzkommission, umfangreiche Informa-
tion zu Schengen und Datenschutz)
http://www.no-racism.net (NGO für Menschenrechte und gegen Diskriminierung,
Rubrik: Überwachung in Schengenland)
http://www.statewatch.org/news/2005/may/sisII-analysis-may05.pdf
(Statewatch-Bericht über SIS II in englischer Sprache)
74 Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25
www.politischebildung.comFür den Unterricht
M14 Schengener Informationssystem SIS
Das Schengener Informationssystem (SIS) ist eine nichtöffentliche Datenbank, in der Per-
sonen und Sachen im Schengen-Raum zur Fahndung ausgeschrieben werden. Zugriffs-
berechtigt sind nur Sicherheitsbehörden in Schengen-Ländern. Rechtsgrundlage ist das
Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) und die dazugehörigen Durch-
führungsvereinbarungen.
Diese technische Einrichtung ermöglicht das unverzügliche Abrufen von Daten von
Sachen und Personen, nach denen aufgrund gerichtlicher Haft- und Suchbefehle bzw. im
Rahmen der Visaerteilung, des Überschreitens der Außengrenze oder der polizeilichen
Zusammenarbeit gefahndet wird. Das Schengener Informationssystem dient allerdings
nicht dem Informationsaustausch im Zusammenhang mit einem Asylverfahren. Die Infor-
mationen des SIS stammen im Wesentlichen aus den nationalen Fahndungssystemen,
welche über eine Zentraleinheit in Straßburg verbunden sind. Ausschließlich diese Zen-
traleinheit verteilt die Daten, wodurch jedem Vertragsstaat die gleiche umfassende Infor-
mation garantiert ist. Das SIS unterliegt strengen Datenschutzbestimmungen. Die Tätigkeit
der Zentrale wird durch eine gemeinsame Kontrollinstanz überwacht. Die jeweiligen
nationalen Behörden überwachen die innerstaatliche Datenverarbeitung. In Österreich
wurde das zur Überwachung und Weitergabe erforderliche Computersystem „Sirene“
installiert. Das SIS wird derzeit von 13 Mitgliedsstaaten und zwei weiteren Staaten (Nor-
wegen und Island) eingesetzt. Es ist aber nicht für den Einsatz in so vielen Mitgliedsstaa-
ten wie nach der letzten Erweiterung konzipiert und verfügt daher nicht über ausrei-
chende Kapazitäten. Deshalb soll ein neues Schengener Informationssystem der zweiten
Generation (SIS II) entwickelt werden.
Bearbeitet nach http://www.europainfo.at/hm_a/detail.asp?show=27
sowie http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Informationssystem
M15 Infolinks Schengener Abkommen
http://migration.uni-konstanz.de/pdf/ge/Europarecht/Vertraege/Schengen-I.htm
(Schengener Abkommen im Originalwortlaut)
www.aufenthaltstitel.de/schengeneruebereinkommen.html
(Schengener Durchführungsübereinkommen, SDÜ, Schengen II, im Originalwortlaut)
http://europa.eu.int/scadplus/leg/de/lvb/l33020.htm
(Schengener Abkommen, Informationsüberblick)
http://www.europainfo.at/hm_a/detail.asp?show=27 (Überblicksartikel)
http://www.auswaertiges-amt.de (Suchbegriff: Schengen)
http://www.bmi.gv.at/ (Bundesministerium für Inneres)
http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Abkommen
http://de.wikipedia.org/wiki/Schengener_Informationssystem
http://www.help.gv.at/2/020000_f.html
(Informationen zur Ausstellung eines Reisepasses)
Herbert Pichler, Mag.
Studium „Geographie und Wirtschaftskunde Lehramt“ und „Deutsche Philologie Lehr-
amt“ an der Universität Wien. BHS-Lehrer am Schulzentrum Ungargasse, 1030 Wien,
und an der KMS Enkplatz, 1110 Wien, Lektor am Institut für Geographie und Regional-
forschung der Universität Wien.
Informationen zur Politischen Bildung Nr. 25 75
www.politischebildung.comSie können auch lesen