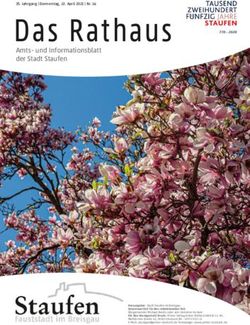Schubumkehr im Fühlen, Denken und Handeln - Rolf Arnold - Ingenta ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
PR 2020, 74. Jahrgang, S. 349-362
© 2020 Rolf Arnold - DOI https://doi.org/10.3726/PR042020.0036
Rolf Arnold
Schubumkehr im Fühlen, Denken und
Handeln
„Müsset im Naturbetrachten Wahrnehmung und im Sprachhandeln ge-
Immer eins wie Alles achten. meint, die es schon stets eher unmöglich
Nichts ist drinnen, nichts ist draußen; erscheinen ließ, die Objekte selbst in den
Denn was innen, das ist außen. Blick treten und ihren inneren Zusam-
So ergreifet ohne Säumnis
menhang tatsächlich ans Licht kommen
Heilig öffentlich Geheimnis!
zu lassen – frei von den Einflüsterungen
Freuet Euch des wahren Scheins, eigener Erfahrungen, biographischer Ge-
Euch des ernsten Spieles! wissheiten und der durch die Sprache ge-
Kein Lebend´ges ist ein Eins, stifteten Formen des Plausiblen. Selbst die
immer ist´s ein Vieles“.
phänomenologische Anstrengung, sinnli-
(J.W.Goethe)
che Evidenz aus der nüchternen Anschau-
Die Thematik ist alles andere als neu; ung zu schöpfen, brachte bei genauerer
sie scheint aber heute unabweisbarer Betrachtung nichts anderes zu Tage als
„geklärt“ zu sein als zu früheren Zeiten: Seit „ein durch und durch vermitteltes Objekt“.2
den Arbeiten der biologischen Erkennt Das, was uns der Fall zu sein scheint, ist
nistheorie1 sowie den neueren Einsichten somit unauflöslich mit unseren jeweiligen
über die Funktionsweise der menschli- mentalen Strukturbesonderheiten des be-
chen Wahrnehmung bzw. der Entwicklung, obachtenden und beurteilenden Subjekts,
Veränderung und Anpassung von subjek- seinen biographischen Erfahrungen und
tiven Deutungs- und Emotionsmustern historisch-gesellschaftlichen Inanspruch-
ist der prinzipiell konservative Gestus der nahmen, seinen dadurch gestifteten Seh-
menschlichen Orientierung noch deutlicher gewohnheiten sowie den Mustern seiner
als evolutionäre „Errungenschaft“, aber emotionalen Gewissheit und den Sprech-
auch innere Begrenzung des Möglichen routinen seiner Lebenswelt verbunden;
zutage getreten: Wir sind in unserem es verdankt sich keineswegs bloß einer
Fühlen, Denken und Handeln stets darum nüchternen Prüfung. Deshalb kann man
bemüht, weitgehend so zu bleiben, wie wir auch das,
sind und sehen die Welt nicht „so, wie sie
„(…) was ein anderer wahrgenommen
ist, sondern wie wir sind“ (Talmud).
hat, nicht bestätigen und nicht wider-
„Alt“ sind die Bemühungen der Philo-
legen, nicht befragen und nicht be-
sophie, das sogenannte Vermittlungspro-
antworten. Es bleibt im Bewusstsein
blem in den Griff zu bekommen. Damit
verschlossen und (…) für jedes andere
ist die schier unauflösbare Verwoben-
Bewusstsein intransparent“3 –
heit zwischen Subjekt und Objekt in der
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 349
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0so die ernüchternde Feststellung von Wir sind Ptolemäer
Niklas Luhmann, mit der er die Vorstellun-
gen jeglicher Unmittelbarkeit von Wahr- In der Konsequenz bedeutet dies, dass
nehmung, aber auch letztlich die ihrer die unmittelbaren Eindrücke und Beurtei-
Teilbarkeit in der Kommunikation verab- lungen, aus denen wir – bzw. besser: sich
schiedet, ohne die Tür zumindest einen – unsere Handlungsbegründungen herlei-
Spalt weit offen zu halten. Solche Türöff- ten oder – oft rückblickend – permanent
nungen können nämlich mit der „Kunst der rationalisieren, mehr mit uns selbst, unse-
erschließenden Nachfrage“ oder eines ge- ren Erfahrungen, Gewohnheiten und den
konnten „Reframing“4 ermöglicht werden Routinen unserer Identität und lebenswelt-
und der autopoietisch-solipsistischen Ge- lich-kulturellen Verwurzelung zu tun haben
schlossenheit kommunizierender Systeme als mit einer Prüfung, Abwägung und kon-
etwas von ihrer abgrenzenden Schärfe sensuellen Teilung dessen, was der Fall zu
nehmen. Wir können zwar einander nicht sein scheint, zumal
verstehen, aber gleichwohl erfolgreich dia-
logisieren und kooperieren sowie auch ge- „(…) die während der Evolution wirk-
meinsam verändern, wenn wir nicht länger samen Selektionsmechanismen ver-
dem „Bestätigungsirrtum“5 erliegen, son- mutlich nicht dazu angetan waren,
dern vielmehr um dessen sinnstiftende kognitive Strukturen auszubilden, die
Zähigkeit wissen und dieser z.B. durch für die Erfassung dessen optimiert
einen bewussten „Gang in den Unter- sind, was hinter den Dingen mögli-
schied“, die Perfektionierung der „Formen cherweise sich verbirgt“.9
des Zurückruderns“6 oder durch die ge-
Die Wahrnehmung vermengt vielmehr
zielte Inszenierung von Kontexten eines
kontinuierlich „selbsterzeugte Erregungs-
„Stolperns“7 entgegenzuwirken vermögen.
muster“ mit den „von draußen“ kommenden
Wer stolpert, der stammelt, und dieses
Einwirkungen,10 entwickelt demnach keine
„(…) stammelnde Erzählen vermag Abbilder von Wirklichkeit, sondern in vielfa-
vorurteilsfrei die Einsicht in seine eige- cher Hinsicht ein Wiedererkennen. Deshalb
nen Möglichkeiten zu gewinnen und können wir auch das Gegenüber letztlich
das meint, es vermag seine Bedingt- nicht verstehen, sondern bloß verwechseln
heiten und Bedingungen freizulegen – welch ernüchternde Ausgangsbasis unse-
und zu entlarven und mit dem Be- res Welt- und Selbstumgangs. Wir sollten
wusstsein von diesen, sich dennoch deshalb begreifen, ahnte schon Friedrich
zu bejahen“.8 Nietzsche, „dass bisher nur unsere Irrthümer
uns einverleibt waren und dass alle unsere
Es sind solche Verfremdungsanlässe
Bewusstheit sich auf Irrtümer bezieht!“.11
– „Stolpersteine“ –, mit deren Hilfe wir
Mit diesen Irrtümern erlauben wir es uns,
die überlieferten banalen Routinen unse-
„von der eigenen Wirklichkeit überzeugt zu
rer kognitiv-emotionalen Geschlossenheit
bleiben“,12 wie Rüdiger Safranski in seiner
durchschauen und uns darin üben können,
Nietzsche-Biographie schreibt, um sodann
die angelehnten Türen weiter zu öffnen –
kommentierend fortzufahren:
nicht, um durch diese endlich zu ontolo-
gischen Gewissheiten zu gelangen, wohl „Wir haben zwar ein kopernikanisches
aber zu anderen Möglichkeiten unseres Weltbild – und heutzutage ein Einstein-
„stammelnden Erzählens“ vorzustoßen – Weltbild – was aber die Einverleibung
Möglichkeiten, die uns wirksame Leitbilder betrifft, so sind wir immer noch Ptole-
der Veränderung stiften können. mäer“13 -
350 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0ein Vorwurf, der hart trifft, der uns aber meiner therapeutischen Praxis stets
auch zu der erkenntnis- und beobachter- predige, genau dies zu unterlassen.
theoretischen Ausgangsfrage jeglicher In mir ist eine Tendenz, unreflektiert
substanziellen Selbstreflexion zu führen genau den Menschen zu schlagen, der
vermag, die da lautet: „In was erinnert mir nah ist, und ich fürchte, ich werde
mich der aktuelle Sachverhalt an mich?“ ihn irgendwann in die Flucht schlagen,
Der chilenische Neurobiologe und Vertre- nur um wieder – mit meinem ‚Siehst-
ter einer biologischen Erkenntnistheorie du-ich-habe-es-doch-gewusst‘ - allein
Humberto Maturana hat diese von vielen zu sein“.14
als naturalistischen Kurzschluss erlebte
Besonderheit der Wahrnehmung in seiner Wie können wir auch in unserem so-
Theorie mit „unabweisbarer“ Evidenz be- zialen Handeln zu einer kopernikanischen
schrieben – weitgehend unbemerkt und oder gar Einstein-Wende gelangen? Wie
resonanzlos bleibend nicht nur für die Art können wir darin besser werden, unsere
unseres wissenschaftlichen Erkennens, eigenen Spuren in unseren Urteilen und
sondern auch für unsere Alltagskommu- Handlungsbegründungen zu identifizieren,
nikation in Beziehungs-, Erziehungs- oder um das Gegenüber mit seinen Motiven und
Führungsdialogen. Diese führen wir zu- Intentionen ungefilterter in Erscheinung
meist im Verfügbarkeitsmodus und mit fes- treten zu lassen – so, wie es sich selbst
ter Haftungsabsicht, da es uns leichter zu meint, und nicht so, wie wir es befürchten?
fallen scheint, die Ursachen im zufälligen Welche Konsequenzen würden sich aus
Gegenüber zu entdecken, als diese in uns einer solchen kopernikanischen Wende
selbst aufzudecken, wie sich dies in fol- des Umgangs für eine professionelle Be-
gendem Beispiel zumindest ahnungsweise gleitung in Erziehungs-, Beziehungs- oder
als tastende Suchbewegung abzeichnet: Führungslagen ergeben?
„Yvonne, eine attraktive Mitdreißigerin,
berichtet über ihre beiden geschei- „Un argumento para obligar“
terten Ehen und das Zerbröseln ihrer (Maturana)
derzeitigen Verbindung: Ich kann auch
nicht wirklich verstehen, was mich In der biologischen Erkenntnistheorie von
da treibt. Sicherlich, meine beiden Humberto Maturana wird das Subjekt
Ehemänner waren irgendwo rückblic- letztlich zum „synaptischen Selbst“.15 Dies
kend wirklich daneben, und ich bin bedeutet, dass seine Bewegungen und
froh, sie los zu sein, obgleich ich sie Bewegtheiten als Ergebnis und Ausdruck
auch einmal liebte, was ich heute seiner durch zerebrale Mechanismen
gar nicht mehr verstehen kann. Mein konstituierten Möglichkeiten angesehen
jetziger Mann ist ganz anders: Er ist und verstanden werden müssen – so das
spürbar committed, übernimmt Ver- „verpflichtende“ Argument Maturanas.16
antwortung für die Familie und ist ein Maturana markiert damit einen Paradig-
sanfter und nachdenklicher Mann. Und menwechsel, hinter den man nur in un-
doch passiert es mir immer wieder, reflektierter Gewohnheit, nicht aber aus
dass ich ihn beschimpfe und ihn mit Vernunftgründen zurückweichen kann.
unsäglichen Anschuldigungen konfron- In diesem Sinne „unterlief“ auch Jürgen
tiere. Ich bin dann vollkommen in einer Habermas die unversöhnliche Positio-
dominanten Bescheidwisserei und in nierung der Geisteswissenschaft gegen
der Du-Sprache, obgleich ich doch in jegliche Naturalisierung des Geistes17
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 351
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0und wandte sich der Frage zu, „worin von grundlegender Bedeutung für die
die richtige Weise einer solchen Naturali- Selbstreflexion sowie jegliche Persönlich-
sierung bestehe“, wie Wolfgang Welsch keits- und Haltungsbildung ist. Denn das
diese Position charakterisierte.18 In der emergierende Denken, Fühlen und Han-
Tat. Jürgen Habermas relativiert in seinen deln des Menschen bewegen sich in einer
Beiträgen zu den Herausforderungen und früh eingespurten Gewissheitstrance,
Möglichkeiten der Biowissenschaften die deren Kräfte stärker auf Kontinuität als
solipsistischen Konzepte zerebraler Rei- auf Innovation oder gar Musterbrechung
fung, indem er die Plastizität des Gehirns ausgerichtet sind. Menschen assimilieren
auch im Kontext des Kulturellen deutet. lieber als dass sie akkommodieren, um mit
So besteht die naturwissenschaftlich Piaget zu sprechen.23 Sie sehen, beurtei-
erklärbare Logik des Zerebralen keines- len und schlussfolgern bevorzugt in den
wegs in einem bloßen Vor-sich-hin-Reifen, Mustern und Formen, in denen sie gelernt
sondern in einer kontinuierlichen Trans- haben, die Welt zu erklären und auszu-
formation im Kontext kultureller Überliefe- halten – eine innere Bewegung, deren
rungen und Gegebenheiten; das Gehirn Funktionsweise offensichtlich sämtliche
braucht somit das Geistige, um seiner Formen der menschlichen Erkenntnis-
naturwissenschaftlichen Funktionslogik praxis durchzieht, seien diese auf das
überhaupt folgen zu können. Es gehört „Erkennen“ des Gegenübers in Alltags-
– so Wolfgang Welsch in seiner zusam- und Beziehungsdialogen oder gar auf das
menfassenden Lesart – „schon in seinen wissenschaftliche Erkennen bezogen.24
naturwissenschaftlichen Aspekten zur Auch der Verfügbarkeitswahn, wie man
Ordnung nicht bloß der Natur, sondern ihn in mathematischen Modellen der em-
ebenso des Geistes. Der Dualismus be- pirischen Sozialforschung häufig antrifft,25
steht allenfalls vordergründig“.19 Und im hat mehr mit den latenten Ängsten, Kon-
Kern gilt: „Geist steckt an!“, wie Bauer trollbedürfnisse und Exaktheitsphantasien
dieses Zusammenwirken zwischen Geist der Forscherinnen und Forscher gemein
und Natur in der kognitiv-emotionalen Rei- als mit ihrem Bestreben einer behutsa-
fung charakterisiert.20 men, methodenkritischen und selbstrefle-
Wer die gebildete und selbstreflexi- xiven Aufhellung von Beobachtungs- und
ve Persönlichkeit auch als Synaptisches Wirkungszusammenhängen. Humberto
Selbst konzipiert erliegt somit keineswegs Maturana schreibt dazu:
automatisch „einer reduktionistischen
Erklärung mentaler Phänomene“21 oder „Weil mir endgültig bewusst ist, dass
arbeitet „eine(r) normative(n) Konfigura- sich mein unmittelbares Erleben nicht
tion der Psyche“22 zu. Vielmehr erfahren an den kollektiv aufgestellten Kriterien
in einer Verschränkungsperspektive auch für Wahrnehmung und Täuschung,
die Hypothesen zur prägenden und letzt- Realität und Schein orientiert, gebe
lich auch determinierenden Kraft der ich gar nicht erst vor, meine Aussagen
frühen Erfahrungen eine neue – quasi auf eine von mir unabhängige Existenz
naturwissenschaftliche – Empirie: Die zu- stützen zu können, sondern verankere
treffendere – kulturell-argumentativ durch sie nur in meinem eigenen Tun. (…)
Lektüre und Diskurs gestiftete Einsicht Da die wahre oder objektive Realität
kann sich kaum in rigiden synaptischen als Grundlage der Sinngebung dienen
Verschaltungen nachhaltig verankern, soll, können wir erbittert über sie strei-
weshalb die Frage nach dem möglichen ten. Insofern darf man niemals außer
Umgang mit deren möglicher Plastizität Acht lassen, dass alle Realitäten in
352 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0erster Linie als Bereiche kohärenter „(…) auf jede Faser, die in die Groß-
Erfahrungen und Erklärungen gelebt hirnrinde hineingeht oder sie verlässt,
werden. Allerdings müssen wir uns 10 Millionen interne Verbindungen
ebenso klar vor Augen führen, dass kommen“,31
allein die Grundkohärenzen jeder ein-
dann ist die Schlussfolgerung, wir seien
zelnen von ihnen darüber entscheiden,
„neurobiologisch gesprochen, vor allem
welche Aussagen darin gültig sind“.26
mit uns selbst beschäftigt“32 alles andere
Die Konsequenzen dieser Kohärenz- als übertrieben. Und doch reagieren wir
verbundenheit unseres Denkens, Be- zumeist ptolemäisch, indem wir das Außen
urteilens und Handelns sind radikal; sie bzw. unser jeweils aktuelles Gegenüber
markieren den schier unüberwindbaren dafür verantwortlich machen, wie wir eine
Sumpf unserer eigenen Gewissheiten und Situation deuten und empfinden – so als
Festlegungen in der je spezifischen bio- gäbe es stets eine nachweisbare lineare
graphischen Erfahrung und lebensweltli- Ursache-Wirkungs-Logik zwischen dem,
chen Einbettung. „Ich sehe dich nicht so, wie wir uns (z.B. in einer Beziehung)
wie du bist, sondern wie ich bin – verzeih fühlen, und dem, was das Gegenüber tut.
mir!“ – so lautet deshalb der Lösungssatz Der Bremer Hirnforscher spricht in die-
der fortgeschrittenen systemischen Thera- sem Zusammenhang von der „Illusion der
pien, die damit vom Wissen zum Nichtwis- falschen Ursachenzuschreibung“33 und
sen und von der Bewertung zum Verstehen beschreibt, zu welch subtiler Verdrehung
zurückrudern.27 Für Maturana folgt das der Wirkungszusammenhänge uns diese
menschliche Erkennen jeweils der inne- immer wieder verführt:
ren Struktur des Beobachters, d.h. es ist
„Zuvor sprachlose Gefühle der Furcht
strukturdeterminiert, nicht evidenzbasiert.
und Angst erhalten in dieser Welt eine
Menschliches Erkennen, Kommunizieren
bestimmte Deutung: Sie heften sich
und Kooperieren sind selbstorganisiert,
an bestimmte Geschehnisse, die im
d.h. in ihnen „(realisieren) sich Systeme
Zweifelsfall primär gar nichts mit ihnen
als Produkte ihrer eigenen Organisation“28
zu tun haben. Sie entstammen zum
und nicht als so-und-nicht-anders gerecht-
Beispiel einer negativen Bindungser-
fertigte Bezugnahmen auf Außenreize. Für
fahrung, dem Erleben von Hilflosigkeit
ihn steht außer Frage,
und Einsamkeit des Säuglings und tre-
(…) dass strukturdeterminierte Syste- ten im Erwachsenenalter in Form von
me niemals außengeleitet sind – dass Trennungsangst gegenüber dem Part-
man sie zwar anstoßen, aber nicht ner auf“.34
festlegen kann“29
Die Kernfrage jeglicher Veränderung
wobei, wie Helmut Willke zu sagen ist deshalb die nach den Möglichkeiten
weiß, eines selbstreflexiven Aufdeckens und der
wirksamen Transformation der vertrauten,
„das intervenierte System selbst die
aber gleichwohl unbewussten Denk- und
Kriterien vor(gibt), unter denen es be-
Seinsmuster des „untrainierten Geistes“,
reit ist, sich beeindrucken zu lassen“.30
der unbeabsichtigt „darauf losplappert“.35
Wie dominant diese Inside-Out-Me- Dieser bedient sich seiner eigenen Er-
chanismen tatsächlich unser Fühlen, Den- fahrungen und Deutungsroutinen, biswei-
ken und Handeln bestimmen, wird in der len auch seiner eigenen traumatisierten
Hirnforschung schon seit längerem deut- Gewissheiten – ein Sachverhalt, der in
licher erkannt. Wenn es stimmt, dass den psychologischen Forschungen der
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 353
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0letzten Jahrzehnte tief ausgelotet wurde. ihrer Gangbarheit („Viabilität“) auf neuen
Dabei traten u.a. auch die subtilen psy- Wegen zu erproben und so stolpernd und
chologischen Mechanismen zutage, wie tastend zu einer resonanten Beziehung zu
sie z.B. dem oben referierten Beispiel zu- dem jeweiligen Gegenübersystem fortzu-
grunde liegen können, gleichwohl nicht schreiten. Erst dadurch wird eine Bewe-
„müssen“. gung von Ptolemäus zu Kopernikus oder
gar Einstein möglich, wie dies auch der
Hirnforscher Wolfgang Singer andeutet:
Nicht nur der andere ist
„Hier also haben wir ein weiteres Bei-
„schwierig“, wir selbst auch
spiel dafür – die moderne Physik hält
weitere bereit –, dass naturwissen-
Folgt man dem „verpflichtenden Argu-
schaftliche Erklärungsmodelle mit
ment“ der (neuro)biologischen Erkennt-
subjektiven Erfahrungen und auf In-
nistheorie, so bleibt einem nichts anderes
tuition beruhenden Überzeugungen in
übrig als die Selbstveränderung von sy-
krassem Widerspruch stehen können.
naptischen Mustern anzuregen bzw. an-
Die Rezeptionsgeschichte der helio-
zustupsen und zu unterstützen, da diese
zentrischen Kosmologielehre und der
sich zu Metarepräsentationen verdichten,
Darwinschen Evolutionstheorie legen
die uns mit Gewissheiten ausstatten, die
nahe, dass sich schließlich die natur-
wir dann im jeweils Aktuellen wiederent-
wissenschaftlichen Beschreibungen
decken bzw. rekonstellieren. Wir sehen
gegen Überzeugungen durchsetzen,
dann das Aktuelle bzw. das Gegenüber
die auf unmittelbarer Wirklichkeits-
entsprechend unserer eigenen, tief einge-
erschließung beruhen, und dass wir
spurten Wahrnehmungsroutinen. Diesen
uns schließlich an die neuen Sichtwei-
subtilen Verwechselungs-Mechanismus
sen gewöhnen. Ob dies auch der Fall
zu kennen, seine Wirkungen in den Blick
sein wird für Erkenntnisse, die unser
zu nehmen, zu relativieren und hinter sich
Selbstverständnis noch nachhaltiger
zu lassen, gilt für die eigenen Muster, wie
verändern als die vorangegangenen
auch die der jeweiligen Gegenüber, mit
wissenschaftlichen Revolutionen,
denen wir in Beziehung stehen oder gar
muss die Zukunft beantworten. Un-
für deren gelingende Transformation wir
aufschiebbar werden jedoch schon
in Bildungs- und Veränderungsprozes-
jetzt Überlegungen über die Beurtei-
sen Verantwortung übernommen haben.
lung von Fehlverhalten, über unsere
Eine solch selbstreflexive Bewegung
Zuschreibung von Schuld und unsere
muss weitgehend ohne Referenzpunkt
Begründungen von Strafe“.37
auskommen, haben wir doch mit der
Neutralisierung unseres gewachsenen In dem oben skizzierten Fall einer be-
Referenzpunktes bereits alle Hände voll ginnenden Selbstreflexion („Ich kann auch
zu tun. Der Reifungseffekt einer solchen nicht wirklich verstehen, was mich da
inneren Bewegung ist ganz grundlegend: treibt“) könnte eine solche Kopernikani-
Wer nämlich tief durchspürt an den Punkt sche Wende in den Schritten der Relativie-
der Wittgensteinschen Verunsicherung rung und Umdeutung schließlich auch zum
gelangt ist, dass „dass es mir so scheint, Erkennen einer eigenen Spaltungsabwehr
nicht heißt, dass es so ist“,36 der ist eher führen. Durch diesen aus der Traumafor-
in der Lage, sich anderen Lesarten zu- schung bekannten Mechanismus der Sub-
zuwenden und diese nicht nur auszu- jektivierung wiederholen sich hinter dem
halten, sondern – proaktiv – hinsichtlich Rücken der Akteure kontinuierlich frühe
354 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Bindungsmuster in aktuellem Geschehen und Unsicherheit („Es könnte auch ganz
– ein Vorgang, der meist ptolemäisch zu- anders sein!“). Die Tendenz, diesen in-
geordnet und in Du-Botschaften bzw. neren Weg zu meiden und lieber an den
Vorwürfen verfestigt wird und dadurch den gewohnten – projektiven – Kausalattribuie-
Zugang zu dem, was da eigentlich am Wir- rungen im jeweiligen Außen festzuhalten,
ken ist, verbaut: ist deshalb naheliegend. Zwar basieren
die so erhältlichen Schlussfolgerungen
„In einer Paarbeziehung in der Post-
auf der „Illusion der falschen Ursachenzu-
Idealisierungsphase können diese
schreibung“,40 doch liefern sie der Suche
frühen (…) Bindungsmuster reakti-
immerhin eine Orientierung, wenn auch
viert werden. Die Angst vor der dro-
eine falsche. Wer in solchen alten Bildern
henden Desintegration des Selbst
festhängt, handelt nach dem Grundsatz,
kann nur (…) durch Spaltungsabwehr
dass es besser sei, eine falsche, statt gar
und Wendung der eigenen Aggres-
keine Erklärung zu haben. Damit verharren
sion nach außen abgewendet wer-
sie innerlich in ptolemäischen Zeiten.
den. Das Umschlagen von liebevollen
Im Beziehungsgeschehen kann man
Gefühlen und Symbiosesehnsucht aus
sich damit zwar dann von dieser „fal-
der primären Mutterbeziehung in Wut
schen Ursache“ im Außen lösen – eine Art
und Hass kann durch kleinste Irritatio-
Katharsis durch Placebos –, zahlt dafür
nen ausgelöst werden, was die Paar-
aber den Preis der subtilen Fortwirkung
beziehung weiter destabilisiert und
der eigenen Spaltungsabwehr im wei-
gleichzeitig hoffnungslos verkeilt – die
teren Leben. Diese droht einen, immer
Beziehung wird zur unkalkulierbaren
und immer wieder in Situationen hinein
Kampfzone“.38
zu führen, welche einen unzufrieden las-
Menschen, die in dieser Weise von sen, da man in ihnen weder ein klares Ja,
den Fortwirkungen ihres frühen Bindungs- noch ein klares Nein zu spüren vermag.
erlebens geprägt sind Es bleibt bei einem „Jein“ als Lebensmus-
ter, mit welchem man – nachdem dieses
„(…) waren in ihrer Kindheit von
Muster alle Beziehungen, die man einging,
emotional instabilen Eltern abhängig.
zerspalten hat – schließlich alt werden und
Die primären Quellen von Sicherheit
sterben lassen, ohne jemals zu klaren – in-
waren gleichzeitig die Quellen intensi-
tegrierten – Verhältnissen tatsächlich vor-
ver Angst. Gerade in ängstigenden Si-
gestoßen zu sein, obgleich man beständig
tuationen ist das Sicherheitsbedürfnis
von diesen träumte. „Was im Innen nicht
besonders groß, sodass geängstigte
ist, kann auch im Außen nicht sein!“ – lautet
Kinder eine ebenso intensive wie fragi-
der Kommentar, mit dem die systemische
le Bindung an das ambivalent besetzte
Forschung und Theoriebildung solche bi-
Objekt entwickeln und diese dann auf
polaren Routinen des Beziehungsalltags
den Partner übertragen“.39
beschreibt, welche die durch diese stol-
Wer solche Gewissheiten bereits zu pernden Akteure entweder in Hasslieben
Metarepräsentationen verhärtet in sich gefangen hält oder in Dreiecksbeziehun-
trägt, der hat es besonders schwer, den gen treibt, in denen die Ja-Nein-Oszilla-
Weg der kopernikanischen Wende beim tion des Inneren in Idealisierungs- und
Ausstieg aus tief eingespurten Fühl-, Denk- Abwertungsgesten eines äußeren Dramas
und Handlungsmustern zu gehen, führt beständig wieder reinszeniert wird.
dieser ihn doch zunächst durch angstbe- Der Weg der kopernikanischen Wende
setzte Erfahrungen der inneren Instabilität eröffnet demgegenüber die Möglichkeit
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 355
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0einer nicht länger stolpernden Bewe- Weg führt über 5 Stufen einer begleiteten
gung, sondern einer bewusst „selbstein- Selbstbildung, die professionell begleitet
schließenden“ Transformation. Dieser und unterstützt werden will.
Die kopernikanische Treppe
5 Transformation Fragen:
– Wie kannst Du das Neue (neue Denk- und
Verhaltensweisen) in Dir stärken?
– Was kann sich dadurch verändern?
4 Umdeuten Fragen:
– Möchtest Du zukünftig in anderer Weise das
Erlebte deuten?
– Welcher Umdeutungs(leit)satz wäre hilfreich?
3 Relativieren Fragen:
– Welche anderen – alternativen/ zusätzlichen
Formen einer Verarbeitung wären denkbar?
– Wie fühlen sich diese für Dich an?
2 Fokussieren Fragen:
– Welches Ursprungserleben kommt Dir in den
Sinn?
– Welche Erinnerungsfetzen, Sätze und Gefühle
kommen in Dir auf?
1 Erkennen Fragen:
– Was treibt Dich? –Was ruft Dir das
Geschehen über Dich selbst in Erinnerung?
Über die kopernikanische Treppe schrei- erstarrter Lebensgefühle sind dann nicht
ten wir aus der ptolemäischen Welt der von einer Veränderung des Außen (neuer
linearen Ursachenzuschreibung, der In- Partner, neue Umgebung, neue Arbeit
Haftungsnahme des jeweils aktuellen etc.) zu erwarten, sondern vom Umgang
Gegenübers und der „Illusion der falschen mit der eigenen „Stolperung“.42 Wer bloß
Ursachenzuschreibung“41 hinaus und be- im Außen verändert, ohne seine gewach-
wegen uns – stolpernd – in die Welt der senen Welt- und Selbstsichten wirksam
Wahrscheinlichkeit, Vielfalt und – neuen – zu transformieren, der verbleibt letztlich in
Möglichkeit. Es könnte auch ganz anders einem Modus, der ihn mit schlafwandleri-
sein – und ist es auch! Wer zur kopernika- scher Sicherheit immer und immer wieder
nischen Wende fortschreitet, erkennt mehr in die ach so vertrauten „Rekonstellie-
und mehr: Das aktuelle Gegenüber kann rungen“ führt. Der Begriff der Rekonstel-
nichts dafür, dass man die konkrete Lage lierung beschreibt dabei die subtilen
so erlebt, wie man sie erlebt, und die eige- Bestätigungsformen des Umdeutens ge-
nen Gefühle und Ideen sind deshalb auch gebener Lagen, durch deren Wirkungen
nicht so und nicht anders angemessen, letztlich das unbewusst stets Befürchtete,
zumutbar oder gar zutreffend, weil wir sie Ersehnte und Abgespaltene immer wieder
haben. Vielmehr sind ein Schuld(en)schnitt Gestalt gewinnen kann.
und eine Schubumkehr im Fühlen, Den- Das Plädoyer für eine Schubumkehr im
ken und Handeln notwendig, um wirksam Fühlen, Denken und Handeln konfrontiert
neue Entwicklungslinien aufbrechen zu die Akteure zunächst mit zwei Ernüchte-
lassen. Die Befreiung aus schier unlösbar rungen, bevor sie mit zwei Ermutigungen
erscheinenden Lagen und die Lösung aufwartet, wie folgende Abbildung zeigt:
356 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Ernüchterungen und Ermutigungen beim erfolgreichen Stolpern auf der kopernikanischen Treppe
die beiden Ernüchterungen 1 Unsere Wahrnehmung bildet Gegenübersysteme nicht ab, sondern
konstruiert diese nach den Maßgaben dessen, was wir kennen und
auszuhalten gelernt haben.
Frage: „In was erinnert mich der aktuelle Sachverhalt an mich?“
2 Die Macht der unbewussten Denk- und Seinsmuster ist erdrückend,
wenn „der untrainierte Geist vor sich hinplappert“.43
Frage: „Wie kann ich vertraute Denk- und Wahrnehmungsmuster
erkennen und wirksam suspendieren?“
die beiden Ermutigungen 1 Wir können die gewachsenen Strukturbesonderheiten unserer
Wahrnehmung, d.h. die kognitiv-emotionalen Metarepräsentationen
und deren magnetische Wirkung auf die Ordnung der aktuellen
Erfahrungsspäne, in Achtsamkeit, Fokussierung und Selbstreflexion,
erkennen.
Auftrag: Zeichne ein Bild Deiner inneren Befürchtungen („Dämonen“)!
2 Durch gezieltes Umherstolpern im Unterschied („Es könnte auch ganz
anders sein!“) kann die Wirkkraft des inneren Magneten mehr und
mehr gemindert werden und Neues zum Ausdruck kommen.
Auftrag: Zeichne ein Bild Deiner idealen Formen des Umgangs mit Dir
selbst und der Welt! Verbinde Dich wirksam mit diesem!
Grundlinien einer Pädagogik verantwortlichen Akteure gewohnt sind,
der Schubumkehr das Betriebliche zu deuten und zu denken
und welche Möglichkeiten sie dadurch
Seit einigen Jahren mehren sich in der Bil- sehen oder übersehen. Die Rede ist sogar
dungspraxis und Bildungstheorie die Im- von einer „epistemologischen Kultur“, in
pulse in Richtung einer epistemologischen der die Menschen lernen, sich vor dem
Konzeption von Beziehung und Koope- Hintergrund der letztlich ungeklärten Frage
ration sowie von Führung und Organisa- „how do we know what we know“46 in
tion, wie u.a. die Arbeiten aus dem MIT in neuer Weise aufeinander zu beziehen und
Boston zeigen: So verweist der Presence- miteinander umzugehen. Eine solche epis-
Fokus von Peter Senge u.a. in ähnlicher temologische Haltung erleichtert nicht nur
Weise auf die beobachtertheoretische die Reflexion und Relativierung gewohnter
Selbstreflektion im Sinne einer angewand- Denk-, Seins- und Kooperationsmuster,
ten Epistemologie,44 wie auch die neueren es nimmt diese gewissermaßen zum Aus-
Beiträge von Dirk Baecker.45 Der zunächst gangspunkt jeglicher Veränderung. Das
unverständliche Begriff „Epistemologie“, Denken muss selbst disruptiv werden,
der so viel bedeutet wie „Erkenntnistheo- um sich mit disruptiven Veränderungen
rie“, erschwert zwar einerseits die Popu- überhaupt angemessen auseinanderset-
larisierung dieser aktuellen Fokussierung, zen zu können und nicht im Neuen stets
doch ermöglicht er andererseits eine Stol- das Alte zu sehen bzw. die Zukunft mit
perung, die den programmatischen Gehalt den Mitteln der Vergangenheit erschließen
des mit ihm angeregten Paradigmenwech- zu wollen (und dadurch zu verpassen) –
sels in Erscheinung treten lässt: Es geht Versuche, die bereits zum Verschwinden
dabei z.B. nicht länger um die Frage, ganzer Branchen geführt haben. In die-
wie z.B. Betriebe sind und „tatsächlich“ sem Sinne ist auch bereits die Rede von
funktionieren, sondern darum, wie die „Disruptive Personality Types“47 und von
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 357
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0einem „Disruptive Thinking“,48 deren Be- Gelingens von Bildung, wie die Eröffnung
deutung gerade in Zeiten beschleunigter beruflicher und persönlicher Optionen
Entwicklungen in Technologie, Wirtschaft für die Zukunftsgestaltung und Lebens-
und Gesellschaft zunehmend in das Zent- formung. Diesen Maßstäben sind auch
rum der Debatte um deren zukunftsfähige Bildungstheorie und Didaktik verpflichtet,
Gestaltung dieser Kontexte rückt: „Disrup- die deshalb – anders als das naturwis-
tionen sind eine der Signaturen der Zu- senschaftliche Objektivitätsideal – stets
kunft“ stellen die Kompetenzforscher John normativ gebunden beobachten, deuten,
Erpenbeck und Volker Heyse fest und verstehen und vorschlagen. Sie prüfen
schreiben: „Kompetenzentwicklung ist der und bewerten auch die Bildungsmöglich-
wahrscheinlich wichtigste Weg, diese Dis- keiten nicht allein bezüglich ihrer Übereins-
ruptionen zu bewältigen“.49 timmung mit den Anforderungen von
An dieser Stelle wird das Begreifen Arbeitsmarkt und Gesellschaft, sondern
dessen, wie wir begreifen zum Dreh- und zugleich und in erster Linie nach Maßgabe
Angelpunkt jeglicher Kompetenz- und der Förderung und Begleitung der Indivi-
Persönlichkeitsentwicklung. Es genügt – duierung, d.h. Selbstwerdung. Ihr Leitbild
so die sozialwissenschaftlichen Zeitdiag- ist der „reflexive Mensch“ (reflexible man).
nosen – nicht mehr länger, hoch qualifizierte
Fachkräfte auszubilden und der Gesell- „Dieser weiß um die selbsterfüllende
schaft bereitzustellen. Deren Fachwissen Kraft seiner Gewohnheiten und der
ist nämlich häufig bereits in Teilen oder eigenen Traditions- sowie Routinen-
ganz veraltet, wenn sie ihre Ausbildungen verhaftung. Er ist sich der Tatsache
abgeschlossen haben und ihnen ein erster bewusst, dass diese ihn immer wieder
Berufseinstieg gelungen ist. Der „flexib- dazu verführen, an seinen Gewisshei-
le Mensch“50 – gefordert und überfordert ten festzuhalten und sich die Zukunft
durch die beständigen Anpassungserwar- auf der Basis der eigenen Erfahrun-
tungen der dynamisch sich wandelnden gen zu konstruieren, wodurch er dazu
gesellschaftlich-ökonomischen Verhältnis- beiträgt, dass auch die Zukunft mehr
se – kann mit dieser Entwicklung kaum oder weniger so wird, wie die Ver-
mehr Schritt halten, weshalb ein anderes gangenheit bereits gewesen ist. Der
Leitbild an dessen Stelle treten muss – ein „reflexible man“ ist deshalb nicht bloß
Leitbild, das nicht irgendwelche Ideale flexibel, sondern auch um Reflexion
von Selbstverwirklichung und Persönlich- bemüht. Er weiß, dass er seine Welt
keit beschwört, sondern nüchtern nach bloß verändern kann, wenn es ihm ge-
den Kompetenzen fragt, welche die Ge- lingt, sich selbst zu verändern. Indem
staltung einer zunehmend unsicheren Zu- er lernt, die Gegebenheiten weniger
kunft ermöglichen. Diese benötigen eine rasch zu beurteilen, öffnet er sich auch
innere Verankerung bzw. Halt(er)ung und dem Fremden, Unbekannten und viel-
verpflichtet die verantwortlichen Akteure leicht bereits Verworfenen gegenüber.
dazu, die Bildung und Kompetenzent- Er vergleicht wertschätzend, wo er
wicklung der Menschen so zu gestalten, früher durch Beurteilungen Eindeutig-
dass den Erwartungen des Einzelnen und keiten herstellte. Dadurch schaffte er
der Gesellschaft – und nicht nur einer be- zumindest die Voraussetzungen dafür,
stimmten Gruppe – Rechnung getragen dass sich ihm die Wirklichkeit in an-
werden kann. Die Gebote der Gerech- derer Weise – als andere Wirklichkeit
tigkeit und Chancengleichheit sind dafür – zu zeigen vermag. Damit erreicht der
ebenso unhintergehbare Maßstäbe des „reflexible man“ eine Flexibilität eigener
358 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Art. Diese verdankt sich seiner Eigen- Arbeitsmarkt und die eigene Lebensgestal-
drehung, keiner bloßen Anpassung tung in den Life-long-learning-Gesellschaf-
an vermeintlich oder tatsächlich Ge- ten nicht zu unterschätzender Vorgang der
gebenes. Und diese Eigendrehung ist Rückübereignung. Wissen wandelt sich
Ausdruck der Lernfähigkeit, die er als dadurch gleichzeitig von einem bloßen
Potenzial in sich trägt“.51 Besitz zu einer komplexen Fähigkeit, das
eigene Denken und Handeln nicht länger
Sicherlich: Auch der reflexible Mensch an persönlichen, sondern an geteilten
benötigt Wissen, um sachgemäß prüfen, Gütekriterien zu orientieren.
beurteilen und handeln zu können. Sein Die englische Wortschöpfung „re-
Wissen ist jedoch von anderer Subs- flexible“ soll in diesem Zusammenhang
tanz. Es integriert die sachgemäßen verdeutlichen, worum es bei dieser kom-
Zusammenhänge mit seinen eigenen Fä- petenzorientierten Wende im Kern geht: Es
higkeiten, diese aufzugreifen und bei der ist nicht bloß der „flexible Mensch“,52 son-
Entwicklung eigener Stellungnahmen oder dern auch der „reflexive Mensch“, der hier
der Ingangsetzung eigener Lösungsver- Gestalt zu gewinnen scheint. Er muss in
suche konstruktiv zu gebrauchen. Um seiner Subjektivität letztlich zahlreiche Ge-
diese Fähigkeiten zum – professionellen gensätze gleichzeitig balancieren und situa-
– Umgang mit Wissen und zu dessen tionsangemessen ausdrücken können: den
Nutzung entwickeln zu können, bedarf es Umgang mit den Anforderungen des Außen
anderer Vorgaben als bloßer Lehrpläne sowie die Stärkung der eigenen Kräfte im
oder Modulhandbücher (i.S. von Inhalts- Innen, die Wahrung der Kontinuität sowie
auflistungen), deren Themen sich einer den Mut zu Neuem und die professionelle
überlieferten Strukturierung und Curricu- Distanz gegenüber der gestaltenden Nähe.
larisierung verdanken. Erforderlich ist viel- Der reflexible Mensch verfügt in hohem
mehr die Stärkung des methodischen und Maße über Akkommodationskompetenzen,
sozialen sowie emotionalen und reflexiven d.h. er ist in der Lage neuartige Probleme
Vermögens des Lernenden an und in der selbstorganisiert und sachgemäß erfolg-
Auseinandersetzung mit inhaltlichen Fra- reich zu bewältigen und dabei nicht in den
gen. Dieser lernt dabei nicht nur „etwas“, einmal erlernten Sicht-, Beurteilungs- und
sondern erweitert seine persönlichen Handlungsweisen stecken zu bleiben.
Fähigkeiten
– zur Erschließung von Wissensquellen, Haltung als Kompetenzkern
– zum Umgang mit Neuem,
– zum selbstverantwortlichen Handeln, Der eigentliche Referenzpunkt beim Stol-
– zur Planung und Gestaltung eigener pern, Suchen, Prüfen, Beurteilen und
Lernprojekte Schlussfolgern ergibt sich dem reflexible
– sowie zur Veränderung vertrauter Man aus einer festen ethischen Verwur-
Sichtweisen und Routinen. zelung. Den Unverfügbarkeiten im Außen
weiß er auf der Basis einer inneren Wert-
Dadurch wird das lernende Individuum haltung zu begegnen, die seine unmittelba-
mehr und mehr zu dem, was es bereits re Art, die Welt zu fühlen, auszuhalten und
immer schon gewesen ist – teils, ohne zu gestalten trägt. Diese sichert ihm ge-
dies zu wissen: Eigentümer oder Eigen- wissermaßen ein inneres Gegengewicht zu
tümerin seines bzw. ihres Lernens – ein den beständigen Wandlungen im Außen. In
für die demokratische Gesellschaft, den diesem Sinne stimmt es, dass „Werte stark
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 359
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0(machen)“, wie ein von dem für Unterricht der Contemplative Education an amerika-
zuständigen Bayerischen Staatministeri- nischen Hochschulen zeigen. Diese zielen
um herausgegebenes Handbuch für Leh- auf die Stärkung einer spirituellen Orientie-
rerinnen und Lehrer verspricht,53 ohne rungsbasis ihrer Studierenden, indem sie
allerdings mit erwiesenermaßen wirksa- sie z.B. früh mit den Fragen in Verbindung
men Wertevermittlungskonzepten aufwar- bringen
ten zu können. Denn man kann zwar Werte
lernen, so wie man die Zutaten zu einem „Who am I? What are my most deeply
Pudding lernen und hernach rekapitulieren felt values? Do I have a mission or pur-
und gar begründen kann, doch ist man in pose in my life? Why am I in college?
der Wertebildung mit einem solchen Vor- What kind of person do I want to be-
gehen zu oberflächlich unterwegs, da es come? What sort of world do I want to
ja nicht darum geht, Werte zu kennen, help create?“56
sondern vielmehr darum, sich ihnen in
Neben diesem Ansetzen an persön-
der eigenen Lebenspraxis verpflichtet zu
lichen Sinnfragen ist auch eine lebendige
fühlen. Deshalb bleiben Belehrung und
Inszenierung entsprechender Transforma-
Intervention in der Wertebildung auch in
tionsangebote sinnvoll. Geht man nämlich
aller Regel unwirksam, während allenfalls
davon aus, dass das moralische Bewusst-
die Schaffung von Kontexten eines emotio-
sein des Menschen bereits sehr früh und
nal durchspürten Erlebens die nachhaltige
in dichtem emotionalen Erleben angebahnt
Tiefenverankerung von Werten als kognitiv-
und verankert wird, so ist es z.B. für die
mentale Introjekte ermöglichen können.
Führungskräftefortbildung in Unternehmen
In solchen Kontexten können Über-
naheliegend, nach didaktischen Möglichk-
lieferungen des ethischen Diskurses als
eiten und Formen einer entsprechenden
“Möglichkeitsräume“54 zwar eröffnet und
Labilisierung und einer authentisch-af-
erörtert werden, ihre Aneignung bzw. Anver-
fektiven Lernatmosphäre zu suchen. Es
wandlung jedoch bleibt ihrer Anschließbar-
geht demnach in entsprechenden Ange-
keit für den Lernenden vorbehalten. Und
boten um emotionale Resonanz, wie wir
diese ist in hohem Maße von der Emotiona-
ihr auch in der frühen Werteentwicklung
lisierung des Werteerlebens abhängig, wie
ausgesetzt waren – zumal wir aus der bio-
der deutsche Kompetenzforscher John Er-
grafischen Krisenforschung wissen, dass
penbeck schreibt. Werte „überbrücken“ für
individuelle Umwertungen im fortgeschrit-
ihn „fehlendes Wissen“ und
tenen Lebensalter sich meist im Kontext
„(…) ermöglichen ein Handeln unter tiefer „kritischer Lebensereignisse“57 er-
Unsicherheit, die aus dem selbstor- eignen. Zwar kann es nun nicht Sinn und
ganisativen Charakter der Welt und Zweck einer nachhaltigen Haltungsbildung
ihrer Teilsysteme resultiert, worin All- sein, Menschen in tiefe Krisen zu stürzen,
gemeingültigkeit, Determinismus, Ein- um aus den damit verbundenen Labilisie-
fachheit und Einheitlichkeit verloren rungen neue Werthaltungen entwickeln zu
sind. Ohne Werte wären wir hand- können, es bedarf aber gleichwohl einer
lungsunfähig. (…) Ohne echte emo- gewissen Erschütterung; Unterschiedser-
tionale Labilisierung gibt es keinerlei fahrung und Ausweglosigkeit, wie sie u.a.
Wertewandel“.55 in der Arbeit mit moralischen Dilemmata
oder in der systemischen Aufstellungs-
Diese Hinweise sind auch für die Ver-
arbeit realisiert werden.
suche einer Haltungsbildung von grund-
legender Bedeutung, wie u.a. die Ansätze
360 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Anmerkungen Resonanz. München 2019, S. 82.
21 Singer, W.: Vom Gehirn zum Bewusstsein.
1 vgl. Maturana, H.: Biologie der Realität. Frankfurt a.M. 2006, S. 9.
Frankfurt a. M. 1998. 22 Dörpinghaus, A.: Mein Gehirn lernt, aber
2 Negt, O.: Überlebensglück. Eine autobiogra- nicht ich. In: Forschung und Lehre, 7/2019,
phische Spurensuche. 2. Auflage. Göttingen S. 624.
2017, S. 35. 23 vgl. Piaget, J.: Nachahmung, Spiel und
3 Luhmann, N.: Was ist Kommunikation? In: Traum. Stuttgart 1975.
Ders.: Soziologische Aufklärung 6: Die So- 24 vgl. Arnold, R.: Ach, die Fakten! Wider den
ziologie und der Mensch. 2. Auflage. Wies- Aufstand des schwachen Denkens. Heidel-
baden 2005, S. 116. berg 2018, S. 84ff.
4 Arnold, R.: Wie man wird, wer man sein 25 vgl. Rosa, H.: Unverfügbarkeit. 3. Auflage.
kann. 29 Regeln zur Persönlichkeitsbildung. Salzburg 2019.
Heidelberg 2016, S.75f. 26 Maturana, H.: Was ist erkennen? Die Welt
5 Hübl, P.: Die aufgeregte Gesellschaft. Wie entsteht im Auge des Betrachters. München
unsere Emotionen unsere Moral prägen und 2001, S. 29ff.
die Polarisierung verstärken. Bielefeld 2019, 27 vgl. Arnold, R.: Von der Evidenz der Kons-
S.19. truktion zur Konstruktion der Evidenz. In:
6 Arnold, R.: Wie man wird, wer man sein www.studienseminar.rlp/fileadmin/user_up-
kann. 29 Regeln zur Persönlichkeitsbildung. load/studienseminar.rlp.de/bb-nr/paed-
Heidelberg 2016, S. 146f. fundst/2012/AGL-02-2012.pdf (Aufruf am
7 Joisten, K.: Aufbruch. Ein Weg in die Philo- 14.8.2019).
sophie. Berlin 2007. 28 Maturana, H.: Was ist erkennen? Die Welt
8 ebd., S. 236. entsteht im Auge des Betrachters. München
9 Singer, W.: Vom Gehirn zum Bewusstsein. 2001, S. 18.
Frankfurt a.M. 2006, S. 12. 29 ebd., S. 19.
10 ebd., S. 44. 30 Willke, H.: Strategien der Intervention in auto-
11 Nietzsche, F.: Sämtliche Werke. Bd.3. nome Systeme. In: Baecker, D. u.a. (Hrsg.):
München 1980, S. 383. Theorie als Passion. Frankfurt a.M. 1987,
12 Safranski, R.: Nietzsche. Biographie seines S. 334.
Denkens. München 2000, S. 244. 31 Spitzer, M.: Lernen. Gehirnforschung und die
13 ebd. Schule des Lebens. Heidelberg 2007, S. 54.
14 Arnold, R.: Wie man liebt, ohne (sich) zu ver- 32 ebd.
lieren. 29 Regeln für eine kluge Beziehungsge- 33 Roth, G.: Persönlichkeit, Entscheidung,
staltung. 2. Auflage. Heidelberg 2016, S. 102f. Verhalten. Warum es so schwierig ist, sich
15 vgl. LeDoux, J.: Synaptic Self. How Our Brains und andere zu verändern. Stuttgart 2007, S.
Become Who We Are. New York 2002. 280.
16 vgl. Maturana, H.: La Objectividad. Un Argu- 34 ebd.
mento para Obligar. Santiago 1997. 35 Dispenza, J.: Schöpfer der Wirklichkeit. Der
17 vgl. Habermas, J.: Rede anlässlich des ihm Mensch und sein Gehirn. 5. Auflage. Burg-
im Jahre 2004 verliehenen Koyoto_Prei- rain 2016, S. 73.
ses. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 36 vgl. Wittgenstein, L.: Über Gewissheit.
15.11.2004, S. 35. Frankfurt a.M. 2002.
18 Welsch, W.: Wenn du wüsstest, was ich 37 Singer, W.: Vom Gehirn zum Bewusstsein.
denke. Die Biowissenschaften und ihre He- Frankfurt a.M. 2006, S. 57.
rausforderung: Wie Jürgen Habermas Geist 38 Peichel, J.: Destruktive Paarbeziehungen: Das
und Natur versöhnt. In: Der Tagesspiegel vom Trauma intimer Gewalt. Stuttgart 2013, S. 154.
17.6.2009 (https://m.tagesspiegel.de/kultur/ 39 Kottje-Birnbacher, L. u.a.: Imagination in der
habermas-wenn-du-wuesstest-was-ich- Psychotherapie. Bern 2010, S. 796.
denke/1538062.html). 40 Roth, G.: Persönlichkeit, Entscheidung, Ver-
19 Ebd. halten. Warum es so schwierig ist, sich und
20 Bauer, J.: Wie wir werden, wer wir sind. Die andere zu verändern. Stuttgart 2007.
Entstehung des menschlichen Selbst durch 41 ebd.
42 Joisten, K.: Aufbruch. Ein Weg in die
4 / 2020 Pädagogische Rundschau 361
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Philosophie. Berlin 2007. 50 Sennett, R.: Der flexible Mensch. Die Kultur
43 Dispenza, J.: Schöpfer der Wirklichkeit. Der des neuen Kapitalismus. Berlin 1998.
Mensch und sein Gehirn. 5. Auflage. Burg- 51 Arnold, R.: Entlehrt euch! Wege aus dem
rain 2016, S. 73. Vollständigkeitswahn. Bern 2017, S. 14ff.
44 vgl. Senge, P. et al.: Presence. Human Pur- 52 Sennet, R.: Der flexible Mensch. Die Kultur
pose and the Field of Future. San Francisco des neuen Kapitalismus. Berlin 1998.
2008. 53 Bayerisches Staatsministerium für Unterricht
45 vgl. Baecker, D.: Beobachter unter sich. Eine und Kultur (Hrsg.): Werte machen Stark. Pra-
Kulturtheorie. Frankfurt a.M. 2013. xishandbuch. Augsburg 2008.
46 Langemeyer, I./ Fischer, M./ Pfadenhauer, 54 Bauer, J.: Wie wir werden, wer wir sind. Die
M. (Hrsg.): Epistemic and Learning Cultures. Entstehung des menschlichen Selbst durch
Wohin sich Universitäten entwickeln. Wein- Resonanz. München 2019, S. 113ff.
heim 2015, S. 19. 55 Erpenbeck, J./ Sauter, E.: Wertungen, Werte
47 Snyder, B. (Ed.): Coping with Seven Disrup- – Das Buch der Grundlagen für Bildung und
tive Personality Types in the Classroom. Whi- Organisationsentwicklung. Wiesbaden 2018,
te-Paper. Madison 2010. (www.northwestms. S. 134 und 145.
edu/library/Library/Web/magna_wp7.pdf) 56 Astin, A.W./ Astin, H.S./ Lindholm, J.A.:
48 von Mutius, B.: Disruptive Thinking. Das Cultivating The Spirit. How College Can En-
Denken, das der Zukunft gewachsen ist. hance Student´s Inner Lives. San Francisco
Offenbach 2017. 2011, S. 1.
49 Erpenbeck, J./ Heyse, V.: Einleitung: Kompe- 57 Filipp, S.-H./ Aymanns, P.: Kritische Lebens-
tenz und Disruption. In: Ders./Ortmann, S. ereignisse und Lebenskrisen. Vom Umgang
(Hrsg.): Kompetenzen voll entfaltet. Praxisbe- mit den Schattenseiten des Lebens. Stuttgart
richte zum Kompetenzmanagement. Münster 2010.
2019, S. 33.
362 Pädagogische Rundschau 4 / 2020
Die Online-Ausgabe dieser Publikation ist Open Access verfügbar und im Rahmen der Creative Commons Lizenz CC-BY 4.0
wiederverwendbar. http://creativecommons.org/licenses/by/4.0Sie können auch lesen