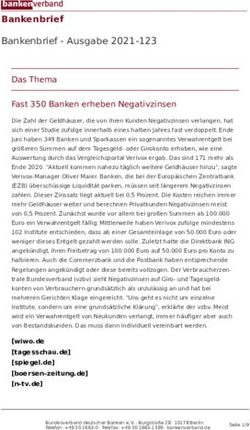Sicherer Umgang mit Batterielade-anlagen für Flurförderzeuge - SICHERHEIT KOMPAKT M plus 842
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
M·plus 842 SICHERHEIT KOMPAKT
Infos für fte
krä
Führungs
n
Das Plus a
!
Sicherheit
Sicherer Umgang mit Batterielade-
anlagen für Flurförderzeuge
Sicherheitsinformation für Führungskräfte
www.auva.atInhalt
Einleitung 4
Arten von Batterieladeanlagen und -einrichtungen 5
Typen von wiederaufladbaren Batterien 6
Sicherheitsmaßnahmen 7
Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen 7
Sicherheitsmaßnahmen für den Ladevorgang 8
Lüftungsanforderungen 9
Sicherheitsmaßnahmen für die Wartung 11
Kennzeichnung von Batterieladeanlagen 12
Allgemein 12
Instandhaltungs- und Wartungsbereiche 13
Rechtsgrundlagen und Literaturnachweis 13
Anhang: Kennzeichnungssymbole (gem. KennV bzw. ÖNORM EN ISO 7010) 14
Verbotszeichen 14
Warnzeichen 14
Gebotszeichen 15
Rettungszeichen und Hinweisschilder 17
Redaktionsschluss: 31.10.2019
3Einleitung
Flurförderzeuge werden in vielen Unternehmen ver- ströme und eventuell hohe Spannungen). Dieses
wendet. Das Laden der Antriebsbatterien birgt – auch Merkblatt erläutert grundsätzliche Maßnahmen, um
in den dafür vorgesehenen Anlagen bzw. Einrichtun- diesen Risiken vorzubeugen und damit einen sicheren
gen – einige Gefahren, z.B. Verätzungen durch Elek- Betrieb zu gewährleisten. Es wird dabei auf die auf
trolyt, Bildung einer explosionsfähigen Atmosphäre S. 5 beschriebenen Batterieladeanlagen und -ein-
oder elektrische Gefährdungen (hohe Kurzschluss- richtungen für Flurförderzeuge (Stapler, Hubwagen,
Schlepper etc.) mit Blei-Säure-Batterien sowie Nickel-
Cadmium-Batterien (NiCd), Nickeloxid-Metallhydrid-
Batterien (NiMH) und anderen alkalischen wiederauf-
ladbaren Batterien eingegangen.
Die Maßnahmen berücksichtigen nur Nennspannun-
gen bis 1.000 V Wechselspannung (AC) und 1.500 V
Gleichspannung (DC).
Sicherheitsaspekte von Lithiumbatterien werden
in diesem Merkblatt nicht behandelt.
4Arten von Batterieladeanlagen und
-einrichtungen
Batterieladestelle (Ladestelle, Batterieladestation (Ladestation)
Einzelladeplatz)
Darunter versteht man einen Raum oder Bereich, in
Hierbei handelt es sich um einen durch geeignete dem Batterien nur vorübergehend zum Laden aufge-
Anordnung und Kenntlichmachung für das Laden stellt werden und in dem gleichzeitig die Ladegeräte
von Batterien eingerichteten Platz oder Bereich in untergebracht sind.
Arbeits-, Lager- oder Betriebsräumen. Dieser Be-
reich kann auch zur Wartung der Batterien benutzt
werden.
Niederhubwagen angeschlossen an Einzelladeplatz Batterie
ladestationen
Batterieladeraum
(Laderaum)
Damit wird ein Raum in einem Gebäude bezeichnet,
in dem Batterien nur vorübergehend zum Laden auf-
gestellt werden. Die Ladegeräte sind hiervon räumlich
getrennt.
Batterieladeraum
5Typen von wiederaufladbaren Batterien
Bei wiederaufladbaren Batterien (Sekundär-Batterien)
– bestehend aus zwei oder mehr Sekundär-Zellen –
können folgende Typen unterschieden werden:
Geschlossene Batterie
Darunter wird eine Sekundär-Batterie verstanden, die
aus Sekundär-Zellen aufgebaut ist und deren Deckel
mit einer Öffnung versehen ist, durch die Gase aus
den Zellen entweichen können.
Verschlossene Bleibatterie (VRLA – valve regula-
ted lead acid)
Damit wird eine Sekundär-Batterie bezeichnet, die
aus verschlossenen Sekundär-Zellen aufgebaut ist.
Jede Sekundär-Zelle besitzt ein Ventil, das den Aus-
tritt von Gas erlaubt, wenn der Innendruck einen vor- Geschlossene Batterie
bestimmten Grenzwert überschreitet. Das Nachfüllen
von Elektrolyt ist in der Regel nicht möglich.
Gasdichte Batterie
Diese besteht aus Sekundär-Zellen, die verschlossen
bleiben und weder Gase noch Flüssigkeiten freige-
ben, solange sie innerhalb der vom Hersteller vorge-
gebenen Lade- und Temperaturgrenzwerte betrieben
werden. Auch hier sind üblicherweise Sicherheitsein-
richtungen vorhanden, um einen gefährlich hohen
Innendruck zu verhindern. Das Nachfüllen von Elekt-
rolyt ist in der Regel nicht möglich.
Um die Betriebssicherheit von Antriebsbatterien
Verschlossene Batterie sicherzustellen, sind für alle Typen regelmäßige
Inspektionen nach den Anweisungen des Herstellers
erforderlich.
6Sicherheitsmaßnahmen
Grundlegende Sicherheitsmaßnahmen
Ladestellen sind von anderen Betriebsbereichen Geeignete tragbare Feuerlöscher (z. B. Glutbrand-
durch eine dauerhafte Sicherheitskennzeichnung pulverlöscher (ABC-Pulver) oder Schaumlöscher)
(Markierung) optisch abzugrenzen. sind griffbereit und in ausreichender Anzahl zur
Eine Betriebsanweisung ist zu erstellen und gut Verfügung zu stellen.
sichtbar zugänglich zu machen. Diese soll in leicht Vorsorgemaßnahmen für Notfälle (Erste Hilfe, Not-
verständlicher Form Sicherheitsempfehlungen und fallmaßnahmen etc.) sind zu treffen. Dazu zählen
Anleitungen für die Installation, den Betrieb und die unter anderem
Wartung beinhalten. die Zurverfügungstellung geeigneter Ausrüstung
Für das Laden, Arbeiten und die Wartung ist ein Ab- an der Arbeitsstelle bzw. in unmittelbarer Nähe
stand von mindestens 0,8 m für den freien Zugang (siehe Abschnitt „Sicherheitsmaßnahmen für die
zu den Batterien vorzusehen. Wartung“) und
das Erstellen entsprechender Anleitungen zur
Schutz vor Verätzung, Brand und Ersten Hilfe für die betroffenen Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer.
Explosion
Elektroschutz
Der Fußboden muss säurebeständig sein und darf
einen elektrischen Widerstand gegen Erde (Ableit- Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regel-
widerstand) von maximal 100 MΩ (108 Ω) aufwei- mäßig und wiederkehrend zu prüfen. Die Intervalle
sen. sind durch die Elektroschutzverordnung (ESV 2012)
Batterieladebereiche sollen ausreichend wider- bzw. durch behördliche und gewerberechtliche Auf-
standsfähig gegen auslaufendes Elektrolyt sein. Bei lagen oder auch durch den Hersteller vorgegeben.
der Ladung von einzelnen Batterien sollten geeigne- Antriebsbatterien in Fahrzeugen erfordern aus
te Batterietröge bzw. -wannen verwendet werden, Schutz vor Kurzschlüssen immer Schutzmaßnah-
die nach einem Elektrolytaustritt auch leicht gerei- men gegen direktes Berühren (Abdeckung, Isolie-
nigt werden können. rung, Abstand) und bei Spannungen über DC 60 V
Batterieladebereiche müssen ausreichend Abstand zusätzlich die Anbringung eines Warnzeichens, das
(auch nach oben hin) zu brennbaren bzw. explosi- auf gefährliche Spannung hinweist.
ven Stoffen und zu explosionsgefährdeten Berei- Bei Antriebsbatterien mit Nennspannungen über
chen aufweisen. Es sind jedenfalls die Herstellervor- DC 120 V sind noch zusätzliche Maßnahmen
gaben, behördliche Auflagen und möglicherweise gegen indirektes Berühren (Potenzialausgleich,
auch Auflagen von Versicherern zu beachten. automatische Abschaltung) notwendig. Ein der-
Ladegeräte sind immer auf nicht brennbarem artiger Batterieraum in einem Fahrzeug gilt als
Untergrund (Beton, Blechplatte, Steinplatte etc.) ab- abgeschlossene elektrische Betriebsstätte, die ver-
zustellen oder an eine Wand aus nicht brennbaren sperrbar sein muss und nur für unterwiesenes und
Baustoffen zu hängen. Keinesfalls dürfen diese auf autorisiertes Personal zugänglich sein darf.
Holzpaletten oder in Regale gestellt werden.
Es dürfen im Nahbereich (0,5 m Luftstrecke) von Persönliche Schutzausrüstung
Batterien bzw. Gasaustrittsöffnungen von Batterie-
behältern und -gehäusen keine offenen Flammen, Bei Arbeiten an Batterien müssen ableitfähige bzw.
statische Elektrizität (Elektrostatik), Funken, Licht- antistatische Sicherheitsschuhe sowie ableitfähige
bögen, glühende Körper oder andere Zündquellen Schutzkleidung getragen werden. Der Kontakt zum
vorhanden sein. Die maximale Oberflächentempe- Fußboden darf dabei nicht durch Farb- und Klebstoff-
ratur von 300 °C bei heißen Gegenständen (Lötkol- reste oder andere Verschmutzungen beeinträchtigt
ben, Beleuchtungskörper, diverse Heizgeräte etc.) ist sein. Zusätzlich sind ein Augenschutz und Schutzhand-
zu beachten. schuhe zu benutzen.
Auf eine ausreichende Be- und Entlüftung ist zu
achten (siehe Lüftungsanforderungen).
7Sicherheitsmaßnahmen für den Ladevorgang
Während des Ladens werden bei allen Sekundärzellen Darüber hinaus sind folgende Sicherheitsmaßnahmen
und -batterien, die wässrigen Elektrolyt enthalten, die beim Ladevorgang zu beachten:
Gase Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) freigesetzt.
Wasserstoff und Sauerstoff entstehen durch die Elek- Die Gebrauchsanweisungen, Bedienungsanleitun-
trolyse des Wassers vorwiegend bei der Überladung gen und Herstellervorschriften für Batterien und
der Zellen. Das Gemisch ist auch als Knallgas be- Ladegeräte sind dem Personal in geeigneter Weise
kannt. Eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre zur Kenntnis zu bringen sowie leicht verfügbar zu
entsteht, sobald der Volumenanteil des Wasserstoffs machen.
in der Umgebungsluft 4 % – also die untere Explo- Die Umgebungstemperatur soll während des Lade-
sionsgrenze (UEG) – überschreitet. vorganges möglichst um 25 °C betragen.
Temperaturen unter 0 °C führen zu einer we-
Eine Ermittlung und Beurteilung der Explosionsgefah- sentlichen Reduktion der Nennkapazität von
ren durch die mögliche Bildung einer explosionsfähi- Bleibatterien und bergen die Gefahr des Einfrie-
gen Atmosphäre ist gesetzlich vorgeschrieben. Auf rens des Elektrolyts.
Grundlage dieser sog. Evaluierung ist ein Explosions- Temperaturen über 25 °C führen zur Reduktion
schutzdokument zu erstellen. der Lebensdauer der Batterie.
Wenn entfernbare Abdeckungen für eine Batterie
Um ein Überladen und die damit einhergehende vorgesehen sind, dann sind diese vor Beginn der
übermäßige Gasbildung oder eine Beschädigung Ladung zu entfernen. Bei vorhandenen Lüftungs-
sowohl von Batterie als auch Ladegerät zu vermeiden, öffnungen ist unbedingt darauf zu achten, dass
müssen die Bemessungswerte und die Kennlinien diese wie vorgesehen offen und nicht durch
(Ladeverfahren) des Ladegerätes sowohl dem Batte- Gegenstände abgedeckt sind.
rietyp als auch den Vorgaben des Batterieherstellers Die Batterien sind gemäß der Bedienungsanleitung
entsprechen. Es empfiehlt sich, elektronisch geregelte an das Ladegerät anzuschließen.
Ladegeräte einzusetzen. Solche Ladegeräte schalten Kabel- und Steckverbindungen sind vor jedem
bei erreichter Vollladung der Batterie automatisch auf Ladevorgang auf sichtbare Schäden zu prüfen.
eine gasungsarme Erhaltungsladung um. Bei ver- Es ist sicherzustellen, dass der Schlüsselschalter
schlossenen Bleibatterien (VRLA) besteht bei ungere- oder das Ladegerät ausgeschaltet ist, bevor der
gelten Ladegeräten die Gefahr der Explosion durch Batteriestecker bzw. die Batterieklemmen getrennt
thermisches Durchgehen. Im Zweifel ist jedenfalls der oder angeschlossen werden (Gefahr des Lichtbo-
Batteriehersteller und/oder der Ladegerätehersteller gens).
zu kontaktieren. Anschlussklemmen bzw. -stecker müssen kurz-
schlusssicher sein.
Nach dem Abschalten des Ladegerätes lässt der
mögliche Austritt von Gasen erst nach ca. einer
Stunde merklich nach. Eine ausreichende Wartezeit
ist also vor der weiteren Handhabung einzuhalten.
Batterien immer frühzeitig laden und nicht im ent-
ladenen oder teilentladenen Zustand abstellen. Eine
sogenannte Tiefenentladung (weniger als 20 % der
Nennkapazität) ist unbedingt zu vermeiden.
Ladegerät mit kurzschlusssicheren Anschlussklemmen
8Lüftungsanforderungen
Durch Lüftungsmaßnahmen (natürliche oder mecha- UEG (entspricht 4 Vol.-% Wasserstoffanteil in der
nische Lüftung) ist sicherzustellen, dass im Nahbe- Umgebungsluft) nicht erreicht werden. Die Abluft ist
reich der Batterie (0,5 m) bzw. um andere Gasaus- nach außen ins Freie abzuführen.
trittsöffnungen 50 % der unteren Explosionsgrenze
Berechnung des erforderlichen Luftvolumenstroms Q
Vorzugsweise ist der erforderliche Luftvolumenstrom rechnen. Aufgrund eines eingerechneten Sicherheits-
Q durch natürliche Lüftung sicherzustellen. Dieser faktors kann die Formel allerdings bis zur maximalen
Luftvolumenstrom Q lässt sich für eine Umgebungs- Betriebstemperatur der Batterie angewandt werden.
temperatur von 25 °C mittels folgender Formel be-
Q = 0,055 × n × Igas [m3/h]
Q ... Mindestluftvolumenstrom n ... Anzahl der Zellen
(inkl. Sicherheitsfaktor 5) in m3/h Igas ... gaserzeugender, elektrischer Ladestrom in A
Je nach Art des Ladegeräts (geregelt oder ungeregelt) ergibt sich der Ladestromwert Igas wie folgt:
Geregelte Ladegeräte Ungeregelte Ladegeräte
Bei geregelten Ladegeräten ist dies der Lade- Bei ungeregelten Ladegeräten und im Zweifel ist
stromwert (auch Ladeendstrom oder Ladeschluss- Igas = 0,4 × In, wobei In der Bemessungsausgangs-
strom genannt) im letzten Ladeabschnitt bzw. der strom des Ladegerätes laut Typenschild ist.
Ladestromwert gemäß den Angaben des Ladege-
Berechnungsbeispiel für eine 48 V Blei-Säure-
räteherstellers.
Antriebsbatterie mit 24 Zellen
Berechnungsbeispiel für eine 48 V Blei-Säure- Ein Ladeendstrom eines Ladegerätes mit den
Antriebsbatterie mit 24 Zellen Ladekennwerten 48 V/100 A entspricht einem
Ein Ladeendstrom von max. 30 A entspricht Igas von 40 A
einem Igas von 30 A ergibt bei 25 °C einen Luftvolumenstrom von
ergibt bei 25 °C einen Luftvolumenstrom von Q = 0,055 × 24 × 40 = 52,8 [m3/h]
Q = 0,055 × 24 × 30 = 39,6 [m3/h]
Berechnung des notwendigen freien Volumens
Von ausreichender natürlicher Lüftung ist jedenfalls V = 2,5 × Q [m3] in der Regel keine Zwangsbelüftung
auszugehen, wenn sich eine Batterieladeanlage für ein erforderlich (Voraussetzung ist eine mittlere Luftge-
Flurförderzeug im Freien oder in einem großen Raum schwindigkeit von 1 m/s). Bei mehreren Ladestellen in
bzw. einer großen Halle befindet. Auch ist in natürlich einem Raum ist die Summe aller einzelnen Luftvolu-
belüfteten Laderäumen oder an einer bzw. mehreren menströme Q für die Berechnung des notwendigen
Ladestellen mit einem freien Volumen von mindestens freien Volumens heranzuziehen.
V = 2,5 × Q [m3]
Q ... erforderlicher Luftvolumenstrom in m3/h V ... freies Volumen eines natürlich belüfteten
Laderaums in m3
9Berechnung der Öffnungsquerschnitte für zusätzliche Zuluft- und
Abluftöffnungen
Sind bei natürlicher Lüftung zusätzliche Zuluft- und querschnitte gemäß der untenstehenden Formel zu
Abluftöffnungen notwendig, so sind die Öffnungs- berechnen.
A = 28 × Q [cm2]
Q ... erforderlicher Luftvolumenstrom in m3/h A ... freier Öffnungsquerschnitt der Zuluft- und
Abluftöffnungen in cm2
Zu beachten ist: Im Zweifel bzw. bei unzureichender Belüftung ist
Die Zuluft- und Abluftöffnungen müssen an mög- eine Zwangsbelüftung mit geeigneten Zu- und
lichst günstiger Stelle für den Luftaustausch an- Abluftöffnungen oder eine mechanische Lüftung
gebracht werden, d. h. mit Öffnungen an gegen- einzusetzen. Bei mechanischen Lüftungs- und Ab-
überliegenden Wänden, in einem Mindestabstand sauganlagen sind die gesetzlichen Prüfpflichten zu
von 2 m, wenn die Öffnungen an derselben Wand beachten.
liegen.
Belüftung von Einbauräumen und Batteriebehältern
Um ein Entweichen von Gasen aus Einbauräumen Beginn des Ladevorgangs auch Abdeckungen zu
und Batteriebehältern in Fahrzeugen sowie aus mobi- entfernen.
len Ladestationen und Ladecontainern gewährleisten
zu können, müssen ausreichend große Lüftungs- Alle Lüftungsöffnungen müssen zusammengenommen
öffnungen vorgesehen werden. Eventuell sind vor mindestens folgende Querschnittsfläche aufweisen:
A = 0,005 × n × C5 [cm2]
A ... Querschnittsfläche aller erforderlichen n ... Anzahl der Zellen in der Batterie
Lüftungsöffnungen in cm2 C5 ... fünfstündige Kapazität der Batterie in Ah
10Sicherheitsmaßnahmen für die Wartung
Beim Befüllvorgang ist neben der Explosionsgefahr Die Wartungsrichtlinien und Vorgaben der Herstel-
durch Wasserstoff (H2) auch auf die Gefahr von Ver- ler sind unbedingt einzuhalten.
ätzungen durch Batteriesäure zu achten. Es ist nur isoliertes Werkzeug zu benutzen.
Auf den Batterien müssen Pol- und Verbinderabde-
Der Elektrolyt in Bleibatterien ist eine wässrige Lösung ckungen vorhanden sein, damit keine spannungs-
von Schwefelsäure und in Nickel-Cadmium- und führenden Teile berührbar sind.
Nickeloxid-Metallhydrid-Batterien eine wässrige Bei Batterieanlagen mit Nennspannungen über
Lösung von Kaliumhydroxid (Kalilauge). Unmittelbar DC 120 V sind zusätzliche Maßnahmen wie das
über dem wässrigen Elektrolyt bildet sich innerhalb Benutzen von isolierender Schutzkleidung und die
der Batterie aufgrund des durch Elektrolyse gebilde- Verwendung von zusätzlichen Abdeckungen not-
ten Wasserstoffs und Sauerstoffs sowie aufgrund des wendig.
geringen Gasraumvolumens ein explosionsgefährde- Zum Nachfüllen der Zellen/Batterien ist nur destil-
ter Bereich. Durch das Öffnen der Batterie und das liertes oder entmineralisiertes Wasser zu verwen-
Nachfüllen von Wasser wird ein Gasaustausch mit den.
der Umgebungsluft ermöglicht, was zu einer explo- Das Wasser ist immer bei niedrigstem Elektrolyt-
sionsfähigen Atmosphäre über der Batterie führen stand, also bei vollgeladener Batterie, nachzufüllen.
kann. Ist zu diesem Zeitpunkt im Nahbereich von Die Tücher für die Batteriereinigung müssen aus
Batterie bzw. Gasaustrittsöffnungen eine Zündquelle saugfähigem und antistatischem Material sein
(Zündfunken, statische Elektrizität, Ausgleichströme, (z. B. Baumwolltücher) und dürfen nur mit reinem
Flammen etc.) vorhanden, kommt es zu einer Explo- Wasser angefeuchtet werden.
sion. Die Folge könnte eine spontane Freisetzung von Zur Verhinderung der elektrostatischen Aufladung
Elektrolyt in Form einer herausspritzenden Fontäne von Personen sind stets ableitfähige bzw. antistati-
sein. Gleichzeitig kann es sogar zum Bersten der sche Sicherheitsschuhe sowie ableitfähige Kleidung
Batterie kommen. zu tragen.
Zum Schutz vor Elektrolytspritzern muss folgen-
Bei der Wartung sind daher folgende Punkte zu be- de persönliche Schutzausrüstung (PSA) getragen
achten: werden:
Eine Wartungsanleitung ist jeder mit Wartungs- Schutzbrille bzw. Gesichtsschutzschild
arbeiten betrauten Person leicht zugänglich zur Schutzhandschuhe und Schürze
Verfügung zu stellen. eventuell weitere Schutzbekleidung
Notfallmaßnahmen bei Säureunfällen
Da es bei Wartungsarbeiten zu einem Bei Augenkontakt mit Elektrolyt das betroffene
ungewollten Kontakt mit dem Elektrolyt Auge sofort über eine längere Zeit mit reichlich
kommen kann, sind folgende Notfall- Wasser spülen und unverzüglich einen Arzt auf-
maßnahmen sicherzustellen: suchen.
Bei Hautkontakt mit Elektrolyt die betroffenen
Eine Augenspüleinrichtung mit Fließwasser oder Stellen mit reichlich Wasser oder neutralisierenden
Augenspülflaschen in unmittelbarer Nähe unbe- Lösungen behandeln. Wenn Reizung der Haut fort-
dingt verfügbar halten. besteht, ärztliche Hilfe beanspruchen.
Notruf-Telefonnummern anschreiben.
Für Notfälle in den Nachtstunden ist auch die
Kenntnis von einer rund um die Uhr (24 h) ge-
öffneten Augen-Notfallambulanz wichtig.
11Kennzeichnung von Batterieladeanlagen
Allgemein
Unten stehende Symbole müssen jedenfalls ange- als auch nach ÖNORM EN ISO 7010 verwendet
bracht sein. Es können dazu sowohl die Kennzeich- werden – siehe dazu auch die Gegenüberstellung der
nungen nach Kennzeichnungsverordnung (KennV) Kennzeichnungssymbole im Anhang.
Anleitung beachten Feuer, offenes Licht und Warnung vor Gefahren durch
Rauchen verboten das Aufladen von Batterien
Warnung vor ätzenden Stoffen Warnung vor explosionsfähiger Warnung vor gefährlicher
(Elektrolyt) Atmosphäre (Explosionsgefahr) elektrischer Spannung
(bei mehr als DC 60 V)
12Instandhaltungs- und Wartungsbereiche
Für den Fall, dass im Bereich der Batterieladeanlage werden. Dann muss auch eine Augendusche bzw.
auch Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten durch- eine Augenspüleinrichtung (inkl. einem Hinweisschild
geführt werden (inkl. Elektrolyt nachfüllen), muss die darauf) in unmittelbarer Nähe vorhanden sein.
Kennzeichnung wie folgt angepasst bzw. erweitert
oder
Augenschutz benutzen Gesichtsschutz benutzen Schutzhandschuhe tragen
oder
Säurefeste Schutzschürze Schutzkleidung Antistatisches Schuhwerk
benutzen tragen benutzen
Rechtsgrundlagen und Literaturnachweis
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz – ASchG (BGBl. Nr. 450/1994) i.d.g.F.
Arbeitsstättenverordnung – AStV (BGBl. II Nr. 368/1998) i.d.g.F.
Verordnung explosionsfähige Atmosphären – VEXAT (BGBl. II Nr. 309/2004) i.d.g.F
Kennzeichnungsverordnung – KennV (BGBl. II Nr. 101/1997) i.d.g.F.
Elektroschutzverordnung 2012 – ESV 2012 (BGBl. II Nr. 33/2012) i.d.g.F.
ÖVE/ÖNORM EN 62485-3:2015
Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen – Teil 3: Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge
OVE EN IEC 62485-2:2019
Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen – Teil 2: Stationäre Batterien
OVE E 8351:2016
Erste Hilfe bei Unfällen durch Elektrizität
ÖNORM EN ISO 7010:2015
Graphische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Registrierte Sicherheitszeichen
13Anhang: Kennzeichnungssymbole
(gem. KennV bzw. ÖNORM EN ISO 7010)
Verbotszeichen
KennV ÖNORM EN ISO 7010
Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten P003: Keine offene Flamme; Feuer, offene
Zündquelle und Rauchen verboten
Warnzeichen
KennV ÖNORM EN ISO 7010
Warnung vor gefährlicher W012: Warnung vor elektrischer Spannung
elektrischer Spannung (Dieses Warnzeichen ist anzubringen, wenn DC 60 V
Batteriespannung überschritten wird.)
Warnung vor ätzenden Stoffen W023: Warnung vor ätzenden Stoffen
14KennV ÖNORM EN ISO 7010
In der KennV nicht vorgesehen
W026: Warnung vor Gefahren durch das
Aufladen von Batterien
(Warnung vor Säure und explosionsfähiger Atmosphäre. Für
ausreichende Belüftung des Ladebereiches sorgen und darauf
achten, nicht mit Säure in Berührung zu kommen)
ÖNORM EN ISO 7010 nicht vorgesehen
Warnung vor explosionsfähiger
Atmosphäre
Gebotszeichen
KennV ÖNORM EN ISO 7010
In der KennV nicht vorgesehen
M002: Anleitung beachten
Augenschutz tragen M004: Augenschutz benutzen
15KennV ÖNORM EN ISO 7010
Schutzhandschuhe tragen M009: Handschutz benutzen
Schutzkleidung tragen M010: Schutzkleidung benutzen
Gesichtsschutzschild tragen M013: Gesichtsschutz benutzen
In der KennV nicht vorgesehen
M026: (säurefeste) Schutzschürze benutzen
In der KennV nicht vorgesehen
M032: (ableitfähiges bzw.) antistatisches
Schuhwerk benutzen
16Rettungszeichen und Hinweisschilder
KennV ÖNORM EN ISO 7010
In der KennV nicht vorgesehen
E011: Augenspüleinrichtung
Hinweis auf ein Feuerlöschgerät F001: Feuerlöscher
1718
19
HSP – M.plus 842 – 12/2019 – tev
Layout, Illustration: Grafik Design Hutter
Sicherer Umgang mit Batterie
ladeanlagen für Flurförderzeuge
Bitte wenden Sie sich in allen Fragen des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit bei der Arbeit an den Unfall
verhütungsdienst der für Sie zuständigen AUVA-Landesstelle:
Oberösterreich: Steiermark und Kärnten:
UVD der Landesstelle Linz UVD der Landesstelle Graz
Garnisonstraße 5, 4010 Linz Göstinger Straße 26, 8020 Graz
Telefon +43 5 93 93-32701 Telefon +43 5 93 93-33701
UVD der Außenstelle Klagenfurt am Wörthersee
Salzburg, Tirol und Vorarlberg: Waidmannsdorfer Straße 42,
UVD der Landesstelle Salzburg 9020 Klagenfurt am Wörthersee
Dr.-Franz-Rehrl-Platz 5, 5010 Salzburg Telefon +43 5 93 93-33830
Telefon +43 5 93 93-34701
UVD der Außenstelle Innsbruck Wien, Niederösterreich und Burgenland:
Ing.-Etzel-Straße 17, 6020 Innsbruck UVD der Landesstelle Wien
Telefon +43 5 93 93-34837 Webergasse 4, 1200 Wien
Telefon +43 5 93 93-31701
UVD der Außenstelle Dornbirn
Eisengasse 12, 6850 Dornbirn UVD der Außenstelle St. Pölten
Telefon +43 5 93 93-34932 Kremser Landstraße 8, 3100 St. Pölten
Telefon +43 5 93 93-31828
UVD der Außenstelle Oberwart
Hauptplatz 11, 7400 Oberwart
Telefon +43 5 93 93-31901
Infos für fte
krä
Führungs
n
Das Plus a
!
Sicherheit
Das barrierefreie PDF dieses Dokuments gemäß PDF/UA-Standard ist unter www.auva.at/publikationen abrufbar.
Medieninhaber und Hersteller: Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, Adalbert-Stifter-Straße 65, 1200 Wien
Verlags- und Herstellungsort: Wien
www.auva.atSie können auch lesen