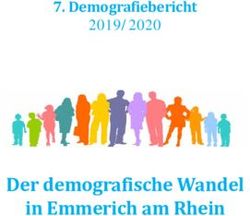Sicheres und gesundes Arbeiten - in öffentlichen Apotheken - E 27 EVALUIERUNG - AUVA
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhalt
Information 4
1. Einleitung 4
1.1 Durchführung und Dokumentation der Arbeitsplatzevaluierung 4
1.2 Die rechtliche Basis 5
2. Alleinarbeit (z. B. Nachtarbeit, Reinigung) 6
3. Alter(n)sgerechtes Arbeiten 6
4. Arbeitsräume, Sicherung der Flucht 7
5. Arbeitsbedingte psychische Belastungen 9
6. Arbeitsmittel 10
7. Arbeitsmittel: Prüfpflichten 14
8. Belästigung, Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz 16
9. Belastungen des Bewegungs- und Stützapparates 16
10. Besonders schutzbedürftige Personen 17
11. Brandschutz 19
12. Elektrische Gefahren 20
13. Elektromagnetische Felder 21
14. Erste Hilfe 22
15. Explosionsschutz 22
16. Gefährliche Arbeitsstoffe 24
17. Gender und Diversity 26
18. Information und Unterweisung 26
19. Persönliche Schutzausrüstung 27
20. Sturz-, Fall- und Stoßgefahren 28
Dokumentation 30
21. Dokumentationsstruktur 30
1. Abschnitt: Führen und Organisieren 31
2. Abschnitt: Rechtsgrundlagen 31
3. Abschnitt: Berichte, Beratungen 31
4. Abschnitt: Evaluierung 31
5. Abschnitt: Unterweisung und Information 31
6. Abschnitt: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten 31
7. Abschnitt: Gesundheitsschutz und -förderung 31
8. Abschnitt: Prüfung und Messungen 31
9. Abschnitt: Bescheide 31
10. Abschnitt: Sonstige 31
22. Musterdokumente 31
Mustervorlage Zuständige Personen 32
Mustervorlage Unterweisung 33
Mustervorlage Verzeichnis der prüfpflichtigen Arbeitsmittel 34
23. Abkürzungsverzeichnis 35
3Information
1. Einleitung
Dieser Leitfaden informiert zu Themen des Arbeit- Spezielle Themen von ärztlichen Hausapotheken wie
nehmerInnenschutzes in öffentlichen Apotheken und auch von Anstaltsapotheken wurden im Rahmen
unterstützt die Apothekenleitung bei der Erstellung dieses Leitfadens nicht berücksichtigt. Des Weiteren
von Arbeitsplatzevaluierung und Unterweisung. ist das Verblistern von Arzneimitteln und die Zuberei-
tung bzw. das Gebrauchsfertigmachen von Zytostati-
Neben der Verpflichtung ka nicht Gegenstand dieser Publikation.
zur Arbeitsplatzevaluierung
müssen Arbeitgebende Öffentliche Apotheken sind nach dem Apothekenge-
gemäß Arbeitnehmer setz (ApoG) und der Apothekenbetriebsordnung (ABO
Innenschutzgesetz (ASchG) 2005) unter der Berücksichtigung des ASchG geneh-
Präventivfachkräfte (PFK) migungspflichtig. In den daraus resultierenden Be-
bestellen. Für Apotheken mit scheiden werden Auflagen festgehalten, welche in den
einer Belegschaft bis zu 50 Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumenten (Abk.
Personen bietet AUVAsicher SiGe-Dokumente) zu berücksichtigen sind. Im Bescheid
die Beratung kostenlos an können Ausnahmebewilligungen wie etwa zu Raum-
(www.auva.at/auvasicher). höhe, Belichtung oder Denkmalschutz erteilt werden.
1.1 Durchführung und Dokumentation der Arbeitsplatzevaluierung
Die Arbeitsplatzevaluierung soll Arbeitgebenden STOP steht für:
dabei helfen, auf systematische und organisierte
Weise die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ihrer
Beschäftigten kontinuierlich zu verbessern. Dabei sind
die Grundsätze der Gefahrenverhütung anzuwenden,
S ubstitution – Ersatz von gefährlichen Stof-
fen, Materialien, Maschinen oder Verfahren
insbesondere:
die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte
die Gestaltung und der Einsatz von Arbeitsmitteln
T echnik – Einsatz von technischen Maßnah-
men, zur Gefahrenreduktion (z. B. Schutz-
einrichtung, Absaugung)
die Verwendung von Arbeitsstoffen
die Gestaltung der Arbeitsplätze
die Gestaltung der Arbeitsverfahren und -vorgänge
und deren Zusammenwirken
O rganisation – Anwendung von organisa-
torischen Maßnahmen, die Gefährdungen
vermeiden oder verringern (z. B. Aufenthalts-
die Gestaltung der Arbeitsaufgaben dauer reduzieren, Zutritt für beschränkten
die Art der Tätigkeiten, der Arbeitsumgebung, der Personenkreis)
Arbeitsabläufe sowie der Arbeitsorganisation
der Stand der Ausbildung und Unterweisung der
Arbeitnehmenden P erson – ergänzende, personenbezogene
Maßnahmen (z. B. persönliche Schutzaus-
rüstung (PSA), Anweisungen zum richtigen
Auf Basis der Ermittlung und Beurteilung der Gefah- Verhalten)
ren werden Maßnahmen zur Gefahrenverhütung fest-
gelegt. Diese sind nach der Abfolge des STOP-Prinzips Die Durchführung und Dokumentation der
umzusetzen – eine Reihenfolge von Maßnahmen, Arbeitsplatzevaluierung sowie die Umsetzung
die bei der Auswahl und Umsetzung von Schutzvor- der Maßnahmen obliegt in jedem Fall den
kehrungen zur Vermeidung von Arbeitsunfällen und Arbeitgebenden.
Berufskrankheiten anzuwenden sind.
41.2 Die rechtliche Basis
Arbeitgebenden obliegt eine Fürsorgepflicht gegen- Meldepflichten an die AUVA:
über ihrer Belegschaft. Neben der Entgeltleistung Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten; tödliche und
ist auch die Sicherheit am Arbeitsplatz maßgeblich. schwere sofort, andere, über drei Tage hinausge-
Die wichtigste rechtliche Grundlage dazu ist das hende Krankenstände innerhalb von fünf Tagen
ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG). Hierin sind (ASVG)
sowohl die Pflichten von Arbeitgebenden als auch Verzeichnis der Arbeitnehmenden, die bestimmten
von Arbeitnehmenden festgeschrieben. gefährlichen Stoffen, z. B. CMR-Stoffen, ausgesetzt
sind; zu senden nach Ende der Exposition
Für das Apothekenpersonal gelten zudem der
“Kollektivvertrag für pharmazeutische Fachkräfte Meldepflichten an weitere Behörden:
in öffentlichen Apotheken und Anstaltsapotheken bei Verlust oder irrtümlicher Abgabe von Giften
Österreichs“ und der “Kollektivvertrag für Pharma- unverzügliche Meldung an die Bezirksverwaltungs-
zeutisch-kaufmännische Assistenten und Apotheken- behörde oder die Landespolizeidirektion im Gebiet
hilfspersonal“. einer Gemeinde, für das die Landespolizeidirektion
zugleich Sicherheitsbehörde erster Instanz ist
Für die Beschäftigten ist die öffentliche Apotheke (ChemG 1996)
eine „Arbeitsstätte“. Es gilt daher die Arbeitsstätten-
verordnung (AStV). Diese ist bereits bei der Planung Aufzeichnungspflichten:
der Apotheke zu berücksichtigen. Aber auch die Arbeitszeit und Ruhezeit inklusive schriftlicher
Grenzwerteverordnung (GKV) und die Verordnung Regelung von Pausenzeiten (AZG, ARG, KJBG)
biologische Arbeitsstoffe (VbA) können bauliche Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumente
Maßnahmen erforderlich machen. (MSchG, KJBG, KJBG-VO)
Unterweisung bzw. Information der Belegschaft
Melde- und Aufzeichnungspflichten1 (MSchG, KJBG, Giftverordnung 2000)
Aufzeichnungen und Berichte über Arbeitsunfälle
Melde- und Aufzeichnungspflichten dienen zum der letzten fünf Jahre
Nachweis, dass Beschäftigte über mögliche Gefahren Personen, die für die Erste Hilfe zuständig sind
informiert wurden sowie zur allfälligen Information Alarmeinrichtungen sowie Alarmübungen
der Behörden. Im Folgenden sind die für Apotheken Wartung von Arbeitsmitteln
relevanten Melde- und Aufzeichnungspflichten sowie Verzeichnis der Arbeitnehmenden im Umgang mit
Kennzeichnungspflichten angegeben. bestimmten Arbeitsstoffen wie z. B. CMR-Stoffe
Verzeichnis der beschäftigten Jugendlichen (KJBG)
Meldepflichten an das Arbeitsinspektorat: Eignungs- und Folgeuntersuchungen (KJBG, ASVG)
Name/-en der Sicherheitsvertrauensperson/-en Verzeichnis der verwendeten gefährlichen Arbeits-
Erstmalig beabsichtigte Verwendung bestimmter, stoffe (ABO 2005)
besonders gefährlicher Arbeitsstoffe wie eindeutig Aufzeichnungen über Giftstoffe bis mindestens
krebserzeugende, erbgutverändernde, fortpflan- sieben Jahre nach Verwendungsende (ChemG
zungsgefährdende (CMR-) Arbeitsstoffe oder 1996, Giftverordnung 2000)
biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppen 2, 3 Bezug und Abgabe von Suchtgiften und psychotro-
oder 4 pen Stoffen in Apotheken samt Vormerkbuch (SV, PV)
tödliche und schwere Unfälle; sofortige Meldung, Verzeichnis prüfpflichtiger Arbeitsmittel
sofern nicht eine Meldung an die Polizei erfolgt ist Abfallwirtschaftskonzept ab einer 20 Personen
Schwangerschaften (MSchG) übersteigenden Belegschaftszahl (AWG2002)
Beschäftigung über die zulässigen Arbeitszeit-
Höchstgrenzen hinaus (AZG)
Beschäftigung/Bereitschaftsdienst während der
Wochenendruhe (ARG)
1 gemäß ASchG und seiner Verordnungen (bzw. anderer Rechtsgrundlagen; Abkürzungen siehe Verzeichnis
auf Seite 35)
5Zum Nachlesen
Die rechtlichen Grundlagen (national und EU), insbesondere die oben gelisteten Gesetze mit den zugehöri-
gen Verordnungen zum Betrieb von Apotheken, können in Erfahrung gebracht werden über
das österreichische Rechtsinformationssystem (www.ris.bka.gv.at),
das Amt für Veröffentlichungen der EU (eur-lex.europa.eu) sowie
die Österreichische Apothekerkammer (www.apothekerkammer.at).
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 2 „Rechtsgrundlagen“ im Dokumentationsteil.
2. Alleinarbeit (z. B. Nachtarbeit, Reinigung)
An Arbeitsplätzen mit erhöhter Unfallgefahr und an Empfohlene Maßnahmen:
abgelegenen Arbeitsplätzen dürfen Arbeitnehmende mindestens ein Kontakt am Anfang und Ende des
nur dann allein beschäftigt werden, wenn eine wirk- Arbeitseinsatzes mit der zuständigen Ansprechperson
same Überwachung – im Sinne von Sicherstellung willensabhängiges Melde- oder Alarmsystem (z. B.
rechtzeitiger Hilfeleistung bei Verletzung oder Auftritt funktionierendes Telefon, Notruftaste) im Mobili-
eines Schadens – gewährleistet ist. tätsbereich der allein arbeitenden Person
Gefahren bei Alleinarbeit in Apotheken (z. B. bei Gefährliche Arbeiten sind in der Alleinarbeit verboten
nächtlichem Bereitschaftsdienst) können sein: (z. B. Abfüllen von Lösungsmitteln, Autoklavieren,
plötzliche, akute Erkrankungen (z. B. Herzinfarkt) Arbeiten mit Giften).
Verstauchungen, Quetschungen an den Extremitä-
ten, Prellungen z. B. wegen Sturz und Fall
Einbruch und/oder Überfall
Zum Nachlesen
Alleinarbeitsplätze (Arbeitsinspektorat)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung „Apotheke
allgemein“).
3. Alter(n)sgerechtes Arbeiten
Das „n“ macht den kleinen Unterschied aus! Leistungsvermögen angepasst. Durch altersgerechte
Arbeitsgestaltung werden Veränderungen im
Altersgerechte Maßnahmen sind solche, die älteren Alter, wie z. B. die Abnahme des Sehvermögens oder
Arbeitnehmenden helfen. Denn die altersgerechte der Muskelkraft, ausgeglichen (kompensatorischer
Arbeitsgestaltung berücksichtigt die Veränderungen Ansatz).
der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit
bei älteren Personen. Durch gezielte Maßnahmen Die alternsgerechte Arbeitsgestaltung nimmt den
werden die Arbeitsanforderungen dem geänderten Zeitfaktor in den Blick und verfolgt das Ziel, die
6Arbeitsfähigkeit für die gesamte Dauer der Erwerbs- Der Ansatz der alternsgerechten Arbeitsgestaltung ist
tätigkeit zu erhalten und zu fördern. Dabei sollen vorbeugend (präventiver Ansatz).
Unter- und Überforderung sowie dauerhafte Leis-
tungseinbußen vermieden werden. Maßnahmen des Ein Betrieb braucht immer beides, alters- und alterns-
alternsgerechten Arbeitens sollen sicherstellen, dass gerechte Arbeitsgestaltung, um die Arbeitsfähigkeit
auch Ältere produktiv und innovativ bleiben können. der Beschäftigten langfristig zu erhalten.
Zum Nachlesen
Gestaltungstipps „Alternsgerechtes Arbeiten“ und “Altersgerechtes Arbeiten“ (Gesunde Arbeit)
Alternsgerechtes Arbeiten (AUVA)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Evaluierungswerkzeug „Alters-
strukturcheck“).
4. Arbeitsräume, Sicherung der Flucht
Arbeitsräume
Allgemeine Anforderungen gemäß ABO 2005 Anforderungen an Belichtung und Raumklima
gemäß AStV
Die Gesamtfläche der Betriebsräume muss mindes-
tens 120 m2 betragen, davon: Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet werden,
Offizin und Lager 60 m2 die möglichst gleichmäßig natürlich belichtet sind.
Laboratorium 15 m2
Dienstzimmer 10 m2 Für Lichteintrittsflächen gilt:
Sie müssen in Summe mindestens 10 % der
Die Betriebsräume und Einrichtungen müssen den Bodenfläche des Raumes betragen und
jeweiligen bau-, feuer- und gesundheitspolizeilichen direkt ins Freie führen.
Vorschriften sowie der AStV entsprechen.
Für das Raumklima gilt bei normaler körperlicher
Aufenthaltsräume gemäß AStV Belastung:
mindestens 50 m3 Außenluftzufuhr pro Person und
In Arbeitsbereichen, in denen mit gesundheitsgefähr- Stunde (bei mechanischer Lüftung)
denden Arbeitsstoffen umgegangen wird, gilt ein Lufttemperatur zwischen 18 °C und 24 °C
Ess-, Trink- und Rauchverbot. Arbeitgebende haben Luftgeschwindigkeit maximal 0,20 m/s (Mittelwert)
dafür zu sorgen, dass den Arbeitnehmenden für
die Einnahme von Speisen ein Raum zur Verfügung Bei Verwendung einer Klimaanlage ist eine relative Luft-
gestellt wird, in dem keine Einwirkung durch gesund- feuchtigkeit zwischen 40 % und 70 % einzuhalten.
heitsgefährdende Arbeitsstoffe vorliegt.
Anforderungen an die Beleuchtung gemäß AStV
Sind in einer Apotheke regelmäßig gleichzeitig mehr
als zwölf Arbeitnehmende anwesend, ist ein eigener Lichtschalter sind bei Ein- und Ausgängen von
Aufenthaltsraum zur Verfügung zu stellen. Ansons- Räumen leicht zugänglich anzubringen und müs-
ten kann die Einnahme von Speisen auch in Räum- sen bei Dunkelheit erkennbar sein (beleuchtet).
lichkeiten erfolgen, die eine ausreichende Größe, Leuchten, die nicht an der Decke oder in ausrei-
ausreichend große Tische und Sitzgelegenheiten mit chender Höhe angebracht sind, sind so zu schüt-
Rückenlehne aufweisen. zen, dass von diesen keine Verletzungsgefahr
ausgeht (z. B. durch Abdeckungen, Schutzgitter).
7 Auf allen nicht natürlich belichteten Fluchtwegen Anforderungen an die Belüftung gemäß AStV
und Arbeitsräumen sind Sicherheitsbeleuchtungen
mit unabhängiger Energieversorgung und selbst- Alle Räume in Arbeitsstätten sind entsprechend ihrer
ständiger Aktivierung zu installieren. Diese Anfor- Nutzungsart – natürlich oder mechanisch – ausreichend
derung ist in der Regel durch eine Fluchtwegbe- lüftbar einzurichten, erforderlichenfalls direkt ins Freie.
leuchtung oder nachleuchtende Orientierungshilfe
gegeben, außer in Bereichen, die bei Lichtausfall Als Arbeitsräume dürfen nur Räume verwendet werden,
eine besondere Gefahr darstellen (z. B. Verlet- denen ausreichend frische, von Verunreinigungen mög-
zungsgefahr durch Hindernisse, Stufen). lichst freie Luft zugeführt und aus denen verbrauchte
Luft abgeführt wird. Zugluft ist dabei zu vermeiden.
Beleuchtungsstärke
Für Lüftungsöffnungen gilt:
Für Offizin, Labor, Bürobereich (Arbeitsplätze) gilt mindestens 2 % der Bodenfläche wirksamer Lüf-
gem. ÖNORM EN 12464-1: tungsquerschnitt
Allgemeinbeleuchtung mindestens 500 Lux Querlüftung ab einer Raumtiefe von 10 m
Farbwiedergabeindex mindestens 80 %
Lichtfarbe Neutralweiß bzw. Tageslichtweiß Eine mechanische Be- und Entlüftung ist dann vorzu-
für Lagerräume gelten mindestens 300 Lux sehen, wenn die natürliche Lüftung nicht ausreicht,
insbesondere wenn
Es sind LED-Lampen mit einer Lichtfarbe von 3.700 eine ausreichende Luftqualität nicht gewährleistet
bis 4.500 K bzw. Leuchtstoffröhren mit der Nr. 840 werden kann oder
oder 940 geeignet. Für Verkehrswege sind mindes- durch natürliche Belüftung eine unzumutbare
tens 30 Lux Beleuchtungsstärke notwendig. Lärmbelastung der Arbeitnehmenden entsteht.
Leuchtmittel unterliegen einem Alterungsprozess mit Bei natürlicher Belüftung (z. B. über Fenster, Licht-
möglicher Reduktion der Leuchtstärke. Die Beleuch- kuppeln) wird in Abhängigkeit von der Anzahl der im
tungsstärke ist daher in geeigneten Zeitabständen zu Raum befindlichen Personen – auch hinsichtlich der
kontrollieren und gegebenenfalls sind dann Leucht- Infektionsprävention – mindestens alle zwei Stunden
mittel zu tauschen. eine 10 minütige „Stoß- und Querlüftung“ empfohlen.
Sicherung der Flucht
Foto: Richard Reichhart
Mindestanforderungen an Verkehrswege und Aus-
gänge gemäß AStV
Verkehrswege: Breite von mindestens 1,0 m
Durchgänge zwischen Lagerungen/Möbeln/Ma-
schinen: Breite von mindestens 0,6 m
Ausgänge: mindestens 0,8 m breit
lichte Höhe: mindestens 2 m
Rampen: Neigung höchstens 1:10
Stufenhöhe: höchstens 18 cm (einheitlich)
Handlauf bei mehr als 4 Stufen: bis 1,20 m Stie-
genbreite auf einer Seite; über 1,20 m Stiegenbrei-
te auf beiden Seiten.
Anforderungen an Fluchtwege und Notausgänge
gemäß AStV
Die Mindestbreite von Fluchtwegen für bis zu 20
Personen beträgt 1,0 m, bei bis zu 120 Personen be-
trägt diese 1,2 m. Sie müssen jederzeit ungehindert
benutzbar und dürfen nicht verstellt oder eingeengt
sein. Die Fluchtwege müssen als solche eindeutig
Abb. 1: Fluchtwegkennzeichnung erkennbar (Fluchtwegkennzeichnung) sein.
8Bei Verlassen eines Arbeitsraumes oder nach höchs- Personen beträgt die Mindestbreite des Notausgangs
tens 10 m (von jedem Punkt der Arbeitsstätte) muss 0,8 m, für höchstens 80 Personen 0,9 m und für
ein Fluchtweg erreichbar sein. Bis zum gesicherten höchstens 120 Personen 1,0 m.
Bereich oder bis ins Freie darf die gesamte Weglänge
maximal 40 m betragen. Die Beleuchtungsstärke für Fluchtwege muss laut
TRVB E 102 05 bzw. EN 1838 entlang des Flucht-
Notausgänge für mehr als 15 Personen müssen in weges mindestens 1 Lux betragen. Rettungszeichen
Fluchtrichtung jederzeit und ohne fremde Hilfsmittel müssen dabei immer erkennbar sein.
zu öffnen sein (z. B. Panikschloss). Für höchstens 40
Zum Nachlesen
Checkliste Sicherung der Flucht (AUVA)
Verkehrswege, Fluchtwege und Notausgänge (Arbeitsinspektion)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung „Apotheke
allgemein“).
5. Arbeitsbedingte psychische Belastungen
Arbeitsbedingte psychische Belastungen sind alle erfass- teln, diese hinsichtlich Gesundheits- und Sicherheits-
baren Einflüsse, die von außen auf die Arbeitnehmen- gefährdung zu beurteilen und passende betriebliche
den zukommen und diese psychisch beeinflussen. Im Maßnahmen dagegen zu treffen.
Mittelpunkt stehen die „äußeren Arbeitsbedingungen“
(z. B. Pausengestaltung, Lärm, Umgang mit menschli- Betriebe profitieren von einer erfolgreichen Evaluie-
chem Leid, Freundlichkeitsdruck, Kommunikation) und rung psychischer Belastungen, da beispielsweise die
nicht die individuellen Auswirkungen dieser auf einzelne Arbeitsorganisation und -abläufe optimiert werden
Mitarbeitende (z. B. Arbeitszufriedenheit, Motivation). und langfristig das Arbeitsklima verbessert und die
Bindung der Mitarbeitenden zum Betrieb gestärkt
Die gesetzlich vorgeschriebene Evaluierung psychi- werden können.
scher Belastung zielt darauf ab, Belastungen zu ermit-
Zum Nachlesen
Evaluierung psychischer Belastungen (AUVA)
Arbeitsplatzevaluierung psychischer Belastungen (Arbeitsinspektion)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Evaluierungsheft „EVALOG –
Evaluierung im Dialog“ und „Die Arbeits-Bewertungs-Skala – ABS Gruppe“).
96. Arbeitsmittel
Es kann grundsätzlich davon ausgegangen werden, Vor jeder Verwendung müssen Geräte durch
dass ein CE-gekennzeichnetes Gerät den sicherheits- Sichtkontrolle auf offensichtliche Mängel
technischen Anforderungen entspricht, sofern keine überprüft werden. Schadhafte Geräte (z. B.
offensichtlichen Mängel daran zu sehen sind und defekte Kabel bzw. Schutzabdeckungen) sind
diese Arbeitsmittel entsprechend den Angaben der sofort auszuscheiden!
Bedienungsanleitung des Herstellungsunternehmens
gewartet bzw. geprüft wurden. Die in der Betriebs- Die zugehörige Bedienungsanleitung des Herstel-
anleitung angeführten Restrisiken sind durch organi- lungsunternehmens ist zu beachten. Eine direkt
satorische und/oder personenbezogene Maßnahmen neben dem Arbeitsmittel angebrachte schriftliche
(z. B. durch Unterweisung) soweit wie möglich zu Betriebsanweisung mit den kurz gefassten Anweisun-
minimieren. gen oder mit bildhafter Darstellung unterstützt die
korrekte Verwendung des Arbeitsmittels.
Gefahren durch Handwerkzeuge
Das Arbeiten mit manuellen Handwerkzeugen (Mes- Bei der Verwendung von Messern ist Folgendes zu
ser, Cutter, Scheren) zählt zu den häufigsten Unfall beachten:
ursachen. Viele Unfälle passieren, weil beschädigte die richtige Handhabung von Messern üben
oder falsche Werkzeuge verwendet oder einfache (z. B. Krallengriff)
Schutzmaßnahmen missachtet werden. Messer stets vom Körper wegführen
scharfe, geschliffene Messer verwenden
Messer und Cutter sind auf ein absolutes Mindest- Messer sicher ablegen und aufbewahren
maß zu reduzieren, stattdessen sollten Sicherheits-
messer eingesetzt werden.
Foto: Rainer Gryc
Abbildung: Frederic Hutter
Abb. 2: Ungeeignete Messer Abb. 3: Sicherheitsmesser
Autoklaven und Dampfsterilisatoren
Autoklaven und Dampfsterilisatoren sind Druckgeräte Bersten bzw. Explosion des Autoklaven durch Über-
und fallen unter die Druckgeräteverordnung. Sie stel- druck oder Autoklavieren brennbarer Flüssigkeiten
len aufgrund der Temperaturen bzw. erhöhter Drücke Infektion durch Sterilisiergut, nicht sterilisiertes
Gefahrenquellen, wie im Folgenden beschrieben, dar: Material, Dampf oder Abluftfilter
Verbrühung bzw. Verbrennung an Dampf, heißen Gesundheitsschäden durch gefährliche Arbeitsstof-
Flüssigkeiten oder Gegenständen fe (z. B. Arzneimittelreste, Chemikalienrückstände)
schlagartiges Entweichen von heißem Dampf und im Sterilisiergut
Flüssigkeit beim unsachgemäßen Autoklavieren
von Flüssigkeiten (Siedeverzug)
10Bei der Bedienung muss daher unter anderem Fol- Dichtflächen und Verschlussmechanismus vor In-
gendes beachtet werden: betriebnahme auf Schäden und Verschmutzungen
Autoklaven und Dampfsterilisatoren nur von un- prüfen
terwiesenen Personen bedienen lassen, die das 18. Sterilisiergut vor dem Autoklavieren von möglicher-
Lebensjahr vollendet haben (gemäß KJBG-VO) weise gefährlichen Chemikalienresten reinigen
bei Entnahme von Sterilisiergut Hitzeschutzhand- Temperaturfühler korrekt positionieren (d. h. bei
schuhe und Gesichtsschutzschirm tragen Flüssigkeiten in einem Referenzgefäß entsprechen-
sichere Aufstellung (freistehend, Standsicherheit, der Größe und Inhaltsvolumen)
Sicherheitsventilausrichtung, keine gefährlichen beim Autoklavieren von Flüssigkeiten Autoklav erst
Arbeitsstoffe in der Umgebung lagern) öffnen, wenn Flüssigkeitstemperatur unter 20 °C
brennbare Flüssigkeiten (z. B. Ethanol) und selbst- der Siedetemperatur gesunken ist (z. B. Wasser
zersetzende Stoffe (z. B. Wasserstoffperoxid) nicht < 80 °C)
autoklavieren vor Öffnen des Verschlussmechanismus Druckfrei-
hitzeempfindliche Materialien (z. B. Polyethylen) heit des Autoklavs prüfen (Manometer)
nicht autoklavieren
Apothekenroboter (Kommissionierautomaten)
Foto: Johannes Fried
Apothekenroboter (Kommissionierautomaten) kön-
nen in Apotheken die Ein- und Auslagerung sicherer
und effizienter gestalten.
Im Unterschied zu den apothekenüblichen Medika-
mentenschubladen, in denen die Präparate alpha-
betisch gelagert werden, basieren die sogenannten
Kommissionierautomaten auf einem chaotischen
bzw. dynamischen Lagerprinzip.
Das Fehlen der Medikamentenschubladen verhindert
auch eine Verletzungsgefahr durch Stolpern und
Anstoßen. Abb. 4:
Gefahren
Die Gefahrenbereiche, in denen der Roboter gefähr- bereich
liche Bewegungen durchführt, sind durch trennende Apotheken
Schutzeinrichtungen gesichert. roboter
Foto: Johannes Fried
Beim Betrieb von Apothekenrobotern (Kommissio-
nierautomaten) ist Folgendes zu beachten:
Der Zutritt in den Gefahrenbereich darf nur durch
eigens geschultes Personal erfolgen. Bei Betreten
des Bereiches ist dieser gegen Inbetriebnahme zu
sichern. Der Schlüssel ist sicher aufzubewahren,
um unbefugte Inbetriebnahme zu verhindern.
Vor dem Einschalten der Anlage ist zu kontrol-
lieren, dass sich niemand im Gefahrenbereich
befindet.
Die Anlage darf nur bei einwandfreiem Zustand in
Betrieb genommen werden (regelmäßige Kontrolle
der Sicherheitseinrichtungen gemäß der Bedie- Abb. 5:
nungsanleitung). Bedien
Sämtliche Wartungs-, Instandsetzungs-, und Re- platz eines
paraturarbeiten sind von fachkundigen Personen Apotheken
durchzuführen. roboters
11Digestorium (Abzug), Laminar Flow und Sicherheitswerkbank
Personenschutz
Abbildung: Johannes Fried
Für den Personenschutz eignen sich Digestorien (Ab-
züge). Bei Tätigkeiten, bei denen es zu einer inhalati-
ven Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stoffen
(inklusive CMR-Inhaltsstoffe wie z. B. Progesteron
oder Estradiol) in Form von Gasen, Dämpfen oder
Schwebstoffen kommen kann, sind diese möglichst
an ihrer Austritts- oder Entstehungsstelle vollständig
zu erfassen und anschließend ohne Gefahr für Arbeit-
nehmende zu beseitigen.
Produktschutz
Laminar Flows (Werkbänke) dienen ausschließlich
dem Produktschutz, ein Personenschutz ist nicht
gegeben.
Sie eignen sich beispielsweise für die Zubereitung
von Augentropfen ohne gefährliche Inhaltsstoffe.
Personen- und Produktschutz
Für die Kombination von Personen- und Produkt
schutz eignen sich, abhängig von den verwendeten
Arbeitsstoffen, Sicherheitswerkbänke unterschiedli-
cher Ausführung.
Bei der Verwendung von Digestorium (Abzug), Abb. 6: Abzug (Digestorium), reiner Personenschutz,
Laminar Flow und Sicherheitswerkbank sind folgende Ableitung gefährlicher Dämpfe bzw. Rauche oder
Punkte zu beachten: Stäube nach außen
Die Arbeitsmittel dürfen nur von unterwiesenen
Personen bedient werden. Die Beschäftigungsver- Abbildung: Johannes Fried
bote sind für Jugendliche und werdende Mütter
abhängig von den verwendeten Arbeitsstoffen zu
berücksichtigen.
Foto: Richard Reichhart
Abb. 7: Laminar Flow (Werkbank), reiner Produktschutz,
Abb. 8: Sicherheitswerkbank Klasse 2 vertikale Ausführung
12 Die Frontscheibe ist grundsätzlich geschlossen zu Arbeitsflächen sind nach Gebrauch immer zu
halten und darf nur so weit wie unbedingt not- reinigen.
wendig geöffnet werden. Entsprechend den verwendeten Arbeitsstoffen ist
Flüssigkeiten dürfen nur in der maximal zulässigen das Arbeitsmittel zu kennzeichnen.
Menge laut Explosionsschutzdokument verwendet
Abbildung: Johannes Fried
werden.
Das Gerät (Werkbank, Sicherheitswerkbank) soll
ca. 30 min vor der Benützung eingeschalten und
eingelaufen lassen werden (bessere Filterleistung)
bzw. ist entsprechend den Angaben in der Bedie-
nungsanleitung zu betätigen.
Luftschlitze in der Arbeitsfläche sollen nicht ver-
deckt werden (z. B. Ärmel etc.). Gegebenenfalls
sind vorhandene Armstützen zu benutzen.
Es sind möglichst wenige Gegenstände in den
laminaren Luftstrom zu bringen und starke Bewe-
gungen zu vermeiden (Turbulenzen).
Wurde im Explosionsschutzdokument eine Zone Abb. 9:
Sicherheits
festgelegt, dürfen keine Zündquellen eingebracht
werkbank
werden (z. B. Waagen, Bunsenbrenner, Rührwerke). Klasse 2, hoher
Beschädigung der Schwebstofffilter (z. B. durch Produktschutz
Flammen, Pipettenstiche) sind zu vermeiden. und Personen
Prüfungs- und Servicedaten sind zu beachten. Bei schutz vor
Verdacht auf Fehlfunktion ist die oder der Geräte- biologischen
verantwortliche zu verständigen. Arbeitsstoffen
Rührwerke
Zum Betrieb von Rührwerken sind die mechanischen Auch die Stäbe zur Entnahme der Magnetrührkerne
Gefahren durch das Rührwerk (z. B. Einzugs- und müssen für die verw. Arbeitsstoffe geeignet sein.
Schnittverletzungsgefahren) an sich und durch Entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Einzug
die verwendeten Laborgefäße (z. B. Bersten durch von Körperteilen, Haaren, Kleidung, Schmuck
Unwucht, Vibrationen, zu hohe Drehzahl) zu berück- (z. B. Anbringen von Blenden, keine losen Ärmel)
sichtigen. Des Weiteren können Gefahren von den zu sind festzulegen und zu beachten.
vermengenden Substanzen ausgehen. Gegebenen- Beschädigte Gefäße dürfen nicht verwendet werden.
falls sind in Kombination eingesetzte Arbeitsmittel Mischbehälter und Rührwerk selbst sind gegen
wie etwa Heizplatten zusätzlich als Gefahrenquellen Verdrehen und Verrutschen zu sichern.
mit zu berücksichtigen. Ohne die Verwendung von Schutzbrillen darf nicht
Die Bedienung des Geräts darf nur mit entspre- mit Rührwerken gearbeitet werden (Splitter- und
chender Einschulung erfolgen. Spritzschutz).
Rührwerke, bei denen die Beschickung während Vor jeder Inbetriebnahme muss die Drehzahl auf das
des Betriebs von Hand aus erfolgen muss und Minimum eingestellt werden, um dem Herausspritzen
dadurch eine Gefährdung gegeben ist, dürfen von möglicherweise gefährlicher Arbeitsstoffe vorzubeu-
Jugendlichen nicht bedient werden. Ausnahme: gen. Die Drehzahl ist dann langsam an die zu vermen-
nach zwölf Monaten Ausbildung unter Aufsicht. genden Substanzen und verwendeten Behältnisse
Magnetrührkerne sind den verwendeten Materiali- anzupassen. Auf mögliche Unwucht ist zu achten.
en und Arbeitsstoffen entsprechend in Größe und Das Gerät darf nicht mit freiliegendem rotieren-
Rotationsgeschwindigkeit auszuwählen. dem Rührwerk betrieben werden.
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung „Apotheke
allgemein“).
137. Arbeitsmittel: Prüfpflichten
Bestimmte Geräte oder Anlagen müssen innerhalb Die folgende Tabelle enthält eine Auswahl der wich-
vorgeschriebener Zeitabstände durch eine dazu tigsten überprüfungspflichtigen Arbeitsmittel und
berechtigte Person wiederkehrend überprüft werden. erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Zusätz-
Die wiederkehrenden Prüfungen sind zu dokumen- lich sind Angaben des Herstellungsunternehmens im
tieren. Hinblick auf Wartungs- und Prüfungsintervalle mit zu
berücksichtigen.
Prüfungen nach Aufstellung
großer Instandsetzung oder
Inbetriebnahme sowie nach
wesentlichen Änderungen
Wiederkehrende Prüfung
Abnahmeprüfung vor
oder spezieller Art
Arbeitsmittel/Prüfobjekt Grundlage Prüfintervall
Allgemein
Motorkraftbetriebene Türen und Tore AM-VO §§ 7 (1) Z 11, 8
1x jährlich B A*, B
(nicht Schrankenanlage) (1) Z 9
Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige
AM-VO § 8 (1) Z 21 1x jährlich A
Brennstoffe über 30 KW Nennleistung
Kälteanlagen Kälteanlagenverordung
1x jährlich A
(über 1,5 kg Füllgewicht Kältemittel) § 22 (1)
Aufzüge auch betretbare Lastenaufzüge HBV 2009 §§ 3, 4 1x jährlich D D D
Aufzüge (ausschließlich Beförderung von
Gütern und Steuereinrichtungen außerhalb des
HBV 2009 §§ 3, 4 alle 2 Jahre D D D
Korbes und Reichweite des Fahrers befindet –
nicht betretbar)
Aufzüge (Kleingüteraufzug – nicht betretbar) HBV 2009 §§ 3, 4 alle 3 Jahre D D D
Absauganlagen (Abzug, Sicherheitswerkbank,
GKV § 32, VEXAT § 7 1x jährlich A, B A, B
Sicherheitsschrank)
Sicherheitsschrank VbF § 15 alle 6 Jahre A, B A, B
Druckluft-Kompressorkessel, jährliche
DGÜW-V A
wenn Druck x Inhalt < 3000 Eigenkontrolle
Autoklav DGÜW-V 1x jährlich A
Löschgeräte und stationäre Löschanlagen AStV §13(2); BauV §45(8) alle 2 Jahre A A
Brandmeldeanlagen AStV §13 (1) Z 4 1x jährlich A, B A, B
Klima- und Lüftungsanlagen AStV §13 (1) Z 3 1x jährlich A A
14Prüfungen nach Aufstellung
großer Instandsetzung oder
Inbetriebnahme sowie nach
wesentlichen Änderungen
Wiederkehrende Prüfung
Abnahmeprüfung vor
oder spezieller Art
Arbeitsmittel/Prüfobjekt Grundlage Prüfintervall
Elektroschutz Allgemein
Elektroinstallation und Betriebsmittel (VEXAT) VEXAT § 7 alle 3 Jahre C
Elektroinstallation ESV 2012 §9 alle 5 Jahre (oder C
ÖNORM E8101 abweichendes Intervall
laut Behördenbescheid)
Elektrische Geräte und Elektrowerkzeuge ASchG, ESV 2012, Angaben des C C
Betriebsanleitung Hersteller/Inver
(Prüfung gem. ÖNORM kehrbringers,laut
E 8701-1 und E 8701-2-2) Evaluierung
Funktion von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen ESV 2012 § 7 (3) Z 1 gem. Hersteller- E
angaben; wenn
diese nicht (mehr)
verfügbar sind,
alle 6 Monate
Blitzschutz ESV 2012 § 15, ETG § 9 alle 1 oder 3 Jahre C
Sicherheitsbeleuchtung (Betriebsdauer und AStV § 13 (1) Z 1 1x jährlich A, B A, B A, B
Gesamtüberprüfung der Anlage) ÖNORM E 8002
Sicherheitsbeleuchtungsanlagen (Sichtkontrolle) AStV § 13 (6) ÖNORM monatlich, E
E 8002 wöchentlich
Medizinprodukte (z. B. Reinigungs- und MPBV 6 Monate bis 3 A
Desinfektionsgeräte) Jahre
A Fachkundige Personen: Das sind Personen, die die erforderlichen Fachkenntnisse und Berufserfahrungen besitzen und
die Gewähr für eine gewissenhafte Durchführung bieten. Es können auch Betriebsangehörige eingesetzt werden. Fach
firmen dürfen diese Prüfungen ebenfalls durchführen.
A* Die wiederkehrenden Überprüfungen sind alle vier Jahre von Prüfberechtigten der Gruppe B durchzuführen. Die Prü-
fungen durch diese Personengruppe können entfallen, wenn die Prüfungen jährlich durch Fachfirmen durchgeführt werden.
B Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker des hierfür in Betracht kommenden Fachgebietes, insbesondere für Maschinenbau oder
Elektrotechnik; akkreditierte Prüf- und Überwachungsstellen nach dem Akkreditierungsgesetz (AkkG 2012) im Rahmen ihrer
Befugnisse; Ingenieurbüros (beratende Ingenieurinnen und Ingenieure) einschlägiger Fachrichtung im Rahmen ihrer Befugnisse.
C Elektrofachkräfte gem. ÖVE/ÖN EN 50110 (können auch Betriebsangehörige sein, die Kenntnisse durch Prüfung von
vergleichbaren Anlagen haben – muss kein Unternehmen sein).
D Inspektionsstellen gemäß § 15 Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009, BGBl. II Nr. 210/2009
E Elektrotechnisch unterwiesene Personen gem. ÖVE/ÖN EN 50110
Zum Nachlesen
Prüfung von Arbeitsmitteln (Arbeitsinspektion)
M 405 Sichere Instandhaltung elektrischer Anlagen (AUVA)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 8 „Prüfungen und Messungen“ im Dokumentationsteil.
158. Belästigung, Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz
Im Zuge der Arbeitsplatzevaluierung ist festzulegen, Arbeitsorganisation und -gestaltung wie etwa
wie Beschäftigte vor Übergriffen und Gewalt durch klare Vorgehensweise mit nicht mehr tolerier-
Kundschaft, Kollegium oder Dritte geschützt werden. barem Verhalten der Kundschaft sowie mit dem
So vielseitig die Ursachen für Belästigung und Gewalt Kollegium (z. B. Verhaltensregeln, Verweis aus
am Arbeitsplatz sein können, so unterschiedlich und der Apotheke, Notruf)
umfangreich müssen auch die Maßnahmen dagegen System zur Dokumentation von Vorfällen
sein. Beispiele für Maßnahmen, die zur Gestaltung Erstellung eines Notfallplans (z. B. für Raubüber-
eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes beitragen fälle, Ladendiebstahl)
können, sind: Ausbildung und Information, wie z. B. Dees-
Gestaltung des Arbeitsumfelds wie die Prüfung kalationstrainings, Trainings im Umgang mit
der technischen Sicherheitsmaßnahmen bei Not- Übergriffen, Ansprechen der Thematik (Infor-
ausgängen, Alarmsystemen (z. B. Notfallknopf), mation und Unterweisung), Schulung mit der
Videoüberwachung, Beleuchtung etc. Polizei etc.
Zum Nachlesen
Mobbing und Gewalt am Arbeitsplatz (Arbeitsinspektion)
Gleichbehandlung. Wichtiges aus dem Gleichbehandlungsgesetz (Arbeiterkammer)
Arbeitsklima (Arbeiterkammer)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil
(Musterevaluierung „Apotheke allgemein“).
9. B
elastungen des Bewegungs- und Stützapparates
(Steharbeitsplatz, Bildschirmarbeit, Heben und Tragen)
Lang andauerndes Stehen, Gehen oder Sitzen bzw. Zwangshaltung,
langes Arbeiten am Bildschirm sowie das Heben und Arbeiten auf beengtem Raum,
Tragen von schweren Lasten wirken sich belastend lange stehende Tätigkeit,
auf den Bewegungs- und Stützapparat und die Seh- ungeeignetes Schuhwerk,
leistung des Menschen aus. ungeeignete oder nicht ausreichende Beleuchtung
Die Höhe der Belastung wird hauptsächlich durch Lager
die Dauer einer einseitigen Tätigkeit, das zu hebende Heben/Tragen/Verschieben schwerer Gebinde,
Gewicht, die Häufigkeit, die eingenommene Körper- Arbeiten auf beengtem Raum,
haltung und die Form und Größe der Last bestimmt. nicht ergonomische Arbeitsmittel,
ungeeignetes Schuhwerk
Beispiele für Ursachen von körperlichen
Fehlbelastungen Reinigung
Reinigungsarbeiten insbesondere über Schulter
Offizin/Labor gürtel- bzw. Kopfhöhe und unter Kniehöhe
zu hohe/zu niedrige oder zu kleine Arbeitsflächen,
nicht ergonomisch positionierte Tastatur und/oder
Monitor,
16Maßnahmen zur Vermeidung körperlicher Ergofußmatten (Bodenmatten)
Fehlbelastungen, in Abstimmung mit der Tätigkeitswechsel (körperliche und geistige) mit
Arbeitsmedizin unterschiedlichen Beanspruchungsschwerpunkten
geeignete Beleuchtung (andere Leuchtmittel oder
Beispielsweise Zusatzlampen)
Verwendung von Transportwägen
ausreichend dimensionierte Ablageflächen
höhenverstellbare Arbeitsflächen und Stühle
Zum Nachlesen
Heben und Tragen (AUVA)
M 035 Bewegungsübungen für den beruflichen Alltag (AUVA)
M 026 Bildschirmarbeitsplätze (AUVA)
M 021 Ergonomie – Arbeitsplätze an den Menschen anpassen (AUVA)
M 920 Ergonomie in der Reinigung (AUVA)
M 025 Heben und Tragen (AUVA)
Manuelle Lastenhandhabung – LMM Leitmerkmalmethoden (IVSS)
Manuelle Lasthandhabung (Arbeitsinspektorat)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung „Apotheke
allgemein“).
10. Besonders schutzbedürftige Personen
Jugendliche
Jugendliche sind Personen, die das 15. Lebensjahr vollen- 3. Verwendung von Arbeitsstoffen
det haben und der allgemeinen Schulpflicht nicht mehr 4. Gestaltung der Arbeitsverfahren und der Arbeits-
unterliegen, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres. Die vorgänge und deren Zusammenwirken
Beschäftigung von Jugendlichen regelt grundsätzlich das 5. Körperkraft, Alter und Stand der Ausbildung und
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz (KJBG). der Unterweisung der Jugendlichen
Die dazugehörige Verordnung (KJBG-VO) beschränkt
oder verbietet jugendlichen Arbeitnehmenden Tätigkei- Jugendliche sind in folgenden Fällen zu unterweisen:
ten, die mit besonderen Gefahren verbunden sind. vor der Arbeitsaufnahme über die im Betrieb be-
stehenden Gefahren und die getroffenen Maßnah-
Vor Beginn der Beschäftigung und bei jeder bedeu- men sowie Einrichtungen und deren Benützung
tenden Änderung der Arbeitsbedingungen sind die vor der erstmaligen Verwendung an Maschinen
für die Sicherheit und Gesundheit der Jugendlichen vor Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen
sowie für die Sittlichkeit (Integrität und Würde) beste- vor Arbeiten an gefährlichen Arbeitsstellen
henden Gefahren zu ermitteln und die erforderlichen bei Verrichtung solcher Arbeiten über das not-
Maßnahmen zu treffen. wendige Verhalten sowie über die bestehenden
Schutzvorkehrungen und deren Handhabung
Bei der Ermittlung sind insbesondere zu berücksichtigen:
1. Einrichtung und Gestaltung der Arbeitsstätten Diese Unterweisungen sind in angemessenen Zeiträu-
und des Arbeitsplatzes men, mindestens jedoch in jährlichen Abständen, zu
2. Gestaltung, Auswahl und Einsatz von Arbeitsmitteln wiederholen.
17Arbeitszeit zu neun Stunden ausgedehnt werden, wenn da-
durch eine längere Wochenfreizeit, z. B. ein längeres
Die tägliche Arbeitszeit beträgt im Regelfall acht Wochenende, erreicht wird. Die konkreten Regelun-
Stunden, die Wochenarbeitszeit 40 Stunden. Inner- gen finden sich im entsprechenden Kollektivvertrag.
halb einer Woche kann die tägliche Arbeitszeit auf bis
Zum Nachlesen
Kinder und Jugendliche (Arbeitsinspektorat)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung nach dem
Kinder- und Jugendlichen-Beschäftigungsgesetz).
Werdende und stillende Mütter
Alle Arbeitsplätze an denen weibliche Personen Bewegungen und Körperhaltungen wie Strecken,
beschäftigt werden, müssen von den Arbeitgebenden Beugen, Bücken (z. B. bei Lagerhaltung, Reinigung,
dahingehend überprüft werden, ob Gefahren für die Verwendung von genormten Aufstiegshilfen)
werdende oder stillende Mutter bestehen, wenn sie Alleinarbeit
dort weiterarbeitet. Die Ermittlung der Gefahren und
der erforderlichen Schutzmaßnahmen ist bereits zu Ruhemöglichkeit (z. B. Dienstzimmer): Werdende
Beginn der Beschäftigung der ersten Arbeitnehmerin und stillende Mütter müssen sich unter geeigneten
durchzuführen. Bedingungen hinlegen und ausruhen können. Das
jederzeitige Verlassen des Arbeitsplatzes muss ge-
Werdende Mütter dürfen keinesfalls mit schweren währleistet sein.
körperlichen Arbeiten oder mit Arbeiten oder in Ar-
beitsverfahren beschäftigt werden, die nach der Art Arbeitszeit: Werdende und stillende Mütter dürfen
des Arbeitsvorganges oder der verwendeten Arbeits- über die gesetzlich festgelegte tägliche Normalar-
stoffe oder -geräte für ihren Organismus oder für das beitszeit hinaus nicht beschäftigt werden. Keinesfalls
werdende Kind schädlich sind. darf die tägliche Arbeitszeit neun Stunden und die
wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden übersteigen.
In der Apotheke sind folgende Faktoren zu
beachten: Verbot der Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit
Lastenhandhabung (z. B. Lagerhaltung, Auslieferung) (Bereitschaftsdienst): Werdende und stillende Müt-
Steharbeitsplatz (z. B. Offizin, Laboratorium – Zu- ter dürfen in der Zeit zwischen 20:00 Uhr und 06:00
bereitung magistraler Rezepturen) Uhr nicht beschäftigt werden.
gesundheitsgefährdende Stoffe (siehe Verzeichnis
gefährlicher Arbeitsstoffe) Die dokumentierten Schutzmaßnahmen müssen erst
biologische Arbeitsstoffe (Rücknahme von ge- im Fall einer Schwangerschaft umgesetzt werden.
brauchtem Spritzenmaterial, kapilläre Blutent-
nahmen, Harnstreifentests, Wundversorgungen,
Toilettenreinigung)
Zum Nachlesen
Mutterschutz – häufig gestellte Fragen (Arbeitsinspektorat)
18Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil (Musterevaluierung nach dem
Mutterschutzgesetz für „Reinigung“ und „Apotheke allgemein“).
Menschen mit Behinderung
Die Bestimmungen des ArbeitnehmerInnenschutzge- Die Ermittlung hat beispielweise zu berücksichtigen:
setzes gelten für Menschen mit und ohne Behinde- Erkennen von Gefahren
rung gleichermaßen. Behinderte Beschäftigte sollen Möglichkeiten zur Flucht im Gefahrenfall
entsprechend ihrer Fähigkeiten im Arbeitsprozess mögliche Betriebsstörungen, Not- und Rettungs-
eingegliedert werden. maßnahmen
Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen
Grundlage für die Beschäftigung von Menschen mit Arbeitsverfahren
Behinderung ist die Ermittlung und Beurteilung der
Gefahren und Belastungen im Betrieb mit Unterstüt- Aus der Ermittlung und Beurteilung der Gefahren
zung der arbeitsmedizinischen Betreuung (personen- kann sich ergeben, dass Menschen mit bestimmten
bezogene Evaluierung). Behinderungen auf manchen Arbeitsplätzen nicht
eingesetzt werden können.
Zum Nachlesen
Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten (Arbeitsinspektorat)
Menschen mit Behinderung (Arbeitsinspektorat)
Barrierefreiheit – Umsetzungstipps für Unternehmen (Wirtschaftskammer)
Dokumentation
Leerformulare stehen zur weiteren arbeitsmedizinischen Verwendung auf eval.at zur Verfügung.
11. Brandschutz
Gemäß ASchG ist in jedem Betrieb eine zuständige Anbringung und Kennzeichnung von Feuerlö-
Person für Brandbekämpfung und Evakuierung der schern an gut sichtbaren und leicht zugänglichen
Arbeitnehmenden zu bestellen. Stellen
Einplanung von Fluchtwegen und Notausgängen
Je nach Größe und Ausdehnung der Apotheke sowie Brandschutztüren, die besondere technische
sowie der Anzahl der anwesenden Personen (inklu- Erfordernisse erfüllen und regelmäßig auf freie
sive Kundschaft) müssen geeignete technische und Benutzbarkeit und Funktion kontrolliert werden
organisatorische Maßnahmen zur Verhinderung einer
Brandentstehung und zur Sicherung der Flucht ergrif- Mittel für die erste Löschhilfe
fen werden. Mögliche Maßnahmen können sein:
Minimierung leicht entzündlicher Materialien und Es müssen geeignete Löscheinrichtungen (oder Lösch-
Stoffe (Brandlasten) hilfen) wie Feuerlöscher, Löschwasser, Löschdecken,
Unterbringung brennbarer Flüssigkeiten in Sicher- Löschsand, Wandhydranten und sonstige trag- oder
heitsschränken bzw. Feuerkeller fahrbare Feuerlöscher in ausreichender Anzahl (ent-
Unterweisung zu Brandschutzthemen sprechend der Einrichtungen und Materialien gemäß
Kennzeichnung der Fluchtwege und Notausgänge TRVB 124) bereitstehen.
19Verhalten bei Brand und Evakuierung Erhöhter Brandschutz gemäß Arbeitsstätten
verordnung
Die Regeln zum „Verhalten im Brandfall“ müssen
gut einsehbar ausgehängt werden. Ein regelmä- Je nach Größe und Gefahrenpotenzial der Apothe-
ßiges Üben des Brand- bzw. Evakuierungsfalles ist ke kann die Behörde im Rahmen der Genehmigung
insbesondere bei größeren Apotheken mit mehreren einen Brandschutzbeauftragten per Bescheid vor-
Notausgängen sinnvoll. schreiben.
Zum Nachlesen
Aktueller Stand der „Technischen Richtlinien Vorbeugender Brandschutz“ (TRVB)
Brandschutz (Arbeitsinspektorat)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 8 „Prüfungen und Messungen“ im Dokumentationsteil
(Verzeichnis der prüfpflichtigen Arbeitsmittel).
12. Elektrische Gefahren
Foto: Karl Hammerl
Neben Stromschlägen bei Berührung spannungfüh-
render Teile sind auch Brände Folgen von defekten
elektrischen Anlagen. Deshalb sollten die nachfol-
gend beschriebenen Maßnahmen beachtet werden.
Sichtkontrolle
Diese ist vor jeder Inbetriebnahme auf offensichtliche
Mängel an den Betriebsmitteln durchzuführen. Solche Abb. 10: Beschädigte
Steckdose teilweise aus
offensichtlichen Mängel können z. B. kaputte Stecker
der Wand gerissen
oder Steckdosen, beschädigte Leitungen oder gebro-
chene Gehäuse von Elektrogeräten sein.
Foto: Karl Hammerl
Mangelhafte elektrische Anlagen(teile) oder Betriebs-
mittel dürfen nicht weiterverwendet werden. Defekte
Elektrogeräte sind sofort zu entfernen. Schadhafte
Anlagenteile sind zu kennzeichnen und vor Wieder-
Abb. 11: Defekte
verwendung zu sichern. Arbeitnehmende sind über
und nicht fachgerecht
die getroffenen Maßnahmen zu informieren. Bedie-
reparierte Stromleitung
nungsanleitungen sind zu beachten.
Foto: Richard Reichhart
Austausch bzw. Reparatur durch eine Elektro-
fachkraft
Schadhafte Anlagenteile oder Betriebsmittel sind
durch neue bzw. unbeschädigte zu ersetzen oder von
einer Fachkraft im Sinne des Elektrotechnikgesetzes Abb. 12: Fehlerstrom
(z. B. von einem konzessionierten Elektriker) reparie- schutzschalter
ren zu lassen. (FI-Schalter)
20Schonender Umgang mit Kabeln bel anzuschließen. Die zulässige Belastung (in W) ist
auf den Verlängerungsvorrichtungen eingeprägt oder
Beim Ausstecken des Gerätes niemals am Kabel aufgeklebt.
ziehen, sondern den Stecker direkt und gerade aus
der Steckdose ziehen. Verlängerungskabel dürfen nur Personenschutz
zwecks Überbrückung für vorübergehende Tätigkei-
ten eingesetzt werden. Als Dauerlösung sind sie nicht Es ist darauf zu achten, dass der FI (Fehlerstrom-
zulässig, zumal von ihnen durch oft unsachgemäße schutzschalter) bereits „personensicher“, also mit
Verlegung Stolpergefahren und möglicherweise elekt- einem Auslösestrom von 30 mA (0,03 A), ausgeführt
rische Gefahren (z. B. in Feuchtbereichen, beim Bo- ist. Ohne FI-Schutz darf heute nicht mehr gearbeitet
denwischen) ausgehen können. Niemals sind mobile werden; er schützt vor einem möglicherweise tödli-
Elektroöfen oder Klimageräte über Verlängerungska- chen Stromschlag.
Zum Nachlesen
M 420 Sicherer Umgang mit Elektrizität (AUVA)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 8 „Prüfungen und Messungen“ im Dokumentationsteil
(Verzeichnis der prüfpflichtigen Arbeitsmittel).
13. Elektromagnetische Felder
Elektromagnetische Felder (EMF) treten als gewollte Bei Büroarbeitsplätzen und büroähnlichen Arbeits-
oder ungewollte Erscheinung bei vielen Anwen- plätzen, an denen die üblichen Arten und Mengen
dungen auf. Die Intensität dieser Felder kann sehr an elektrischen Arbeitsmitteln (Computer, Monitor,
unterschiedlich ausfallen. In manchen Fällen ist sie so Drucker, Kopierer, Scanner etc.) verwendet werden,
hoch, dass ohne genaue Untersuchung eine Gesund- kann bei der Evaluierung von einer Einhaltung der
heitsgefährdung nicht generell ausgeschlossen wer- Expositionsgrenzwerte ausgegangen werden, sofern
den kann. Aus diesem Grund müssen Arbeitsstätten die Umgebung frei von starken EMF-Quellen ist.
bezüglich der Einwirkung von elektromagnetischen
Feldern auf den Menschen evaluiert werden.
Zum Nachlesen
Elektromagnetische Felder (Arbeitsinspektorat)
M 470 Elektromagnetische Felder (AUVA)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 4 „Evaluierung“ im Dokumentationsteil
(Evaluierungswerkzeug „Elektromagnetische Felder“).
2114. Erste Hilfe
Damit die Versorgung der verletzten Person im Ernstfall Es muss in weiterer Folge in Abständen von höchs-
so schnell und so reibungslos wie möglich funktionie- tens vier Jahren eine mindestens 8-stündige oder alle
ren kann, sind Arbeitgebende verpflichtet, Vorkehrun- zwei Jahre eine mindestens 4-stündige Auffrischung
gen für die Erste Hilfe zu treffen. Das bedeutet, dass absolviert werden. Dies ist in den Sicherheits- und
entsprechend der Anzahl der Beschäftigten eine ausrei- Gesundheitsschutzdokumenten nachzuweisen.
chende Anzahl an ersthelfenden und geeigneten Mit-
teln und Einrichtungen für die Erste Hilfe vorhanden Erste-Hilfe-Kasten
sein müssen. Die Aufbewahrungsstellen der für die
Erste Hilfe Mittel und Einrichtungen müssen dauerhaft Die ÖNORM Z 1020 „Verbandkästen für Arbeitsstät-
gekennzeichnet sowie gut erreichbar und sichtbar sein. ten und Baustellen“ legt Anforderungen, Inhalt und
Prüfung von Erste-Hilfe-Kästen fest. Ob mehrere klei-
Ersthelfer ne Verbandkästen an ausgewählten Stellen oder ein
großer Verbandkasten an zentraler Stelle vorteilhafter
In jedem Betrieb bis 19 Beschäftigten muss mindes- sind, bleibt dem Ergebnis der Arbeitsplatzevaluierung
tens eine Person für die Erste Hilfe bestellt werden. überlassen. Als Richtwerte gelten:
Wie viele Personen für die Erste Hilfe bestellt wer- Typ 1 für Bereiche bis fünf Beschäftigte
den müssen, hängt von der Anzahl der regelmäßig Typ 2 für Bereiche bis zwanzig Beschäftigte
gleichzeitig anwesenden Beschäftigten und von den
Unfallgefahren am Arbeitsplatz ab. Bei mehr als zwanzig Beschäftigten ist die Anzahl der
Verbandkästen entsprechend den Richtwerten und
Die anerkannte Ausbildung zum Ersthelfer ist nach den sonstigen betrieblichen Gegebenheiten zu ermit-
den Ausbildungsrichtlinien des Österreichischen Ro- teln. In unmittelbarer Nähe des Erste-Hilfe-Kastens
ten Kreuzes bei Arbeitsstätten mit müssen sich eine ausführliche Anleitung zur Ersten
bis zu vier Beschäftigten eine 8-stündige und Hilfe, Vermerke mit den Namen der Ersthelfenden
ab fünf Beschäftigten eine mindestens 16-stündige. sowie die Notrufnummer der Rettung befinden.
Zum Nachlesen
Erste Hilfe (Arbeitsinspektion)
Erste-Hilfe-Poster (AUVA)
M 100 Erste Hilfe (AUVA)
Erste-Hilfe-Hand App (AUVA)
Dokumentation
Siehe SGO-Ordner Abschnitt 1 „Führen und Organisieren“ und Abschnitt 5 „Unterweisung und
Information“ im Dokumentationsteil.
15. Explosionsschutz
Arbeitgebende müssen für deren Betrieb feststellen Ersatz des Stoffes (z. B. anderes Mischungsverhältnis,
und in Explosionsschutzdokumenten schriftlich festhal- Ersatzstoff)
ten, ob explosionsfähige Atmosphären auftreten kön- Verwenden geeigneter Gebinde, die stoffbeständig,
nen. Eine fachkundige Person für den Explosionsschutz möglichst bruchfest, dicht schließend und von
ist zu benennen. Des Weiteren sind Maßnahmen geeigneter Größe sind
festzulegen, welche Gefahren durch Explosion oder Verwahren von brennbaren Flüssigkeiten nach den
Brand zuverlässig verhindern. In Apotheken werden Regeln der Technik, bevorzugt in Sicherheitsschrän-
beispielsweise folgende Maßnahmen angewandt: ken gemäß VbF bzw. in geeigneten Lagerräumen
22Sie können auch lesen