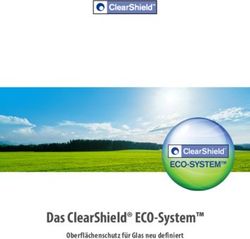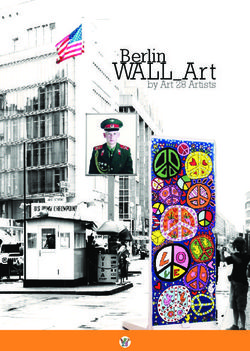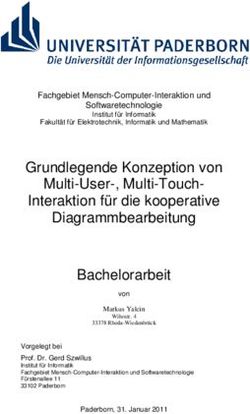SNUS - Die Problematik divergierender rechtlicher Regelungen innerhalb der EU und die zollrechtliche Abfertigung in Deutschland - Autorin: Dozent: ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SNUS – Die Problematik divergierender rechtlicher Regelungen innerhalb der EU und die zollrechtliche Abfertigung in Deutschland Autorin: Stefanie Mösenlechner Dozent: ZAR Recktenwald
2
I. Inhaltsverzeichnis
1 EINFÜHRUNG............................................................................ 4
2 WAS IST SNUS? ......................................................................... 5
2.1 PRODUKTVARIANTEN UND INHALTSSTOFFE ............................. 5
2.2 ANWENDUNG VON SNUS UND DAMIT VERBUNDENE RISIKEN ... 5
2.3 DIE VERBREITUNG VON SNUS .................................................. 6
3 GESAMTEUROPÄISCHE REGELUNG VON SNUS UND
DIE AUSNAHMESTELLUNG SCHWEDENS ...................... 7
3.1 SNUS IN EUROPA ...................................................................... 7
3.1.1 Snus als „Tabakerzeugnis zum oralen Gebrauch“
gem. Art. 2 Nr. 1, Nr. 4 RL 2001/37/EG........................ 8
3.1.2 Vertriebsverbot gem. Art. 8 RL 2001/37/EG .................. 8
3.2 SONDERSTELLUNG SCHWEDENS .............................................. 9
3.2.1 Gründe für die Sonderstellung ........................................ 9
3.2.2 Überblick über die Regelungen in Schweden ............... 10
4 SITUATION IN DEUTSCHLAND ......................................... 10
4.1 SNUS ALS TABAKERZEUGNIS GEM. § 3 VORLÄUFIGES
TABAKG ................................................................................ 11
4.2 VERTRIEBSVERBOT GEM. § 5A TABAKV ................................ 11
4.3 ZOLLRECHTLICHE BETRACHTUNG UND ABFERTIGUNG .......... 12
4.3.1 Begriffsbestimmungen zum Gesetzeswortlaut .............. 12
4.3.1.1 „Inverkehrbringen“ ................................................ 12
4.3.1.2 Unterscheidung „gewerbsmäßig“ – „privat“ ........ 13
4.3.1.3 Anwendung auf die Rechtsvorschriften
§ 5a TabakV, Art. 8 RL 2001/37/EG ...................... 13
4.3.2 Zuständigkeit der Behörden .......................................... 14
4.3.2.1 Lebensmittelüberwachungsbehörden ..................... 14
4.3.2.2 Zollbehörden........................................................... 15
4.3.3 Abfertigung im Postverkehr .......................................... 16
4.3.3.1 Allgemeine Postabfertigung ................................... 16
4.3.3.2 Bisherige Handhabung von Mengen-
begrenzungen .......................................................... 17
4.3.3.3 Vollständiges Verbot der Einfuhr von Snus............ 183
4.3.4 Abfertigung im gemeinschaftlichen
Reiseverkehr .................................................................. 19
5 FAZIT: NOTWENDIGKEIT EINER EINHEITLICHEN
REGELUNG? ........................................................................... 20
5.1 ANGRIFF AUF DAS GESCHÜTZTE RECHTSGUT
DER GESUNDHEIT ................................................................... 21
5.2 GEGENÜBERSTELLUNG VON SNUS ZU ANDEREN
TABAKWAREN ........................................................................ 21
5.3 EINSCHRÄNKUNG DES INNEREUROPÄISCHEN MARKTES? ....... 22
III. ANHANG 1 - ABBILDUNGEN ........................................... 25
IV. QUELLENVERZEICHNIS .................................................. 27
V. ABBILDUNGSVERZEICHNIS............................................. 314
1 EINFÜHRUNG
„Es gibt keine Parallele zu der Bedrohung, die der Tabak für die
Gesundheit der Bevölkerung weltweit darstellt. Der Tabak bringt
jährlich etwa 4,2 Millionen Menschen um und ist damit weltweit
die größte Einzeltodursache.“, erklärte Prof. Dr. Gro Harlem
Brundtland als damalige Generaldirektorin der
Weltgesundheitsorganisation im Jahr 2002 auf der Europäischen
Ministeriellen WHO – Konferenz: Für ein tabakfreies Europa 1.
Waren es laut Prof. Dr. Gro Harlem Brundtland im Jahre 2002
noch 4,2 Millionen Menschen, die durch Tabakkonsum jeglicher
Art umkamen, belief sich die Anzahl der Toten im Jahre 2011
schon auf 6 Millionen weltweit 2. Diese unglaublich hohen Zahlen
machen deutlich, wie enorm gesundheitsgefährdend der
regelmäßige Konsum von Tabakprodukten ist und wie sehr er
dennoch von den Menschen unterschätzt wird. Trotz ständiger
Verschärfungen im Bereich des Tabakrechts vor allem innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft, beispielsweise in Bezug auf
Warnhinweise, Werbeverbote, etc., oder auch in Deutschland, z.B.
durch das Nichtraucherschutzgesetz in Bayern, erhöhten sich die
Todesfälle um nahezu 2 Millionen Menschen. Doch wie kann das
sein?
Zwar wird der Tabakkonsum durch immer neue rechtliche
Regelungen eingeschränkt, doch sieht sich der Gesetzgeber stets
mit der Problematik fortwährender Eigendynamik des
Gesellschaftslebens konfrontiert. Es werden neue Tabakprodukte
entwickelt, getestet und, wenn möglich durch Nutzung gesetzlicher
Grauzonen, auf den Markt gebracht, wodurch die Legislative zur
Reaktion auf die jeweilige Entwicklung gezwungen wird.
Bestes Beispiel für diesen Problempunkt: nach Einführung des
Nichtraucherschutzgesetzes in Bayern im Jahre 2010, war das
Tabakrauchen in Innenräumen von Gaststätten aller Art, in
Diskotheken sowie in Festzelten nicht mehr gestattet. Daher sahen
sich viele Bayern gezwungen, sich an den Tabakkulturen anderer
Länder zu orientieren und so zukünftig auf rauchfreien Tabak, wie
z.B. den sog. Snus, auszuweichen. In Folge des Gesetzes häuften
sich daher vor allem in Südostbayern die Bestellungen vorrangig
1
Office of the Director-General, WHO-Konferenz: Für ein tabakfreies Europa.
2
http://de.statista.com/themen/150/rauchen/.5
von Snus aus Schweden, sodass ein Handeln in zollrechtlicher
Hinsicht unabdingbar war.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nun mit der Thematik
„Snus“ und wie die Vermarktung des Tabakprodukts sowohl
innerhalb der EU, als auch in Schweden geregelt wird. Das
Hauptaugenmerk soll dabei auf der zollrechtlichen Abfertigung im
Post- und im Reiseverkehr liegen. Anfangs gilt es aber zunächst zu
klären, was Snus genau ist.
2 WAS IST SNUS?
2.1 PRODUKTVARIANTEN UND INHALTSSTOFFE
Bei Snus handelt es sich um eine Tabakware mit Ursprung in
Schweden, welche vom Konsumenten zwischen Oberlippe und
Zahnfleisch gelegt wird und somit eine Art des rauchfreien Tabaks
(„smokeless tobacco“) darstellt. „Snus“ bezeichnet dabei nur die
feuchte Tabakmasse, welche aus zerriebenen Tabakblättern, denen
„Hilfsstoffe wie Wasser, Salze (Natriumchlorid,
Natriumhydrogencarbonat), Feuchthaltemittel (Glycerol,
3
Propylenglykol) und Aromastoffe“ beigesetzt werden, hergestellt
wird. Der Anteil an enthaltenem Nikotin unterscheidet sich je nach
Sorte und kann zwischen 0,23 % und 68 % liegen 4.
Diese Grundmasse ist in zwei verschiedenen Produktvarianten
erhältlich. Einerseits wird Snus als loser Tabak angeboten, welcher
vom Konsumenten mit den Händen oder mit Hilfe eines
Portionierers geformt und anschließend in den Mund eingebracht
wird. Andererseits erfolgt der Verkauf von Snus in kleinen, bereits
fertig portionierten Beutelchen. 5 (vgl. Abb. 1).
2.2 ANWENDUNG VON SNUS UND DAMIT VERBUN-
DENE RISIKEN
Snus wird in der Regel für 20 – 60 Minuten 6 zwischen Oberlippe
und Zahnfleisch gelegt, sodass die Inhaltsstoffe über die
Mundschleimhaut aufgenommen werden können (vgl. Abb. 2).
3
http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Snus.
4
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Fact
Sheet Snus.
5
http://www.lgl.bayern.de/produkte/tabak/tabakerzeugnisse/et_snus.htm.
6
http://www.oh-schweden.de/kultur-gesellschaft/snus-tabak-der-schweden/.6
Dabei erfolgt „die Aufnahme des Nikotins in den Blutkreislauf
zwar langsamer als beim Rauchen einer Zigarette, die
Nikotinkonzentration sinkt aber auch langsamer ab“, sodass „die
Konsumenten von Snus also länger einer hohen
7
Nikotinkonzentration ausgesetzt sind als Raucher“. Erleichtert
wird die Aufnahme durch die in der Tabakmasse enthaltenen Salze.
Snus wird hauptsächlich als Genussmittel und Stimulans
konsumiert. 8 Die mit dem Konsum verbundenen
Gesundheitsrisiken gleichen denen anderer Tabakprodukte, da in
jedem von ihnen große Mengen an tabakspezifischen Nitrosaminen
und abhängig machendem Nikotin enthalten sind. Dabei weisen vor
allem die Verbindungen der Nitrosamine eine stark karzinogene
Wirkung auf. Folglich kann der Konsum von Snus neben
Beschwerden wie Schwindel, Übelkeit, Mundgeruch,
Verfärbungen der Zähne oder Entzündungen des Zahnfleisches, vor
allem Krebs, beispielsweise im Mund- und Halsbereich oder an der
Bauchspeicheldrüse (Pankreaskrebs), sowie Herz-Kreislauf-
Erkrankungen hervorrufen. 9
2.3 DIE VERBREITUNG VON SNUS
Trotz der Gesundheitsschädlichkeit ist der Konsum von Snus in
den letzten Jahrzehnten vor allem in den skandinavischen Ländern
wie Norwegen, Finnland und Schweden, aber auch in den USA
stark angestiegen. Im Gegensatz dazu ist die Verbreitung von Snus
in den restlichen europäischen Ländern eher gering, nur in
Österreich, Dänemark, Irland und Großbritannien kann der
Konsum mit empirischen Daten belegt werden.
Hauptaugenmerk liegt aber stets auf Schweden, da es nicht nur auf
eine sehr lange Tradition von Snus zurückblicken kann, sondern
auch weil strenge Einschränkungen in Bezug auf das Rauchen von
Zigaretten seit Anfang der 70er Jahre im Land eine Umorientierung
hin zum rauchfreien Tabak verstärkt haben. So waren es in den
Jahren 1970 – 1980 nur zwischen 2.500 und 3.000 Tonnen Snus,
jedoch bis zu 12.000 Millionen Stück Zigaretten, die in Schweden
verbraucht wurden. Ab Ende der 1990er Jahre steigerte sich der
Snuskonsum auf knapp über 5.000 Tonnen Snus, während in ganz
Schweden nur noch durchschnittlich 6.000 Millionen Stück
7
Schweizerische Fachstelle für Alkohol- und andere Drogenprobleme, Fact
Sheet Snus.
8
http://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Snus.
9
Deutsches Krebsforschungszentrum: Rauchlose Tabakprodukte, S. 17 ff.7
Zigaretten geraucht wurden. Es ist also zu beobachten, dass sich
der Konsum von rauchfreiem Tabak bei einem Rückgang des
Zigarettenkonsums um die Hälfte geradezu verdoppelt hat (vgl.
Abb. 3).
Auffällig ist ebenso, dass in allen Ländern vor allem Kinder und
Jugendliche mit dem Konsum von Snus vertraut sind. 10
Der stetig steigende Verbrauch sowie die zunehmende Verlagerung
des Konsums auf die jüngeren Generationen erfordern daher neue
oder reformierende Regelungen im Bereich des Tabakrechts
speziell in Bezug auf den rauchfreien Tabak.
Diese wurden sowohl EU-rechtlich als auch national getroffen. Die
entscheidenden Rechtsgrundlagen sollen im Folgenden nach dem
Prinzip der Normenpyramide dargelegt werden. Dies bedeutet, dass
zunächst die gemeinschaftsrechtliche Seite beleuchtet werden soll.
3 GESAMTEUROPÄISCHE REGELUNG VON SNUS
UND AUSNAHMESTELLUNG SCHWEDENS
3.1 SNUS IN EUROPA
Gerade im Bereich des Tabakrechts gibt es einige Richtlinien, die
eine einheitliche Verfahrensweise im Verkehr sicherstellen sollen.
Erstmals ist Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
der Mitgliedstaaten bezüglich der Tabakerzeugnisse am 13.
November 1989 durch die Richtlinie 89/622/EWG erfolgt.
Thematisiert wurde darin zunächst vor allem die Kennzeichnung
bzw. Etikettierung der Verpackungen von Tabakerzeugnissen,
beispielsweise durch Anbringung von deutlich lesbaren
Warnhinweisen oder Angaben zu Teer- und Nikotingehalt.
Weiterhin wurde die Vermarktung sowie der freie Verkehr von
Tabakerzeugnissen gemeinsamen Regelungen unterworfen, um so
mögliche Handelshemmnisse innerhalb der Gemeinschaft
vorzubeugen.
Nachdem in den Folgejahren der Konsum von neuartigen
Tabakerzeugnissen zum oralen Gebrauch vor allem bei Kindern
und Jugendlichen stark angestiegen war und wissenschaftliche
Untersuchungen eine hohe Anzahl an Krebserregern in diesen
10
Deutsches Krebsforschungszentrum: Rauchlose Tabakprodukte, S. 11 ff.8
Erzeugnissen nachwiesen, wurde die RL 89/622/EWG am 15. Mai
1992 durch die Richtlinie 92/41/EWG abgeändert bzw. erweitert.
Nun wurden gem. Art. 2 IV RL 92/41/EWG „Tabakerzeugnisse
zum oralen Gebrauch“ genau definiert und ihr Verkauf angesichts
des hohen Gesundheitsrisikos in den Mitgliedstaaten gem. Art. 8a
RL 92/41/EWG untersagt.
Weitere Untersuchungen auf dem Gebiet der Krebsforschung
bezüglich des Oraltabaks sowie die immer noch unterschiedlichen
Regelungen für die Herstellung, die Aufmachung und den Verkauf
von Tabakerzeugnissen innerhalb der Gemeinschaft, waren
schlussendlich die Grundlage für den Erlass der Richtlinie
2001/37/EG am 5. Juni 2001. Mit ihr wurde gem. Art. 15 RL
2001/37/EG die RL 89/622/EWG aufgehoben. Sämtliche Verweise
auf die alte Richtlinie gelten nun der RL 2001/37/EG.
Anhand ihr kann Snus nun rechtlich als Tabakerzeugnis
eingeordnet werden.
3.1.1 Snus als „Tabakerzeugnis zum oralen Gebrauch“
gem. Art. 2 Nr. 1, Nr. 4 RL 2001/37/EG
Snus ist gem. Art. 2 Nr. 4 RL 2001/37/EG zunächst als Tabak zum
oralen Gebrauch einzuordnen. Dabei handelt es sich um zum oralen
Gebrauch bestimmte Erzeugnisse, welche ganz oder teilweise aus
Tabak bestehen, sei es in Form eines Pulvers oder feinkörnigen
Granulats oder einer Kombination dieser Formen, insbesondere in
Portionsbeuteln bzw. porösen Beuteln, oder in einer Form, die an
ein Lebensmittel erinnert, mit Ausnahme von Erzeugnissen, die
zum Rauchen oder Kauen bestimmt sind. Snus wird, wie zuvor
bereits erläutert, meist als loser Tabak oder in Portionsbeuteln
verkauft. Folglich fällt Snus grundsätzlich unter den Bereich der
sog. Tabakerzeugnisse gem. Art. 2 Nr. 1 RL 2001/37/EG, also
unter Erzeugnisse, welche zum Rauchen, Schnupfen, Lutschen
oder Kauen bestimmt sind, sofern sie ganz oder teilweise aus
Tabak bestehen, und zwar unabhängig davon, ob der Tabak
gentechnisch verändert ist oder nicht.
Hervorzuheben ist, dass es sich hier lediglich um eine Definition
handelt (vgl. Überschrift zu Art. 2 RL 2001/37/EG) und Snus daher
keinen Steuergegenstand darstellt, welcher der Tabaksteuer
unterliegt. Es werden auch keine Aussagen zu einem
Mindeststeuersatz getroffen. Diese Besonderheit gilt es vor allem
im Bereich des nationalen Rechts genauer zu beleuchten.9
3.1.2 Vertriebsverbot gem. Art. 8 RL 2001/37/EG
Des Weiteren übernimmt die neue Richtlinie das Verbot über das
Inverkehrbringen von Tabak zum oralen Gebrauch (Art. 8 RL
2001/37/EG). Somit ist der gesamte Warenverkehr mit
Tabakerzeugnissen dieser Art innerhalb der Gemeinschaft
verboten.
Allerdings wurde sowohl dem Königreich Norwegen, als auch dem
Königreich Schweden im Rahmen ihres Beitrittsvertrages eine
nationale Ausnahmeregelung gewährt. Für beide Länder gilt das
Verbot über das Inverkehrbringen des Oraltabaks nicht.
3.2 SONDERSTELLUNG SCHWEDENS
Im Folgenden soll diese Besonderheit genauer betrachtet werden,
wobei der Schwerpunkt auf der Betrachtung der Regelungen in
Schweden liegen soll, da Norwegen zwar ein EWR-Staat, jedoch
kein EU-Mitglied ist (Art. 3 I ZK).
3.2.1 Gründe für die Sonderstellung
Die Geschichte des Tabaks und vor allem des Snus in Schweden
reicht weit ins 17. und 18. Jahrhundert zurück. Damals wurde vor
allem der Schnupftabak, genannt „Snus“, in Schweden mehr und
mehr bekannt und galt besonders für den Adel als ein Zeichen von
Eleganz. Daher wurde zu dieser Zeit auch mit dem Tabakanbau in
Schweden und in den skandinavischen Ländern begonnen.
Nach der Französischen Revolution ging das „Schnupfen“ jedoch
zurück und galt als altmodisch. Vielmehr wurden nun Zigarren und
Zigaretten geraucht. Da es den schwedischen Bauern jedoch nicht
möglich war, teure Zigaretten zu kaufen oder sogar während der
Arbeit zu rauchen, begannen sie, sich kleine Portionen Snus hinter
die Oberlippe zu stecken. Seither entwickelte sich das „Snusen“ zu
einer schwedischen Tradition. 11
Unterstützt wurde der Trend durch die „progressive
Tabakkontrollpolitik“ Schwedens seit den 1950er Jahren.
Schweden zählte „zu den ersten Ländern, die sich in der
Tabakkontrolle engagierten“ und versuchte die Bevölkerung aktiv
mit Tabakentwöhnungsprogrammen oder durch massenmediale
11
http://www.buysnus.ch/history.html.10 Aufklärungsprogramme über die Gefahren des Rauchens zu informieren. 12 Angesichts dieser Maßnahmen und der langen „Snustradition“ ist der Konsum von Snus in Schweden um vieles höher als in den restlichen Mitgliedstaaten. Rund 19 % der Männer und 4 % der Frauen konsumieren täglich Snus 13. Folglich war es schwierig bis unmöglich, mit dem EU-Betritt den Verbrauch von Snus in Schweden vollständig zu unterbinden. Daher knüpfte Schweden den Beitritt unter anderem auch an die Bedingung, hier eine Ausnahmeregelung gewährt zu bekommen. 3.2.2 Überblick über die Regelungen in Schweden Die Ausnahme vom Verbot ist in der Akte über die Bedingungen des Beitritts des Königreichs Norwegen, der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden und die Anpassung der die Europäische Union begründenden Verträge im Art. 151 i.V.m. Anh. XV, unter X. Verschiedenes, Buchstabe a, niedergelegt. Dort heißt es, dass das Verbot gem. Art. 8a RL 89/622/EWR, geändert durch die RL 92/41/EWG, nicht für das Königreich Schweden und das Königreich Norwegen gilt, mit Ausnahme des Verbots, dieses Erzeugnis in einer anderen Form, die an ein Lebensmittel erinnert, in den Verkehr zu bringen. Um zu gewährleisten, dass der Warenverkehr mit Oraltabak ausschließlich in diesen beiden Ländern erfolgt, wurden Schweden und auch Norwegen dazu verpflichtet, nötige Vorkehrungen zu treffen, um eine Vermarktung der Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch in den restlichen Mitgliedstaaten, welche dem Verbot gem. Art. 8 RL 2001/37/EG unterliegen, zu unterbinden. Dies wird von der Europäischen Kommission überwacht (vgl. Anh. XV, X. b), c) der o.g. Akte). Aufgrund dieser Verpflichtung wurde in Schweden eine Verordnung erlassen, welche die Ausfuhr von Snus verbietet. Darin wird festgehalten, dass Snus nicht in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union ausgeführt werden darf und dass nur der Kauf zum persönlichen Gebrauch durch Reisende oder als Mitbringsel erlaubt ist. Bei einem Verstoß gegen diese Maßnahmen drohen Sanktionen. 14 12 Deutsches Krebsforschungszentrum: Rauchlose Tabakprodukte, S. 29. 13 KOM/2010/0399, endgültig. 14 KOM/2010/0399, endgültig.
11
4 SITUATION IN DEUTSCHLAND
Bei den vom Europäischen Parlament und Rat der Europäischen
Union erlassenen Richtlinien handelt es sich um unmittelbares
Recht, welches der Umsetzung in innerstaatliches Recht der
einzelnen Mitgliedstaaten bedarf. In Deutschland erfolgt dies im
Rahmen des Vorläufigen Tabakgesetzes und der dazugehörigen
Tabakverordnung.
4.1 SNUS ALS TABAKERZEUGNIS GEM. § 3 VORLÄU-
FIGES TABAKG
Gem. § 3 Vorläufiges TabakG handelt es sich bei
Tabakerzeugnissen um aus Rohtabak oder unter Verwendung von
Rohtabak hergestellte Erzeugnisse, die zum Rauchen (z.B.
Zigaretten), Kauen (z.B. Kautabak) oder anderweitigen oralen
Gebrauch oder zum Schnupfen bestimmt sind. Damit wurde die
Definition aus Art. 2 Nr. 1, Nr. 4 RL 2001/37/EG übernommen und
Snus stellt als „Erzeugnis zum anderweitigen oralen Gebrauch“
auch national ein Tabakerzeugnis dar. Zu beachten ist hier, dass
Snus nicht als Steuergegenstand gem. dem § 1 I, II TabStG
charakterisiert wird, welcher im Steuergebiet der Tabaksteuer
unterliegt. Dort ist nur von Zigarren, Zigarillos, Zigaretten und
Rauchtabak die Rede (§ 1 II TabStG). Vielmehr wird der Begriff
der „Tabakerzeugnisse“ gem. § 3 Vorläufiges TabakG nur
definiert, es erfolgen keine Erläuterungen zu einem Steuertarif.
4.2 VERTRIEBSVERBOT IN DEUTSCHLAND GEM.
§ 5A TABAKV
Auch das Vertriebsverbot wurde im Rahmen des § 5a TabakV
umgesetzt. Dort heißt es, dass Tabakerzeugnisse, die zum
anderweitigen oralen Gebrauch als Rauchen oder Kauen bestimmt
sind, gewerbsmäßig nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen.
Zudem besteht gem. § 47 I Vorläufiges TabakG ein
Verbringungsverbot für Tabakwaren, welche den geltenden
lebensmittelrechtlichen Bestimmungen (hier: § 5a TabakV) nicht
entsprechen. Zu beachten ist hier, dass der Begriff des
„Verbringens“ nicht mit dem zollrechtlichen Verbringungsbegriff
(DV 0601 (102)) gleichzusetzen ist. Da das Vorläufige TabakG ein
nationales Gesetz ist, umfasst der Geltungsbereich lediglich das
Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland und nicht, wie der12
zollrechtliche Begriff, das gesamte Zollgebiet der EU. Dem
Binnenmarktprinzip folgend, findet für Gemeinschaftswaren
grundsätzlich keine zollamtliche Überwachung statt. 15 Allerdings
wird gem. § 1 III ZollVG die Einhaltung von Verboten und
Beschränkungen überwacht. Dem Verbringen bzw. der Einfuhr von
Snus nach Deutschland stehen also grundsätzlich Verbote und
Beschränkungen gem. Art. 58, 73 ZK entgegen.
Den Gesetzeswortlaut der Verbotsnorm in § 5a TabakV gilt es
jedoch genauer zu betrachten und mit dem Wortlaut des Art. 8 RL
2001/37/EG zu vergleichen.
Deutschland hat das Verbot des Inverkehrbringens nur auf den
„gewerbsmäßigen“ Bereich beschränkt. Laut EU-Richtlinie ist
jedoch der gesamte Warenverkehr mit Oraltabak untersagt, es wird
nicht zwischen einem gewerblichen und einem privaten
Inverkehrbringen unterschieden. Um hier also im Rahmen der
zollrechtlichen Abfertigung, innerhalb derer ich mich im
Folgenden aufgrund des Verbots im Gewerbebereich auf den Post-
sowie auf den Reiseverkehr konzentriere, eindeutige Schlüsse
ziehen zu können, muss zunächst geklärt werden, inwiefern ein
„Inverkehrbringen“ von Oraltabak vorliegt und wann dies als
„gewerblich“ oder als „privat“ einzuordnen ist.
4.3 ZOLLRECHTLICHE BETRACHTUNG UND
ABFERTIGUNG
4.3.1 Begriffsbestimmungen zum Gesetzeswortlaut
4.3.1.1 „Inverkehrbringen“
Das „Inverkehrbringen“ von Waren findet auf verschiedenen
Rechtsgebieten Anwendung (z.B. Lebensmittel- und
Futtermittelgesetzbuch [LFGB], CE-Kennzeichnung, ...) und ist
dort auch jeweils unterschiedlich definiert. Der Grundgedanke
jedoch, dass immer ein Verantwortlicher hinter der Tathandlung
steht, welcher für alle, nicht nur rechtlich geforderten
Produkteigenschaften der Ware und deren Prüfung die
Verantwortung trägt, ist überall derselbe. 16
So spricht man in Bezug auf Tabakerzeugnisse gem. § 7
Vorläufiges TabakG dann von einem Inverkehrbringen, wenn eine
15
Bender, ZfZ, 1992, S. 199 f.
16
http://de.wikipedia.org/wiki/Inverkehrbringen.13
Ware angeboten, zum Verkauf oder zu sonstiger Abgabe vorrätig
gehalten, feilgehalten sowie auf jede andere Art und Weise an
andere abgegeben wird. Es handelt sich also um das erstmalige,
sowohl entgeltliche als auch unentgeltliche Bereitstellen eines
Produktes auf dem Markt der Europäischen Gemeinschaft.
4.3.1.2 Unterscheidung „gewerbsmäßig“ – „privat“
Diese Bereitstellung kann sowohl gewerblich, also mit
kommerziellem Charakter, aber auch privat, also zu
nichtkommerziellen Zwecken, erfolgen (vgl. Art. 1 Nr. 6 ZK-DVO,
Art. 29 II ZollbefrVO).
Charakterisierend für eine private Bereitstellung ist, dass sie „aus
einem bestimmten Anlass (gelegentlich) erfolgt, also z.B. zum
Geburtstag“ und ihrer Art und Menge nach ausschließlich zum
persönlichen Ge- oder Verbrauch durch den Empfänger oder
Reisenden und Angehörige ihres Haushalts bestimmt ist oder als
Geschenk überreicht werden soll (Art. 1 Nr. 6, 2. Anstr. ZK-DVO,
Art. 29 II, 2. Anstr. ZollbefrVO). 17
Gewerbliches Inverkehrbringen hingegen zielt auf eine gewisse
Regelmäßigkeit ab, um so eine konstante Gewinnerzielung zu
erreichen. Denn im Gegensatz zu einer privaten Bereitstellung
zeichnet sich die Gewerbsmäßigkeit dadurch aus, dass sie nur
gegen eine Gegenleistung erbracht wird, also gegen Bezahlung
(Art. 29 II, 3. Anstr. ZollbefrVO) oder einer vergleichbaren
Ersatzleistung. Somit steht hier die Gewinnerzielungsabsicht im
Vordergrund.
4.3.1.3 Anwendung auf die Rechtsvorschriften § 5a TabakV,
Art. 8 RL 2001/37/EG
Das Inverkehrbringen von Tabakerzeugnissen bezieht sich im
Postverkehr auf sämtliche Warensendungen von Snus, welche im
Rahmen des Weltpostvertrages nach Deutschland befördert
werden. Im Reiseverkehr betrifft das Inverkehrbringen jegliche
Reisemitbringsel eines Reisenden, also Snus, welcher im
persönlichen Gepäck des Reisenden von Schweden nach
Deutschland kommt.
17
Kampf, in: Lehrbuch d. Europ. Zollrechts, S. 444.14 Sowohl im Reise- als auch im Postverkehr kann einerseits davon ausgegangen werden, dass der Transport zu privaten Zwecken erfolgt, da der Ge- bzw. Verbrauch des Snus persönlich durch den Empfänger bzw. Reisenden (und dessen Haushalt) erfolgt. Somit wären beide Varianten innerhalb Deutschlands erlaubt, da sich das Verbot gem. § 5a TabakV ja nur auf den gewerblichen Bereich beschränkt. Dies ist aber vor allem im Bezug auf den Postverkehr problematisch, da dadurch Telefonbestellungen oder Online-Käufe von Snus im Grunde nicht von dem nationalen Verbot betroffen wären und das, obwohl beide Varianten andererseits als „gewerbliches Inverkehrbringen“ eingeordnet werden können, da zwischen Versender und Empfänger Geld fließt (Bezahlung). Die deutsche Regelung gem. § 5a TabakV stellt daher grundsätzlich einen Widerspruch zum Art. 8 RL 2001/37/EG dar. Eine Anpassung des Gesetzeswortlautes ist bis jetzt nicht erfolgt, wodurch die Thematik „Snus“ in Deutschland von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich behandelt wird, nicht zuletzt weil die Durchführung der Überwachung des Verkehrs von Tabakerzeugnissen in den Zuständigkeitsbereich der einzelnen Länder fällt (gem. § 40 I Vorläufiges TabakG). 4.3.2 Zuständigkeit der Behörden Bundesweit unterliegt die Überwachung von Tabakerzeugnissen dem Aufgabenbereich des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit. Dieses koordiniert die einzelnen Lebensmittelüberwachungsbehörden der Länder. 4.3.2.1 Lebensmittelüberwachungsbehörden In den einzelnen Ländern sind die Lebensmittelüberwachungsbehörden (LÜ) nämlich tragende Kraft der Kontrollen und Überprüfungen. Dies ergibt sich nicht nur aus § 40 I Vorläufiges TabakG, in welchem die Zuständigkeit für sämtliche Überwachungsmaßnahmen dem Landesrecht zugewiesen wird, sondern auch aus dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz (LMBG). Dort sind die Tabakerzeugnisse gem. § 3 I LMBG ebenfalls als Erzeugnisse, welche aus Rohtabak oder unter Verwendung von Rohtabak hergestellt wurden und zum Rauchen, Kauen, anderweitigen oralen Gebrauch oder zum Schnupfen bestimmt sind, definiert. Dies
15 bedeutet jedoch nicht, dass Tabakerzeugnisse als Lebensmittel einzuordnen sind. Vielmehr sind Tabakerzeugnisse nicht zum Verzehr geeignet, wie es die Definition von Lebensmitteln gem. § 1 LMBG aber fordert. 18 Trotzdem ist gem. § 40 I, 41 I LMBG der Verkehr mit Erzeugnissen im Sinne des LMBG, also auch von Tabakerzeugnissen, von den zuständigen Behörden zu überwachen, welche in den „landesrechtlichen Ausführungs- bzw. Vollzugsgesetzen und –verordnungen geregelt“ sind. 19 Dabei handelt es sich stets um die Lebensmittelüberwachungsbehörden der einzelnen Länder, deren Zuständigkeit einem dreistufigen Verwaltungsaufbau folgt, bestehend aus den Obersten Landesbehörden (Ministerien), den Landesmittelbehörden (Regierungen) und den Unteren Vollzugsbehörden (Ordnung- und Polizeibehörden). 2021 Unterstützt werden sie durch weitere, verschiedene Vollzugsbehörden. 4.3.2.2 Zollbehörden Als solche Vollzugsbehörde können die einzelnen Zollbehörden der Länder charakterisiert werden. Die Zolldienststellen wirken gem. § 48 I Vorläufiges TabakG, § 48 I LMBG bei der Überwachung des Verbringens oder der Durchfuhr von Tabakerzeugnissen mit (s. § 40 I S. 2 Vorläufiges TabakG, § 40 I S. 2 LMBG). Hierzu dürfen sie beispielsweise Sendungen, Beförderungsmittel, etc. beim Verbringen sowie bei der Durchfuhr von Erzeugnissen aus dem Geltungsbereich des jeweiligen Gesetzes anhalten (§ 48 I Nr. 1 Vorläufiges TabakG/LMBG), oder den Verdacht von Verstößen gegen Verbote und Beschränkungen an die zuständigen Verwaltungsbehörden (Lebensmittelüberwachungsbehörden) mitteilen (§ 48 I Nr. 2 Vorläufiges TabakG/LMBG). Somit spielen sie sowohl im außer- als auch im innergemeinschaftlichen Warenverkehr die entscheidende Rolle bei der Abfertigung der Tabakerzeugnisse. Da vor allem in Bayern u.a. aufgrund des Nichtraucherschutzgesetzes Snus konsumiert wird und anlässlich rechtlicher Neurungen durch die Bayerische Regierung hinsichtlich 18 Behler/Schröder: Das LMBG, S. 47, Rz. 23. 19 Behler/Schröder: Das LMBG, S. 191, Rz. 141. 20 http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/ueberwachung/lgl_aufgaben/index.htm. 21 Meyer: Lebensmittelrecht, S. 110 f.
16 der Abfertigung von Snus, möchte ich die aktuellen Entwicklungen in diesem Bundesland genauer betrachten. Zuständig für die Überwachung der Tabakerzeugnisse sind als Oberste Landesbehörde und Landesmittelbehörden das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit sowie die Regierungen der einzelnen Regierungsbezirke. Die Landratsämter und kreisfreien Städte übernehmen die Aufgaben der Vollzugsbehörden (Art. 21 I, II Nr. 2 GDVG). 22 Auch hier erfolgt die Unterstützung durch die einzelnen Zollstellen. 4.3.3 Abfertigung im Postverkehr 4.3.3.1 Allgemeine Postabfertigung Die Postabfertigung erfolgt stets im Rahmen des Weltpostvertrages (WVP), der dem EG-Recht übergeordnet ist. Dieser legt fest, dass jede Vertragspartei einen nationalen Betreiber auswählt, welcher allein die im WVP geregelten Dienste anbieten darf. Im Zollgebiet der EG wird jeweils ein ansässiger Postbetreiber pro Mitgliedstaat benannt, wobei in Deutschland die Deutsche Post AG 23 mit ihren Unterauftragnehmern (z.B. DHL) dieser Rolle zuteil wird. Andere Postdienstleister, wie beispielsweise UPS oder GLS, handeln ohne die Privilegien des WVP als Expressdienstleister oder Spediteure und sind damit vom sog. Postverkehr nicht umfasst. 24 Alle Postsendungen – sowohl aus Drittländern, als auch aus Mitgliedstaaten der EU –, die im Rahmen des WVP in die Bundesrepublik Deutschland gelangen, werden, je nach dem, ob sie über den Luft-, See- oder Landweg befördert wurden, in jeweils eine der fünf Auswechselungsstellen (ISPS Hamburg, IFS Radefeld, IFS Speyer, IPZ Frankfurt mit Außenstelle IPZ Niederaula) der Deutschen Post AG befördert, um sie dort auf ihre Gestellungspflicht (Art. 40 ZK) hin zu prüfen. Dabei wird zwischen gestellungspflichtigen und gestellungsbefreiten Sendungen unterschieden. Die gestellungsbefreiten Postsendungen, worunter u.a. Sendungen von Privat an Privat (Art. 25 ZollbefrVO), Sendungen mit geringem Wert (Art. 23 ZollbefrVO) oder Rücksendungen (Art. 185-187 ZK) fallen, werden von der Post ohne weitere 22 http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel/ueberwachung/organisation/. 23 http://www.upu.int/en/the-upu/member-countries/western-europe /germany.html. 24 Henke, in: Witte, Kommentar ZK, Art. 61, Rz. 41.
17 Zollformalitäten direkt an den Empfänger weitergeleitet (Art. 38 IV ZK, 237 I A., a), 4. Anstr. i.V.m. III a) ZK-DVO). Sie sind von der Beförderungspflicht gem. Art. 38 I ZK befreit, sofern sie keinen Verboten und Beschränkungen unterliegen (§ 5 I ZollVG). Ist dies jedoch der Fall, so gelten die Sendungen als gestellungspflichtig und müssen den Zollbehörden zwingend vorgelegt werden. 25 Sofern nun eine Postsendung „Snus“ aus Schweden nach Deutschland kommt, wird diese im Binnenmarkt der EU befördert und ist so grundsätzlich nicht von der deutschen Zollverwaltung zu behandeln. 26 In einem solchen Fall ist die Deutsche Post AG befugt, Zollanmeldungen in Vertretung des Empfängers abzugeben (§ 5 II ZollVG). Jedoch steht dem Verbringen von Snus in die Bundesrepublik ein Verbot gem. § 47 I Vorläufiges TabakG entgegen, sodass eine Vorlage bei der zuständigen Zollbehörde verpflichtend ist und der Empfänger die Abfertigung seiner Sendung eigenständig abwickeln muss. Diese EU-internen Sendungen werden durch die Deutsche Post AG aussortiert und an das für den Empfänger örtlich und sachlich zuständige Zollamt übermittelt. Der Empfänger der Sendung erhält über diesen Vorgang ein Benachrichtigungsschreiben und wird aufgefordert, am zuständigen Zollamt zu erscheinen und die nötigen Zollformalitäten zu erledigen (Selbstverzollung). 27 Diese zu erledigenden Formalitäten haben sich in Bayern im letzten Jahr grundlegend geändert. 4.3.3.2 Bisherige Handhabung von Mengenbegrenzungen Trotz des Verbots des Inverkehrbringens von Snus in der EU, war es bis Mitte 2012 privaten Konsumenten in Bayern erlaubt, Mengen von bis zu 1 - 1,5 kg Snus per Post zu beziehen. Bei dieser Gewichtsangabe handelt es sich um den durchschnittlichen Jahresbedarf eines Snus-Konsumenten, sodass der Bezug als privates Inverkehrbringen des Oraltabaks verstanden werden konnte. Ab einer Menge von 1 kg Snus war von dem Empfänger eine zusätzliche schriftliche Erklärung verlangt worden, in der er bestätigen musste, dass der Snus ausschließlich für den eigenen Verbrauch und nicht zur Weitergabe bestimmt war. Sofern Zweifelsfragen hinsichtlich der Gewerbsmäßigkeit bestanden, 25 Henke, in: Witte, Kommentar ZK, Art. 61, Rz. 42. 26 Henke, in: Witte, Kommentar ZK, Art. 61, Rz. 46. 27 Fraedrich: Zoll – Leitfaden, S. 91.
18 wurde die Lebensmittelüberwachung des jeweiligen Landratsamtes hinzugezogen. Sobald die Postsendung von der Deutschen Post AG also zur zuständigen Zollstelle befördert wurde und der Empfänger persönlich am Zollamt erschienen ist, gab dieser mündlich eine Zollanmeldung zur Überführung in den freien Verkehr ab (Art. 61 c) ZK). Dazu war die Rechnung als Unterlage (Art. 62 II ZK) vorzulegen, gem. Art. 77 I ZK, 218 ZK-DVO. Die Anmeldung wurde anschließend angenommen (Art. 63 i.V.m. 62 ZK) und die Postsendung nach einer kurzen Beschau (Art. 68 b) ZK) überlassen (Art. 73 ZK). Mit dieser Art der Abfertigung wurde dem § 5a TabakV insofern Rechnung getragen, dass ausschließlich das gewerbliche Inverkehrbringen von Snus untersagt ist und sämtliche Internet- oder Telefonbestellungen von Snus als privates Inverkehrbringen gelten. Um jedoch den Widerspruch des deutschen Rechts zum EU-Recht aus dem Weg zu räumen, wurden die Vorgaben zur Abfertigung von Snus erneuert. 4.3.3.3 Vollständiges Verbot der Einfuhr von Snus Diese Neuregelung erfolgte durch eine Stellungnahme der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz (LAV) - Arbeitsgruppe „Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Wein und Kosmetika“ des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV). Darin wurde versucht, den Begriff der „Gewerbsmäßigkeit“ so auszulegen, dass er ebenso die Postsendungen an private Empfänger für den Eigengebrauch umfasst und so der Regelung gem. Art. 8 RL 2001/37/EG entsprochen wird. „Nach Auffassung des BMELV liegt spätestens mit der Übergabe des Pakets durch die Post an den privaten Endkonsumenten in Deutschland ein Inverkehrbringen im Geltungsbereich des Vorläufigen Tabakgesetzes vor. Dies erfolgt gewerbsmäßig, da hier ausländische Firmen im Wege des Fernabsatzes – vornehmlich über das Internet – „Snus“ verkaufen und liefern“. Es liegt laut BMELV also immer dann ein gewerbsmäßiges Inverkehrbringen vor, wenn dem Verbringen der Ware ein Kaufgeschäft (§ 433 BGB) zu Grunde liegt, also „derjenige, der verbringt, oder
19 verbringen lässt, vom Empfänger der Erzeugnisse eine Gegenleistung erhält“. Folglich unterliegt jegliche Lieferung von Snus dem Verbot gem. § 47 I Vorläufiges TabakG i.V.m. § 5a TabakV. Wird gegen dieses Verbot verstoßen, obliegt die Entscheidung, wie mit der betroffenen Sendung weiter verfahren wird, der zuständigen Behörde, also dem örtlich zuständigen Zollamt. 28 Dieses verfährt in eigener Zuständigkeit und trifft gem. Art. 75 I a), 4. Anstr. ZK alle erforderlichen Maßnahmen. Diese umfassen hier zum Einen die Ungültigkeitserklärung der Zollanmeldung (Art. 66 I, 2. Alt. ZK) sowie entweder die Rücksendung oder die Vernichtung der Ware unter zollamtlicher Überwachung (vgl. Art. 182 I ZK). Der Empfänger der Postsendung wird in die Entscheidung miteinbezogen und bevorzugt meist die Rücksendung der Ware an den Versender, da so die Wahrscheinlichkeit auf Rückzahlung des Kaufpreises sehr hoch ist. Sofern allerdings keine der genannten Möglichkeiten in Anspruch genommen wird, schickt der Zoll die Sendung Snus nach 14 Tagen automatisch zurück. 29 Die Lebensmittelüberwachung leistet dabei nur Amtshilfe durch Rechtsauskünfte, da die Ware in Folge der Sicherstellung durch den Zoll noch nicht in die Bundesrepublik eingeführt ist und die LÜ daher verwaltungsrechtlich nicht tätig werden darf. Geschenksendungen, welche unentgeltlich von einer Privatperson an eine andere Privatperson erfolgen, fallen gem. § 47 II Nr. 8 Vorläufiges TabakG nicht unter das Verbringungsverbot. Gleiches gilt für Snus, welcher anlässlich einer Reise in die Bundesrepublik Deutschland verbracht wird (§ 47 II Nr. 6 Vorläufiges TabakG). 30 4.3.4 Abfertigung im innergemeinschaftlichen Reiseverkehr Sofern Bürger der EU innerhalb der Gemeinschaft verreisen, kommt der freie Warenverkehr innerhalb der Europäischen Union zum Tragen. Dieser fällt unter die vier Grundfreiheiten des Europäischen Binnenmarktes (Art. 28 – 37 AEUV) und umfasst gem. Art. 28 II AEUV „die aus den Mitgliedstaaten stammenden Waren“, also auch den in Schweden hergestellten Snus. 28 BMELV, Erlassentwurf, Nr. 4. 29 http://www.zoll.de/DE/Privatpersonen/Post-Internet/Sendungen-aus-einem- Nicht-EU-Staat/Verfahren/Verfahren_node.html. 30 BMELV, Erlassentwurf, Nr. 2a).
20 Der freie Warenverkehr impliziert gem. Art. 34 AEUV ein generelles Verbot mengenmäßiger Einfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkungen. Umgekehrt ist das Verbot der mengenmäßigen Ausfuhrbeschränkungen oder Maßnahmen gleicher Wirkung in Art. 35 AEUV geregelt. Auch Ein- und Ausfuhrzölle sowie Maßnahmen gleicher Wirkung sind gem. Art. 30 AEUV verboten. Das heißt, dass innerhalb der EU grundsätzlich Zollfreiheit besteht. Ausnahmen ergeben sich aus Art. 36 AEUV, wonach es den einzelnen Mitgliedstaaten erlaubt ist, Maßnahmen zum Schutz bestimmter Rechtsgüter (Art. 58 II ZK) zu treffen und diesbezüglich Einschränkungen im freien Warenverkehr vorzunehmen. Auch in Bezug auf die Verbrauchsteuern und die Umsatzsteuer sind nationale Regelungen zu beachten. 31 Daher dürfen Reisende, welche von Deutschland nach Schweden verreisen, neben ihrem normalen Reisegepäck zusätzlich Waren, die als Reisebedarf verbracht werden, mit sich führen, sofern es sich um Mengen handelt, für die keine Eingangsabgaben zu erheben sind (§ 47 II Nr. 6 Vorläufiges TabakG). Im Rahmen der Betrachtung der Einfuhrabgaben bei der Einreise von Schweden nach Deutschland gilt es festzuhalten, dass der Snus genau dann abgabenfrei und ohne Zollformalitäten mitgebracht werden kann, wenn die Ware vom Reisenden selbst im persönlichen Gepäck zum eigenen üblichen Bedarf bzw. Verbrauch in die Bundesrepublik befördert wird und dem Mitbringen keinerlei VuB entgegenstehen. Diese tabakrechtliche Befreiungsnorm korrespondiert mit Art. 45, 47 ZollbefrVO, § 2 I Nr. 5 EF-VO, wonach die jeweils genannte Menge an „anderen Waren“ (Snus ist keine Tabakware i.S.d. § 1 I, II Nr. 1-3 TabStG!) zoll- bzw. EUSt- frei ist. 32 Da das Verbringen von Snus im Rahmen des § 46 II Nr. 6 Vorläufiges TabakG jedoch vom Verbot ausgenommen ist, ist es den Deutschen erlaubt, Snus unbegrenzt in die Bundesrepublik mitzubringen, denn „eine mengenmäßige Beschränkung für Privatpersonen nach dem Vorläufigen Tabakgesetz und den dazu ergangenen Rechtsverordnungen besteht nicht“ 33. 5 FAZIT: NOTWENDIGKEIT EINER EINHEIT- LICHEN REGELUNG? 31 Möller: ZollPraxis, S. 43. 32 Fraedrich: Zoll-Leitfaden, S. 178. 33 BMELV, Erlassentwurf, Nr. 2 a).
21
Durch das Verbot des Inverkehrbringens von Oraltabak innerhalb
der EU und der Ausnahmeregelung für das Königreich Schweden,
„drängt sich zwangsläufig die Frage auf, wie es [...] zu
uneinheitlichen Standards im VuB-Bereich kommen kann, während
auf der anderen Seite der freie Warenverkehr ohne Binnengrenzen
gewährleistet werden soll“ 34. Wie im Folgenden erläutert werden
soll, ist klar, dass übermäßiger Snuskonsum eindeutig einen
Angriff auf das geschützte Rechtsgut der Gesundheit darstellt.
Trotzdem ist das VuB-Recht nur in Teilbereichen innerhalb der EU
harmonisiert. 35 Daher stellt sich die Frage, wie und ob hier eine
einheitliche Regelung bzgl. des Oraltabaks Snus getroffen werden
kann oder sogar muss.
5.1 ANGRIFF AUF DAS GESCHÜTZTE RECHTSGUT
DER GESUNDHEIT
Häufiger Snuskonsum stellt aufgrund der hohen
Gesundheitsschädlichkeit und stark karzinogenen Wirkung einen
enormen Angriff auf das geschützte Rechtsgut der Gesundheit und
des Lebens der Menschen dar. Vor allem aufgrund der
Verankerung des Rechts auf Leben und körperlichen
Unversehrtheit im Grundgesetz (Art. 2 II GG) steht die Gesundheit
des Menschen im Mittelpunkt der Politik und der Rechtsprechung.
So wird gem. Art. 58 II ZK der Schutz der Gesundheit und des
Lebens von Menschen namentlich als Grundlage für die
Anwendung von Verboten und Beschränkungen genannt. Snus fällt
als Tabakerzeugnis zum oralen Gebrauch unter diesen
Regelungsbereich. 36 Doch entspricht die Gesundheitsschädlichkeit
des Oraltabaks der von anderen Tabakwaren und ist die
Ausnahmeregelung damit gerechtfertigt?
5.2 GEGENÜBERSTELLUNG VON SNUS ZU ANDEREN
TABAKWAREN
Als sich der Konsum von Snus im gesamten Europa steigerte,
fanden wissenschaftliche Studien heraus, dass die
Gesundheitsschädlichkeit des Oraltabaks mit derer anderer
34
Rogmann, in: Henke, Verbote und Beschränkungen, S. 49, Rz. 50.
35
Rogmann, in: Henke, VuB bei Ein- und Ausfuhr, S. 47, Rz. 45.
36
Witte in: Henke, VuB bei Ein- und Ausfuhr, S. 101, Rz. 270.22 Tabakwaren, z.B. Zigaretten, gleichzusetzen ist. 37 Dies ist vor allem auf die enthaltenen karzinogenen Nitrosamine und das abhängig machende Nikotin zurückzuführen. Die Befürworter der Legalisierung und die schwedischen Snushersteller bestreiten dies jedoch und versuchen so eine Aufhebung des Verbots herbeizuführen. Dabei berufen sie sich meist auf die sog. „Swedish Experience“, welche besagt, dass in Schweden weniger Menschen an den Folgen ihres Tabakkonsums (in Form von Snus) sterben als in den restlichen europäischen Mitgliedstaaten und das, obwohl die Häufigkeit des Tabakkonsums in Schweden mit dem der anderen Länder durchaus vergleichbar ist. 38 Wissenschaftliche Studien widersprechen diesen Aussagen. In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Erkenntnisse des „Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks“ (SCENIHR) im Rahmen ihrer Studie „Health Effects of Smokeless Tobacco Products“ zurückgreifen. Dort wird betont, dass der Konsum von Snus eindeutig süchtig macht und bei einem Entzug des Produkts ähnliche Symptome auftreten, wie bei Rauchern. Auch wird erklärt, dass Snus aufgrund fehlender Beweise und Vergleichswerte zu herkömmlichen Entziehungstherapien nicht als wirksames Mittel zur Raucherentwöhnung einzustufen ist. Vielmehr wird in der Studie die stark krebserregende Wirkung von Snus hervorgehoben. 39 Als positiv ist der Konsum von Snus nur dahingehend zu bewerten, dass keinerlei Giftstoffe, welche durch das Verbrennen der Zigarette entstehen, anfallen und Snus nicht den in Zigaretten enthaltenen Teer beinhaltet. Auch entfällt die Problematik des sog. „passiven“ Konsums, wie es bei Zigaretten durch das Passivrauchen der Fall ist. Aus der Gesundheitsschädlichkeit können also keine eindeutigen Schlussfolgerungen gezogen werden, welche für eine einheitliche Regelung in Bezug auf den Oraltabak Snus sprechen würden. Schließlich könnte durch das Verbot aber der freie Warenverkehr innerhalb des EU-Binnenmarktes eingeschränkt sein und somit Zweifel hinsichtlich der Vereinbarkeit des Verbotes mit höherrangigem Europäischen Recht bestehen. 37 RL 92/41/EWG, Gründe für Erlass der RL. 38 http://www.estoc.org/key-topics/the-swedish-experience. 39 SCENIHR, Health Effects of Smokeless Tobacco Products, S. 5.
23
5.3 EINSCHRÄNKUNG DES INNEREUROPÄISCHEN
MARKTES?
Denn dadurch, dass der Handel und Verkauf von Snus nur in
Schweden erlaubt ist, fehlt den Herstellern von Snus die
Einnahmequelle, welche sich aus dem Absatz ihres Produkts in
anderen Mitgliedstaaten ergeben würde. Im Vergleich zu anderen
Unternehmen sind sie dahingehend benachteiligt, da – wie oben
bereits erläutert – innerhalb der EU grundsätzlich das Prinzip des
freien Warenverkehrs (Art. 28 – 37 AEUV) gilt. Womöglich ist
also der innereuropäische freie Markt eingeschränkt.
Die EU ist gem. Art. XX GATT aber grundsätzlich dazu berechtigt,
bestimmte Rechtsgüter zu schützen, welche sich auch im Art. 36
AEUV wiederfinden, und dafür den freien Warenverkehr in diesen
Bereichen einzuschränken. Neben dem Schutz der Gesundheit und
des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen sind hier die
Öffentliche Sittlichkeit, Ordnung und Sicherheit, die Kulturgüter
und der gewerbliche Rechtschutz zu nennen. Bedingung ist jedoch,
dass diese Verbote oder Beschränkungen weder ein Mittel zur
willkürlichen Diskriminierung, noch eine verschleierte
Beschränkung des Handels zwischen den Mitgliedstaaten darstellen
dürfen (Art. 36 S. 2 AEUV). Im Bezug auf den Verkehr mit Snus
kann aber nicht von einem Verstoß gegen dieses
Diskriminierungsverbot ausgegangen werden. „Gleichzeitig muss
[auch] dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz Rechnung getragen
werden“. Demnach ist „eine Beschränkung der
Warenverkehrsfreiheit [nur] dann verhältnismäßig, wenn sie
geeignet, erforderlich und angemessen ist, um das maßgebliche
Rechtsgut zu schützen“. 40 Da der Gesundheit eine sehr große
Schutzwürdigkeit zuteil wird, muss auf die Verhältnismäßigkeit
des Verbots hier genauer eingegangen werden.
Geeignet ist eine Maßnahme dann, wenn der Zweck, den sie
verfolgt, erreicht oder zumindest gefördert wird. Mit dem Verbot
des Inverkehrbringens von Snus wird der Schutz des Rechtsgutes
„Gesundheit des Menschen“ eindeutig gefördert.
Weiter ist die Beschränkung ist erforderlich, wenn kein gleich
geeignetes milderes Mittel festzustellen ist. Um das Ziel, den
Schutz der Gesundheit, verfolgen zu können, käme als milderes
Mittel beispielsweise eine Altersbeschränkung für den Snus in
Frage. Jedoch ist anzuzweifeln, ob diese Beschränkung als gleich
40
Rogmann, in: Henke, Ein- und Ausfuhr, S. 51, Rz. 58.24 geeignet gilt, denn mit einer bloßen Altersbeschränkung wird der Schutz der Gesundheit nicht gefördert, zumal es Jüngeren oft leicht möglich ist, trotzdem auf die Tabakprodukte zuzugreifen. Und schließlich ist eine Beschränkung dann angemessen, wenn der durch den Eingriff hervorgerufene Nachteil nicht schwerer wiegt, als der in der Zweckerreichung liegende Vorteil. Der Nachteil liegt eindeutig in der Einschränkung der Geschäftstätigkeit vieler schwedischer Snushersteller sowie der Konsumenten außerhalb Schwedens. Der Vorteil aber, dass mit dem Verbot ein kleiner Schritt in Richtung gesundheitsfreundlicheres Leben gemacht wird, überwiegt. Nur mit solchen Maßnahmen ist es möglich, einen Beitrag zur Reduzierung von Krebsrisiken zu erzielen. Und letztlich können die Konsumenten theoretisch immer noch nach Schweden reisen und sich mit einer Jahresration Snus versorgen. 41 Damit bestehen auch hinsichtlich der Verhältnismäßigkeit des Verbots keinerlei Bedenken und das Verbot kann als rechtmäßig eingestuft werden. Vom Schutz der oben genannten Rechtgüter ist ebenso im Art. 58 II ZK Gebrauch gemacht worden. Es gibt also eine Vielzahl an unterschiedlichen Verboten und Beschränkungen, deren Gesetzgebung aber größtenteils in nationaler Hand verbleibt. 42 Eine Harmonisierung innerhalb der Gemeinschaft konnte bisher nur in Teilbereichen erzielt werden. 43 Das Funktionieren des Binnenmarktes ist „aber u.a. davon abhängig, dass zwischen den am Binnenmarkt teilnehmenden Staaten weitgehend einheitliche VuB-Normen bestehen“. 44 Im Falle des Verkehrs mit Snus ist man von einer einheitlichen Vorgehensweise jedoch weit entfernt. Und zwar nicht nur den innereuropäischen Markt betreffend, sondern auch in Bezug auf die nationale Abfertigungspraxis von Snus. Dazu trägt gerade im Tabakrecht die Zuständigkeit der einzelnen Landesbehörden bei, welche die Verantwortlichkeiten auf die Regierungsbezirke verteilt haben. So kann es durchaus sein, dass die Regierung von Niederbayern andere Entscheidungen trifft als die Regierung von Oberbayern. Der innergemeinschaftliche Markt ist durch die Verbotsregelung zwar nicht schwerwiegend behindert, jedoch teilweise 41 Kock, in: Wolffgang (Hrsg.), Öffentliches Recht, S. 59. 42 Rogmann, in: Henke, Ein- und Ausfuhr, S. 48, Rz. 48. 43 Rogmann, in: Henke, Ein- und Ausfuhr, S.47, Rz. 45. 44 Rogmann, in: Henke, Ein- und Ausfuhr, S. 49, Rz. 49.
25 eingeschränkt. Es bleibt also festzuhalten, dass weitere Überarbeitungen des Verbotes und der Handhabung der Regelungen unausweichlich sind. Darin muss nicht nur der schwedischen Snustradition und der Wirtschaftsfähigkeit der Snushersteller Rechnung getragen werden, sondern auch der Schutz der menschlichen Gesundheit weiter verfolgt werden. Die Kombination beider Seiten ist schwierig, aber im Bereich des Möglichen und sollte vor allem zur bestmöglichen Zufriedenstellung aller involvierten Interessensgruppen so optimal wie möglich umgesetzt werden. II. ANHANG 1 – ABBILDUNGEN Abb. 1: Snus in Portionsbeuteln (links) und als loser Tabak (rechts)
26
Abb. 2: Anwendung von Snus zwischen Oberlippe und Zahnfleisch
Abb. 3: Snus- (in Tonnen) & Zigarettenkonsum (in Millionen
Stück) in Schweden von 1910 bis 201027
III. QUELLENVERZEICHNIS
Literaturverzeichnis
Behler / Schroeder Das Lebensmittel- und Bedarfsgegen-
ständegesetz, Berlin, 2002.
Bender, Peter Verbote und Beschränkungen im
Binnenmarkt, ZfZ, 1992, S. 199.
Deutsches Krebs-
forschungszentrum
(Hrsg.) Rauchlose Tabakprodukte: Jede Form
von Tabak ist gesundheitsschädlich,
Heidelberg, 2006.
Fraedrich, Dieter Zoll-Leitfaden für die Betriebspraxis,
Berlin, 14. Auflage, 2009.
Henke, Reginhard Verbote und Beschränkungen bei der
Ein- und Ausfuhr, Herne/Berlin,
2000.
Meyer, Alfred Hagen Lebensmittelrecht – Leitfaden für
Studium und Praxis, Stuttgart, 1998.28
Möller / Schumann ZollPraxis, Sternenfels, 2010.
SCENIHR Health Effects of Smokeless Tobacco
Products, Brüssel, 2008.
Schweizerische Fach-
Stelle für Alkohol- und
andere Drogenprobleme Fact Sheet Snus/Snuff, Lausanne,
2007.
Witte, Peter Zollkodex, 6. Auflage, München,
2013.
Witte / Wolffgang (Hrsg.) Lehrbuch des Europäischen Zoll-
rechts, 6. Auflage, Herne, 2009.
Wolffgang (Hrsg.) / Kock Öffentliches Recht und Europarecht,
5. Auflage, Herne, 2010.
Internetquellen:
Bayerisches Landesamt
für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit Wie funktioniert die Lebensmittel-
überwachung in Bayern?, Erlangen,
27.03.2013.
http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel
/ueberwachung/organisation/
(Stand: 09.07.2013)
Lebensmittelüberwachung: Aufgaben
des LGL, Erlangen, 27.02.2012.
http://www.lgl.bayern.de/lebensmittel
/ueberwachung/lgl_aufgaben/
index.htm
(Stand: 09.07.2013)
Buy Snus Die Geschichte des Snus.
http://www.buysnus.ch/history.html
(Stand 05.07.2013)29
Dr. Helga Osiander-Fuchs,
Bayerisches Landesamt
für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit Snus, Tabakerzeugnis zum anderwei-
tigen oralen Gebrauch als Rauchen
oder Kauen, Erlangen, 19.12.2012.
http://www.lgl.bayern.de/produkte/ta
bak/tabakerzeugnisse/et_snus.htm
(Stand: 29.06.2013)
European Smokeless
Tobacco Council The Swedish Experience.
http://www.estoc.org/key-topics/the-
swedish-experience
(Stand: 12.07.2013)
Office of the Director-
General, World Health
Organisation Europäische Ministerielle WHO-
Konferenz: Für ein tabakfreies Euro-
pa, Warschau, 2002.
http://www.who.int/director-general/
speeches/2002/arab_russian_chin_
german/20010218_getobaccowarsaw.
ge.html
(Stand: 28.06.2013)
Oh Schweden Snus – der Tabak der Schweden.
http://www.oh-schweden.de/kultur-
gesellschaft/snus-tabak-der-
schweden/
(Stand: 29.06.2013)
Pharmawiki Snus, zul. geändert am 11.05.2013.
http://www.pharmawiki.ch/wiki/inde
x.php? wiki=Snus
(Stand: 29.06.2013)
Statista Statistiken und Umfragen zum Thema
Rauchen.
http://de.statista.com/themen/150/rauc
hen/Sie können auch lesen