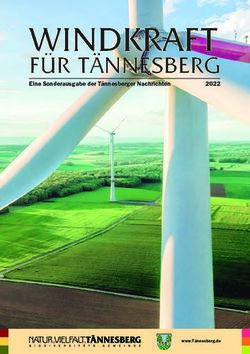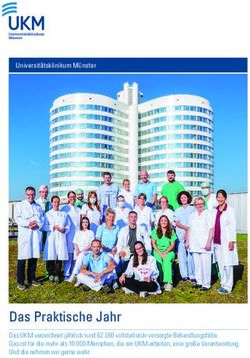SO HEIZEN DIE LANDESHAUPTSTÄDTE - GLOBAL 2000 Klimareport
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
INHALT
Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................................. 3
Bedeutung der Raumwärme in Österreich ..................................................................... 11
Heizen in Städten – heute & morgen .............................................................................. 12
Wien ...................................................................................................................................... 14
Graz ...................................................................................................................................... 19
Linz ....................................................................................................................................... 22
Salzburg ............................................................................................................................... 25
Innsbruck ............................................................................................................................. 28
Klagenfurt ........................................................................................................................... 30
St. Pölten ............................................................................................................................. 33
Bregenz ................................................................................................................................ 36
Eisenstadt ........................................................................................................................... 40
IMPRESSUM
Medieninhaberin, Eigentümerin und Verlegerin: Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000, Neustiftgasse 36, 1070 Wien,
Tel. (01) 812 57 30, E-Mail: office@global2000.at, www.global2000.at, ZVR: 593514598, Autoren: Johannes Wahlmüller
und Maximilian Hejda, Redaktion: Carin Unterkircher, Layout: Alexandra Lechner, Cover: indigo_design_shutterstock
2 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTZUSAMMENFASSUNG
DER ERGEBNISSE
Städte spielen eine Schlüsselrolle beim Klimaschutz. Fast Die Stadt Graz erarbeitet derzeit einen Klimaschutz-
zwei Drittel der österreichischen Bevölkerung wohnen in plan, ein Zwischenstand nennt das Ziel, bis 2040 die
Städten oder urbanen Räumen. Gleichzeitig sind Städte Treibhausgasemissionen auf 1 t CO2 pro Grazer:in zu
noch immer sehr stark von fossiler Energie abhängig. Die reduzieren. Für das Ziel Klimaneutralität 2040 ist jedoch
Wärmeversorgung erfolgt zum großen Teil durch Gashei- ein vollständiger Ausstieg aus fossiler Energie erforder-
zungen oder Fernwärme, die wiederum zu einem großen lich. In Linz hat der wiedergewählte Bürgermeister Klaus
Teil mit klimaschädlichem Erdgas betrieben wird. Viele Luger die „klimaneutrale Industriestadt“ als neues Leitbild
Menschen auf engem Raum, unterschiedliche Nutzungs- ausgegeben. Als Zielhorizont wird die Klimaneutralität
formen und unterschiedliche Interessen haben von jeher 2040 festgelegt. Auch hier soll eine detaillierte Strategie
ein hohes Maß an Planung, Koordinierung und Interessen- erarbeitet werden, mit der dieses Ziel dann beschlossen
ausgleich auf städtischem Boden erfordert. Das ist auch werden soll.
bei der Umsetzung der Energiewende so. Dennoch gibt es
kaum Untersuchungen darüber, wie Österreichs Städte bei Salzburg hat derzeit kein Ziel zum mittelfristigen Aus-
der Umsetzung der Energiewende liegen und ob die Stadt- stieg aus fossiler Energie formuliert, sondern nur für Teil-
politik planvoll und koordiniert an diese Herausforderung bereiche. Ein Ziel ist es, die Fernwärmeaufbringung bis
herangeht. Die vorliegende Studie widmet sich diesem 2040 zur Hälfte aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.
Thema und zeigt, dass insbesondere beim Ausstieg aus Das ist allerdings unambitioniert, denn bis 2040 sollte
klimaschädlichem Erdgas eine große Aufgabe bevorsteht. fossile Energie nicht mehr eingesetzt werden. Allerdings
wird in Salzburg derzeit ein neuer Klimaschutzzielpfad
Die Tabelle ab Seite 8 soll einen groben Überblick über entwickelt. Innsbruck strebt das auch in der Tiroler Lan-
die Ergebnisse des vorliegenden Reports geben. Darin despolitik verankerte Ziel der Energieautonomie 2050 an.
wurden die Klimaziele, Strategien, Programme und Inst- Bis dahin will man eine 100 % erneuerbare Energiever-
rumente aller Landeshauptstädte sowie deren Energieträ- sorgung erreichen.
germix in der Raum- und Fernwärme aufgelistet und ei-
ner groben Bewertung unterzogen. Gibt es ein Klimaziel, Klagenfurt will die Treibhausgasemissionen bis 2040 um
das den Vorgaben des Bundes (Klimaneutralität 2040) 90 % reduzieren und den Anteil erneuerbarer Energien
entspricht (grün) oder ist es hierfür nicht ausreichend auf 100 % steigern und gehört damit zu den Städten mit
bzw. erst im Entstehen (gelb) oder gibt es überhaupt kein den ambitionierteren Klimazielen. In St. Pölten werden
klares und absolutes Klimaziel (rot)? Ist derzeit ein Stra- derzeit keine langfristigen Ziele verfolgt. Diese sollen nun
tegieprozess mit einer neuen Ausrichtung in Gange (gelb) allerdings im Rahmen des Projekts „STP2030“ definiert
oder gibt es keine aktuelle bzw. umfassende Strategie werden. Bregenz hat 2021 den Klimanotstand ausgeru-
(rot)? Wie fossil sind die Raumwärmeversorgung bzw. fen und will die städtische Verwaltung und Tochtergesell-
die Fernwärmeerzeugung noch (dunkel- bis hellrot)? schaften bis 2030 klimaneutral machen. Ein Ziel für die
gesamte Stadt gibt es jedoch nicht. Eisenstadt wiederum
erklärt, dass es eine Klimamusterstadt werden will. Ein
Ausstieg aus fossiler Energie klares Ziel, bis wann fossile Energieträger in der Stadt
bis 2040 als neues Ziel ersetzt werden sollen, gibt es auch hier nicht.
Alle Landeshauptstädte setzen sich in unterschiedlicher In Summe zeigt sich, dass einzelne Landeshauptstädte
Form Klimaziele: (Wien und Klagenfurt) bereits ambitionierte Klimaziele
Die Stadt Wien setzt sich das Ziel 2040 klimaneutral zu verfolgen, die mit dem Pariser Klimaschutzabkommen
werden, bis dahin soll klimaschädliches Erdgas aus der vereinbar sind. Die restlichen Städte haben noch Nach-
Wärmeversorgung verschwunden und die Fernwärme holbedarf. Derzeit werden allerdings vielerorts Ziel-
frei von fossiler Energie sein. Wien gehört damit zu den setzungen überarbeitet. Aus Sicht von GLOBAL 2000
Städten mit den ambitioniertesten Klimazielen, die mit sollten sich alle Landeshauptstädte das Ziel setzen, bis
einer Klimastrategie untermauert sind. Allerdings steht 2040 eine Wärmeversorgung frei von fossilen Energien
ein detailliertes Wärmekonzept noch aus. zu erreichen.
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 3Strategien und Maßnahmen diesen Programmen und Strategien (siehe Graz, Wien,
der Landeshauptstädte Klagenfurt). Einige der Pläne haben allerdings teilweise
zu wenig Substanz, um Ausgangspunkte für wirksame
Aufbauend auf diese Ziele haben die Landeshauptstädte Aktivitäten zu werden oder wurden politisch nicht ausrei-
unterschiedliche Programme und Maßnahmenpläne aus- chend verfolgt (siehe Linz, Eisenstadt, Innsbruck), andere
gearbeitet. In Wien gibt es die aktuelle Smart Klima City Programme werden nicht oder nur zum Teil umgesetzt
Strategie, die vorsieht, dass in Zukunft Geothermie und (siehe Salzburg, Bregenz). Es ist somit entscheidend,
Wärmepumpen einen großen Teil der Wärmeversorgung dass die jetzt in Entwicklung befindlichen Strategien mit
liefern sollen. Allerdings werden derzeit immer noch Neu- wirksamen Maßnahmen und Monitoringkonzepten hin-
bauten mit Gasheizungen errichtet, was den gesetzten terlegt werden, damit die Umsetzung vorankommt.
Klimazielen entgegensteht.
In Graz befindet sich derzeit ein Klimaschutzplan in Aus- Wärmeversorgung Österreichs
arbeitung. Zu erwarten ist die Zielsetzung, die Fernwär- Landeshauptstädte fossil geprägt
me von 80.000 auf 100.000 Wohnungen auszuweiten.
Effektiv zeigte sich die Arbeitsgruppe „Wärmeversorgung Die Wärmeversorgung der österreichischen Landes-
Graz 2020/2030“, die viele Projekte auf Schiene ge- hauptstädte ist noch sehr stark von fossilen Energieträ-
bracht hat, wie die Abwärmenutzung der Papierfabrik gern geprägt, wobei Erdgas die Hauptrolle spielt. Fern-
Sapi. In Linz gibt es verschiedene Programme, wie die wärme spielt in fast allen Städten außer Eisenstadt und
Agenda 21 oder ein Energieeffizienzprogramm aus dem Bregenz eine große Rolle, allerdings wird auch diese sehr
Jahr 2012, allerdings keine kohärente mit Maßnahmen häufig zu einem großen Anteil durch fossile Energieträger
ausgestattete strategische Umsetzung der Klimaziele. und hier wiederum vor allem durch Erdgas hergestellt.
In Salzburg wurde der Smart City Salzburg Masterplan
2025 erstellt, der jedoch nur zum Teil umgesetzt wurde. In Wien wird der Wärmebedarf der Haushalte zu 57 %
Wichtige Teile, wie eine Erhöhung der Sanierungsrate durch Erdgas und zu 30 % durch Fernwärme gedeckt, die
auf 3 % oder die Umstellung kommunaler Gebäude auf allerdings ebenfalls zu 65 % aus fossiler Energie her-
klimafreundliche Heizenergie wurden nicht oder nicht gestellt wird, hauptsächlich aus Erdgas. In den letzten
vollständig umgesetzt. Jahren wurden in Wien 25.000 neue Erdgasheizungen
installiert, was den Klimazielen klar entgegensteht.
In Innsbruck haben die Kommunalbetriebe einige Maß-
nahmen, wie die Umstellung von Erdgasheizungen In Graz geht der Wärmebedarf der Haushalte zu etwa
auf Fernwärme, vorgesehen. Es gibt auch eine Förder- 18 % auf klimaschädliches Erdgas, zu 8 % auf Heizöl und
schiene für klimafreundliche Heizgeräte und thermische zu 48 % auf Fernwärme zurück, wobei die Datenlage auf
Sanierungsmaßnahmen. Klagenfurt hat eine Smart City Schätzungen beruht. Die Fernwärme wird zu 78 % aus
Strategie, die unter anderem vorsieht, die Sanierungsrate Erdgas hergestellt. Allerdings ist es gelungen, den Anteil
anzuheben und ein Nahwärmenetz (Anergienetz) zur der Abwärme aus Industrieanlagen, wie der Papierfab-
Seewassernutzung zu errichten. In St. Pölten gibt es ein rik Sapi, auf 20 % zu steigern. Große Projekte wie „Big
Energieleitbild, das die Förderung von Wärmepumpen solar“, die Solarthermie in großem Stil einsetzen sollten,
vorsieht. Weiters wurde im Rahmen des Energiekon- wurden bis dato aber nicht realisiert.
zeptes eine Fernwärmeleitung nach Dürnrohr errichtet.
In Bregenz gibt es einen Aktionsplan mit verschiedenen In Linz beträgt der Anteil von Erdgas 19 % und jener
Maßnahmen, wie der Senkung des Raumwärmebedarfs der Fernwärme 59 %, allerdings auf Basis der gesam-
kommunaler Gebäude um 25 % bis 2020. Allerdings ten beheizten Fläche. Auf Haushalte bezogen, liegt der
wurden die Ziele meist verfehlt. Der Raumwärmebedarf Anteil jener mit Fernwärmeanschluss bereits bei etwa
kommunaler Gebäude wurde um 20 % gesenkt, das 72 %. Fernwärme wird auch in Linz zu einem großen Teil
Ziel, die Solarthermie um 1.000 m² pro Jahr auszubauen, aus Erdgas erzeugt. 51 % der Fernwärme kommen aus
wurde verfehlt. Anstatt zu sinken, sind die Treibhausgas- Heizkraftwerken, die mit Erdgas betrieben werden. Der
emissionen gestiegen. Ölheizungen werden immer noch Rest stammt aus Abfallverbrennung (26 %), Biomasse
durch klimaschädliche Gasheizungen getauscht. In Eisen- (12 %) und Abwärme (11 %). Auffällig ist, dass in Linz
stadt wurde eine „Klimaschutzoffensive“ beschlossen, die der Anteil der Abwärme an der Fernwärmeerzeugung nur
vorsieht, erneuerbare Energieträger „nach Möglichkeit“ halb so hoch ist wie in Graz, obwohl Linz als bedeutende
einzusetzen. Genauere Definitionen fehlen. Industriestadt hohe Potenziale zur Nutzung von Abwär-
me aufweist.
In Summe zeigt sich, dass alle Landeshauptstädte Stra-
tegien und Maßnahmenpläne entwickelt haben. Viele In Salzburg wird die Wärmeversorgung der Haushalte
sinnvolle Klimaschutzprojekte nahmen ihren Anfang in mit Fernwärme (33 %), Erdgas (30 %), Heizöl (18 %) und
4 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTBiomasse (11 %) sichergestellt. Salzburg hat damit als Für Eisenstadt stehen keine Daten bezüglich des Wär-
eine der wenigen Landeshauptstädte noch einen sehr mebedarfs zur Verfügung, allerdings werden 76 % der
hohen Ölheizungsanteil und wie viele andere Städte auch Wohngebäude mit fossiler Energie beheizt, wobei Gas
einen hohen Erdgas-Anteil. Die Fernwärme wird zum mit 64 % klar dominiert. Ölheizungen machen 12 % aus.
Großteil von zwei fossilen Groß-Heizwerken, die mit Erd- Der Rest heizt mit einer ineffizienten Stromheizung (10 %),
gas und Öl befeuert werden, bestritten. 71 % der Fern- mit erneuerbaren Energien (11 %) oder mit Fernwärme,
wärme in Salzburg sind nach wie vor fossil, 19 % werden die allerdings nur einen verschwindend geringen Anteil
aus Abwärme, 10 % aus Biomasse gewonnen. Fossile hat (2 %).
Energie stellt also den Hauptteil der Wärmeversorgung.
Neben der Art der Heizung ist die thermische Sanie-
In Innsbruck hat der Wärmebedarf der Wohngebäude rung der Gebäude erforderlich, aber bis dato noch nicht
einen Anteil von 30 % am Gesamtenergiebedarf und ist im ausreichenden Ausmaß berücksichtigt. Anders als
somit der größte Energieverbraucher der Stadt. Laut der beim Energieverbrauch existieren kaum Daten über den
letzten Erhebung im Jahr 2015 hat Innsbruck dabei mit thermischen Zustand der Gebäude oder den sanierungs-
etwa 43 % den höchsten Heizöl-Anteil unter allen Lan- würdigen Bestand. In Wien lag die Sanierungsrate 2018
deshauptstädten, etwa 29 % gehen auf klimaschädliches bei 1 % und damit deutlich unter dem österreichischen
Erdgas und etwa 10 % auf elektrischen Strom zurück. Schnitt von 1,4 % und weit weg von der notwendigen
Die Fernwärme kommt auf etwa 9 % und erneuerbare Sanierungsrate von 3 %.
Energieträger (Biomasse, Solarthermie, Wärmepumpen)
gemeinsam auf etwa 8 %. Über 80 % der Wärmeversor- Die Landeshauptstädte Graz, Salzburg und Bregenz
gung Innsbrucks sollten daher dringend einem System- haben sich das Ziel gesetzt, die Sanierungsrate auf 3 %
wechsel unterzogen werden. Die regelmäßige Erhebung anzuheben. Der aktuelle Stand ist nicht bekannt, ange-
aktueller Daten sollte ebenso rasch eingeführt werden. sichts einer durchschnittlichen Sanierungsrate in Öster-
reich von 1,4 % dürfte man aber auch in Graz, Salzburg
In Klagenfurt liegt der Anteil fossiler Energieträger am und Bregenz weit davon entfernt sein. Klagenfurt hat
Wärmebedarf der Haushalte bei 47 %, wobei 43 % auf sich eine Sanierungsrate von 2 %, Innsbruck von 1,3 %
Heizöl und 4 % auf Erdgas zurückgehen. 35 % des Wär- zum Ziel gesetzt, auch dort wird der aktuelle Stand nicht
mebedarfs wird durch Fernwärme und 18 % durch Bio- erhoben. In Linz, St. Pölten und Eisenstadt sind keine
masse gedeckt. Klagenfurt gehört damit zu den wenigen Ziele in diesem Bereich bekannt.
Städten, die einen hohen Anteil an Ölheizungen haben.
Die Fernwärmeerzeugung in Klagenfurt erfolgt zu 81 % Da die Gebäudesanierung ein essenzieller und entschei-
aus Biomasse und zu 19 % aus Erdgas. Damit ist Klagen- dender Hebel des Klimaschutzes und der städtischen
furt eine Ausnahme unter den Landeshauptstädten, weil Energieversorgung ist, zeigt die Analyse, dass hier mas-
die Fernwärmeversorgung zum Großteil aus erneuerbarer siver Handlungsbedarf besteht, sowohl bei der Erhebung
Energie besteht. Dennoch ist der Anteil an fossiler Ener- von Daten als auch bei der Planung und Durchführung
gie insgesamt noch sehr hoch. von konkreten Sanierungsmaßnahmen, die in Abstim-
mung mit der Umstellung der Heizsysteme passieren
In St. Pölten wird der Wärmebedarf der Haushalte zu sollten. Alle Städte sollten zudem Ausstiegspläne aus
36 % durch fossile Energieträger gedeckt, wobei 33 % fossilen Heizungen und der Fernwärme erarbeiten. Dazu
auf Erdgas und 3 % auf Heizöl zurückgehen. Die Fern- gehört es auch, den städtischen Energieversorger, sofern
wärme hat einen Anteil von 46 %, Biomasse einen Anteil vorhanden, in die Klimaschutzbemühungen einzubinden
von 18 %. Die Fernwärmeerzeugung beruht auch in St. und in die Pflicht zu nehmen.
Pölten zu einem großen Teil auf fossiler Energie. 41 %
der Fernwärme werden mit klimaschädlichem Erdgas
bestritten. Treibhausgasemissionen
In Bregenz haben fossile Energieträger einen Anteil von Starke Unterschiede zeigen die Landeshauptstädte auch
86 % am Wärmebedarf der Haushalte. Gas hat einen bei der Entwicklung der Treibhausgasemissionen. So sind
Anteil von 75 %, Öl einen Anteil von 11 %. Bregenz ist in Wien die Treibhausgasemissionen im Raumwärme-
somit die Landeshauptstadt mit dem höchsten Anteil bereich zwar im Zeitraum von 2010 bis 2019 um 12 %
fossiler Energie beim Heizen. Nur ein Anteil von 11 % gesunken, das ist aber weniger als im österreichischen
des Wärmebedarfs wird durch erneuerbare Energieträger Durchschnitt, wo eine Reduktion um 21 % erreicht wer-
gedeckt. Fernwärme gibt es in Bregenz keine. Der Wär- den konnte. In den letzten Jahren (seit 2014) stagnierten
mebedarf der Haushalte ist in den letzten zehn Jahren die Emissionen im Raumwärmebereich, während sie in
merklich gestiegen (+16 %), was dementsprechend auch der Energieerzeugung, wozu auch die Fernwärmepro-
den Gasverbrauch nach oben getrieben hat. duktion gehört, sogar deutlich angestiegen sind. Etwa
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 5ein Viertel der Gesamtemissionen Wiens entsteht bei der Handlungsempfehlungen
Bereitstellung von Raumwärme.
Ein Blick auf die Klimapolitik der Landeshauptstädte im
In Graz spielt die Wärmeversorgung für die Grazer Wärmebereich zeigt, dass es sehr unterschiedliche Aus-
Emissionen eine wesentliche Rolle, genaue Daten für prägungen gibt, der Handlungsbedarf in allen Städten
diesen Bereich sind aber nicht ersichtlich. In Linz sind die aber sehr hoch ist. Folgende Handlungsempfehlungen
Treibhausgasemissionen der Haushalte zwischen 2010 sollte eine moderne klimafreundliche Stadtpolitik jeden-
und 2017 um 19 % und jene der Heizwerke um 32 % falls berücksichtigen:
gesunken. Letztere sind allerdings seit 2014 wieder im
Anstieg. In Salzburg sind die Treibhausgasemissionen • Das Ziel, bis 2040 frei von fossiler Energie im Wärme-
für die Bereitstellung von Wärme in den Haushalten seit bereich zu werden, sollte in allen Landeshauptstädten
2010 zwar um 7 % gesunken, die Emissionen der Fern- gesetzt werden. Das ist die Voraussetzung für die Er-
wärme sind aber gestiegen. Den größten Anteil an den reichung von Klimaneutralität 2040.
Emissionen hat derzeit klimaschädliches Erdgas. In
Klagenfurt wurden die CO2-Emissionen im Raumwär- • Der Ausstieg aus fossiler Energie bis 2040 und die Mo-
mebereich zwischen 2011 und 2018 um 44 % gesenkt, dernisierung des Gebäudebestands durch thermische
noch immer ist aber ein großer Teil der Wärmeversor- Sanierungen sollten in allen Städten Teil der Planungs-
gung fossil, insbesondere Ölheizungen sind ein großes prozesse werden. Es braucht einen klaren Plan für den
Thema. In St. Pölten sind die gesamten CO2-Emis- Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen und einen Ausstieg
sionen zwischen 2005 und 2020 um 25 % gesunken. aus fossiler Fernwärme in allen Städten.
Die Emissionen der Haushalte wurden dabei mehr als
halbiert (−58 %). In Bregenz sind die Treibhausgasemis- • Die städtischen Energieversorger sollten von der
sionen in der Wärmeversorgung gestiegen. Etwa 40 % Kommunalpolitik stärker als Klimaschutz-Zugpferd
der Emissionen entstammen der Raumwärmeversorgung. eingesetzt werden. Sie können als Kompetenzzentrum
Innsbruck und Eisenstadt sind die einzigen Landes- agieren, wichtige Investitionen planen und damit eine
hauptstädte, für die keine Daten bekannt sind und wo entscheidende Rolle bei der Umsetzung der Wärme-
somit kein Überblick über die Entwicklung der Treibhaus- wende spielen. Dafür ist es aber auch notwendig,
gasemissionen besteht. vielerorts Umdenkprozesse einzuleiten und veraltete
Denkmuster zu überwinden.
Ein Blick auf die Entwicklung der Treibhausgasemis-
sionen in den Landeshauptstädten zeigt, dass es starke • Weiters braucht es fundierte Klima- und Energiestra-
Unterschiede gibt. Während im langfristigen Vergleich tegien, die mit konkreten Maßnahmen und Projekten
Klagenfurt eine starke Reduktion vorweisen kann, einige hinterlegt sind.
Städte leichte und mittlere Reduktionen erreichen (Wien,
St. Pölten, Salzburg), gibt es auch Städte, die in den • Die Erhebung von aktuellem Datenmaterial ist die
letzten Jahren Anstiege im gesamten Wärmebereich oder Grundlage für solide Entscheidungen. In den meis-
in Teilbereichen wie der Fernwärme verzeichnen (Wien, ten Städten besteht hier Nachholbedarf, in manchen
Salzburg, Bregenz). Innsbruck und Eisenstadt haben Städten kann von einer veralteten und mangelhaften
keinen Überblick über ihre Treibhausgasemissionen und Datenlage gesprochen werden.
können entsprechende Daten auch auf Nachfrage nicht
liefern. In Graz gibt es zwar eine Erhebung der aktuellen • Landes- und bundespolitische Initiativen können und
Treibhausgasemissionen, aber keine Daten zur langfristi- müssen diese Bemühungen unterstützen. Die Städte
gen Entwicklung. können aber ihrerseits der Antrieb für diese Entwick-
lung sein, indem sie die eigenen Spielräume nutzen und
Rahmenbedingungen auf landes- und bundespoliti-
scher Ebene einfordern.
6 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTLandeshauptstädte: Wärmebedarf der Haushalte
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Relative Anteile der Energieträger
50 % Fossile Brennstoffe
Strom*
40 % Fernwärme
Erneuerbare Energien
30 %
Sonstige
20 %
10 % * Klagenfurt, St. Pölten und
Bregenz exkl. Stromheizungen
Von Linz und Eisenstadt sind
Wien Graz Salzburg Innsbruck Klagenfurt St. Pölten Bregenz keine vergleichbaren Daten
(2020) (2015) (2019) (2015) (2018)* (2020)* (2018)* bekannt.
Datenquellen: Statistik Austria (2021), Wegener Center (2019), Stadt Salzburg (2021),
Stadt Innsbruck (2016), Stadt Klagenfurt (2021), Stadt St. Pölten (2021), Stadt Bregenz (2021)
Landeshauptstädte: Fernwärmeerzeugung
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
Relative Anteile der Energieträger
50 %
Fossile Brennstoffe
40 % Abfall/Reststoffe
Alternative Quellen
30 % (erneuerbar, Abwärme)
20 %
10 % * In Eisenstadt sind nur 3 %
der Gebäude an das Fern
wärmenetz angeschlossen.
Wien Graz Linz Innsbruck St. Pölten In Bregenz gibt es kein
Salzburg Klagenfurt Eisenstadt* Fernwärmenetz.
Datenquellen: Statistik Austria (2021), Stadt Graz (2021), LINZ AG (2021), Salzburg AG (o. J.),
Stadt Innsbruck (2021), Stadt Klagenfurt (2021), Stadt St. Pölten (2021), Energie Burgenland (2021)
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 7Strategien, Programme, Instrumente
Absolutes Klimaziel Energieträgermix – Energieträgermix –
mit Relevanz für den Gebäude-/
bis 2040 bzw. 2050 Raumwärme + Warmwasser Fernwärme
Raumwärmebereich
Wien Klimaneutralität 2040 • Smart Klima City Strategie und Klima-Fahrplan mit Teilzie- gesamter Raumwärmebedarf Fernwärmeerzeugung (2020)
len und Maßnahmen für den Raumwärmebereich im Entwurf (2020)
fossil: 65 % (Erdgas: 63 %)
• Dekarbonisierungskonzept für die Wärmeversorgung in fossil: 46 % (Erdgas: 42 %) Abfälle: 19 %
Ausarbeitung Strom: 10 % erneuerbar 16 %
Fernwärme: 40 %
• Energieraumpläne als Instrumente zur Reduktion von fos- erneuerbar: 4 %
silen Heizsystemen in Neubauten zwar positiv, aber ausbau-
fähig Wärmebedarf der Haushalte
(2020)
• als Bundesland hat Wien den Vorteil, dass jährlich Daten
durch die Statistik Austria und das Umweltbundesamt fossil: 59 % (Erdgas: 57 %)
erhoben werden Strom: 8 %
Fernwärme 30 %
erneuerbar: 3 %
Graz Reduktion der THG-Emissio- • Klimaschutz-Plan als umfassende Strategie in Ausarbeitung Wärmebedarf der Haushalte Fernwärmeerzeugung
nen auf 1 t CO2-e pro Kopf (2015) (Ø 2017-19)
bis 2040 und Kompensation • Arbeitsgruppe Wärmeversorgung für ein emissionsarmes
der Restemissionen¹ Fernwärmesystem zeigt erste Erfolge, aber hat noch viel fossil: 28 % (Erdgas: 18 %, Öl: 8 %) Erdgas: 78 %
zu tun Strom: 19 % Abwärme: 20 %
Fernwärme: 48 % erneuerbar: 2 %
• negativ: Datenlage (nur Abschätzung des Wärmebedarfs erneuerbar: 5 %
von 2015)
Linz Klimaneutralität 2040² • zwar Handlungskonzept mit Teilziel für die Fernwärme, gesamte beheizte Fläche (2019) Fernwärmeerzeugung (2020)
aber noch keine umfassende Strategie mit Maßnahmen
zur Zielerreichung vorhanden fossil: 21 % (Erdgas: 19 %) fossil 51 % (v.a. Erdgas)
Strom (inkl. WP): 16 % Abfall + Klärschlamm: 26 %
• Erarbeitung eines Klimaneutralitätskonzepts wurde nun Fernwärme: 59 % Abwärme: 11 %
angekündigt Biomasse: 1 % Biomasse: 12 %
unbekannt: 3 %
• jährliches THG-Monitoring, aber wenige Daten zur Wärme
versorgung
1 In einem Zwischenbericht zum Klimaschutz-Plan als zukünftige Zielausrichtung angekündigt
2 Stadtratsbeschluss vom Jänner 2022, aber noch keine detaillierte Definition
8 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTStrategien, Programme, Instrumente
Absolutes Klimaziel Energieträgermix – Energieträgermix –
mit Relevanz für den Gebäude-/
bis 2040 bzw. 2050 Raumwärme + Warmwasser Fernwärme
Raumwärmebereich
Salzburg keines • Smart City Salzburg Masterplan 2025 mit Teilzielen im Wärmebedarf der Haushalte Fernwärmeerzeugung (2021)
Gebäude- bzw. Raumwärmebereich, allerdings bisher wenig (2019)
umgesetzt fossil: 71 % (v.a. Erdgas)
fossil: 48 % (Erdgas: 30 %, Öl: 18 %) Abwärme: 19 %
• Klimaschutzzielpfad zwar in Ausarbeitung, aber vorerst Strom: 5 % Biomasse: 10 %
eher als Monitoring-Instrument und nicht als Ziel/Strategie Fernwärme: 33 %
vorgesehen erneuerbar: 14 %
• positiv: Energieberichte mit jährlichen Daten (THG, Wärme)
Innsbruck Energieautonomie 2050 • keine umfassende Strategie mit Maßnahmen zur Ziel Wärmebedarf der Haushalte Fernwärmeerzeugung (2021)
•R
eduktion des Energie erreichung vorhanden, nur Szenarien mit Maßnahmen (2015)
verbrauchs um 25,8 % vorschlägen fossil: 40 %
•S
teigerung des Anteils fossil: 73 % (Öl: 43 %, Erdgas: 29 %) alternativ: 60 %
erneuerbarer Energien • sehr schlechte Datenlage (nur Energieflussbild für 2015) Strom: 10 %
auf 100 % Fernwärme: 9 %
• positiv: Innsbrucker Kommunalbetriebe wollen bis 2030 erneuerbar: 8 %
klimaneutral sein und haben ein Maßnahmenpaket
vorgelegt
Klagenfurt • -90 % THG-Emissionen • Smart City Strategie mit Teilzielen und Maßnahmen für den gesamter Raumwärmebedarf Fernwärmeerzeugung (2018)
bis 2040 (ggü. 2011) Raumwärmebereich vorhanden (2018, exkl. Industrie, exkl.
• 100 % erneuerbare Energie Stromheizungen) Erdgas: 19 %
bis 2040 • Umsetzung eines Maßnahmenkatalogs von 2014 (SEAP) Biomasse: 81 %
hat zu positiver Entwicklung im Raumwärmebereich geführt fossil: 37 % (Öl: 31 %)
Fernwärme: 41 %
• Energie- und THG-Bilanzen für 2011 und 2018 Biomasse: 22 %
Wärmebedarf der Haushalte
(2018, exkl. Stromheizungen)
fossil: 47 % (Heizöl: 43 %)
Fernwärme: 35 %
Biomasse: 18 %
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 9Strategien, Programme, Instrumente
Absolutes Klimaziel Energieträgermix – Energieträgermix –
mit Relevanz für den Gebäude-/
bis 2040 bzw. 2050 Raumwärme + Warmwasser Fernwärme
Raumwärmebereich
St. Pölten keines • keine aktuelle Strategie vorhanden Wärmebedarf der Haushalte Fernwärmeerzeugung (2021)
(2020, exkl. Stromheizungen)
• positiv: Umsetzung des Energieleitbilds und -konzepts Erdgas: 41 %
von 2009 mit Maßnahmen v.a. für die Fernwärme hat zu fossil: 36 % (Erdgas: 33 %) Abfall: 59 %
THG-Reduktionen geführt Fernwärme: 46 %
Biomasse: 18 %
• Energie- und THG-Bilanzen für 2005 und 2020 vorhanden
Bregenz klimaneutrale Stadtver- • Klima- und Energiestrategie 2030 wurde nicht veröffent- Wärmebedarf der Haushalte keine Fernwärme
waltung bis 2030, aber kein licht, aber vermutlich keine weitreichenden Teilziele und (2018, exkl. Stromheizungen)
gesamtstädtisches Ziel Maßnahmen
fossil: 86 % (Erdgas: 75 %, Öl: 11 %)
• Teilziele der Energiestrategie 2020 wurden größtenteils erneuerbar: 11 %
verfehlt Sonstige: 3 %
• Energie- und THG-Bilanzen für 2008, 2013 und 2018
vorhanden
Eisenstadt keines • Stadtentwicklungsplan sieht zwar Ausbau der Fernwärme Heizsysteme in Wohngebäuden Fernwärmeerzeugung (2021)
vor, aber stellt keine Strategie mit konkreten Maßnahmen (2021)
dar 100 % Biomasse
fossil: 76 % (Erdgas: 64 %, Öl: 12 %) (aber nur 3 % der Gebäude mit
• Eisenstädter Klimaschutzoffensive ist inhaltsleer Strom: 10 % Fernwärmeanschluss)
erneuerbar: 11 %
• Daten bezüglich der Heizsysteme in Gebäuden vorhanden Fernwärme: 2 %
10 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTBEDEUTUNG DER RAUM-
WÄRME IN ÖSTERREICH
Die Wärmeversorgung ist ein Schlüsselfaktor für eine er
folgreiche Energiewende. Raumwärme (inkl. Warmwas-
Österreich: Energiebedarf für
ser und Klimatisierung) ist in Österreich für fast ein Drittel
(32 %) des Gesamtenergieverbrauchs verantwortlich³.
Raumklima und Warmwasser
Der Anteil fossiler Heizsysteme liegt bei knapp 40 %, der
Anteil erneuerbarer Systeme bei 31 %. Der Rest geht auf
elektrischen Strom und Fernwärme zurück. Letztere wird
in Österreich etwa zur Hälfte (52 %) aus erneuerbaren
Quellen erzeugt⁴.
7%
14 %
Der Großteil des Raumwärmebedarfs geht auf Privat-
haushalte (69 %) und den Dienstleistungssektor (20 %)
zurück. Aufgrund des immer noch sehr hohen Anteils an 24 %
fossilen Energieträgern ist dieser auch die Hauptursache
für Treibhausgasemissionen von Gebäuden. Der Gebäu- 342 PJ
25 %
desektor ist in Österreich für 17 % der Gesamtemissio-
nen (ohne EH⁵) verantwortlich⁶. Mit 8 Mio. t CO2 konnte
der Wert im Vergleich zu 1990 zwar um über ein Drittel
reduziert werden, seit 2014 sind die Emissionen aber 19 %
nicht weiter gesunken. 10 %
Thermische Sanierung und Heizkesseltausch sind Maß-
nahmen, durch die die Emissionen im Gebäudesektor
weiter gesenkt werden können. Allerdings werden in
Österreich viel zu wenige Gebäude thermisch saniert. Heizöl
Die Sanierungsrate liegt mit 1,4 % weit weg von den Erdgas
erforderlichen 3 %⁷. Seit 2010 ist die Sanierungstätig- Strom
keit stark zurückgegangen. Im Jahr 2020 wurde nur etwa
Fernwärme
die Hälfte des Volumens von 2010 saniert⁸. Außerdem
Bioenergie
müssen Öl- und Gasheizungen durch erneuerbare Syste-
me (z.B. Wärmepumpe, Solaranlage, Pelletheizung) oder Umgebungswärme
einen Fernwärmeanschluss ersetzt werden. Gleichzeitig
muss aber auch die Fernwärmeerzeugung aus alternati-
Datenquelle: Statistik Austria (2021)
ven Quellen kontinuierlich steigen.
3 Statistik Austria (2021): Nutzenergieanalyse (Anm.: inkl. Warmwasser der Privathaushalte, das in der Nutzenergieanalyse der Statistik Austria
unter Prozesswärme subsumiert ist)
4 Statistik Austria (2021): Energiebilanzen
5 EH = Emissionshandel. Im EU-Emissionshandel sind große Anlagen von Industrie- und Energiewirtschaft erfasst.
6 Umweltbundesamt (2021): Nahzeitprognose der österreichischen Treibhausgas-Emissionen für 2020
7 Umweltbundesamt (2020): Definition und Messung der thermisch-energetischen Sanierungsrate in Österreich
8 IIBW & FV Steine-Keramik (2021): Wohnbauförderung in Österreich 2020
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 11HEIZEN IN STÄDTEN –
HEUTE & MORGEN
Die Relevanz der Städte für den Klimaschutz zeigt sich Wo kein Fernwärmeausbau möglich ist, können städtische
schon daran, dass 62 % der österreichischen Bevölke- Einfamilienhäuser auf erneuerbare Einzelheizsysteme (z.B.
rung ihren Hauptwohnsitz in urbanen bzw. suburbanen Wärmepumpe) umgerüstet werden. Schwieriger ge-
Gebieten haben⁹. Wiederum die Hälfte davon lebt in dicht staltet sich dies für mehrgeschoßige Wohnbauten ohne
besiedelten Gebieten, also in einer der sechs Großstädte Zentralheizsystem. In diesem Fall bietet sich entweder
(>100.000 EW). Dazu zählen neben Wien auch die die Möglichkeit, die Leitungen in Lüftungsschächten und
Landeshauptstädte Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck und kalten Rauchfängen zu verlegen, oder aber es muss ein
Klagenfurt. Die übrigen Landeshauptstädte St. Pölten, zentrales Rohrsystem eingestemmt werden. Als Anreiz für
Bregenz und Eisenstadt zählen laut Statistik zu den die Umrüstung braucht es neben Förderungen auch drin-
Städten mit mittlerer Siedlungsdichte. Insgesamt gibt gend gesetzliche Rahmenbedingungen für den Ausstieg
es in Österreich 87 Gemeinden mit mindestens 10.000 aus klimaschädlichem Erdgas. Nur so kann sichergestellt
gemeldeten Personen¹⁰. Vor allem die kleineren Landes- werden, dass alle Gebäude, die derzeit noch mit fossiler
hauptstädte stehen somit exemplarisch für einen relevan- Energie beheizt werden, in den nächsten 18 Jahren einmal
ten Städtetyp, der in Österreich sehr häufig vorkommt. einer thermisch-energetischen Ertüchtigung unterzogen
werden.
Hinsichtlich Klimaschutz haben städtische Gebiete auf-
grund der kurzen Wege und der geringen Höhenunter- Einen Schritt in die richtige Richtung machen das Kli-
schiede zwar einen Vorteil, wenn es um die Bereitstellung maschutzministerium (BMK) und die Österreichische
klimafreundlicher Mobilität im innerstädtischen Verkehr Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) mit ihrer Leit-
geht, aufgrund der geringen und dicht bebauten Fläche initiative „Die klimaneutrale Stadt“, die österreichische
besteht allerdings ein Nachteil in der Verfügbarkeit von Städte bei der Umsetzung von Maßnahmen in Richtung
erneuerbaren Energien für die Strom- und Wärme- Klimaneutralität unterstützen soll. Einen Teilbereich dieser
erzeugung. Gute Planung und entsprechende politische Initiative stellt die „Fit4UrbanMission“ dar, welche neun
Vorgaben, sind daher für eine koordinierte Umsetzung Städte, darunter sieben Landeshauptstädte¹¹, auf eine
von Klimaschutzmaßnahmen gerade für den städtischen mögliche Teilnahme an der EU-Mission „100 klimaneu
Bereich essenziell. trale Städte bis 2030“ vorbereiten will.
Die Bereitstellung von Raumwärme erfolgt in Städten
derzeit überwiegend durch Erdgas und durch Fernwär- Methode
me. Letztere kann aus fossilen und erneuerbaren Quellen
sowie Abwärme stammen. Der Ausbau der Fernwärme Diese Studie hat das Ziel zu untersuchen, wie weit die
aus erneuerbaren Quellen und die verstärkte Nutzung Landeshauptstädte Österreichs schon auf dem Weg der
von Abwärme gelten derzeit als die aussichtsreichsten Energie- bzw. Wärmewende sind. Werden Ziele im Ein-
Lösungen für die städtische Wärmewende. Möglichkeiten klang mit den klimawissenschaftlichen Empfehlungen ge-
hierfür bestehen in der verstärkten Nutzung von bioge- setzt? Werden ausreichend Maßnahmen zur Umsetzung
nen Reststoffen, gewerblicher Abwärme, Großwärme- ergriffen? Gibt es klare Strategien und ein Monitoring zur
pumpen, Solar- oder Geothermie. Erneuerbares Gas darf Umsetzung?
auf Grund der geringen Verfügbarkeit in der Raumwärme
hingegen nur eine untergeordnete Rolle spielen (z.B. Dazu hat GLOBAL 2000 einerseits öffentlich zugängliche
Spitzenlastabdeckung). Daten und Dokumente ausgewertet. Da deren Verfüg-
9 Statistik Austria (2021): Grad der Urbanisierung - Paket Bevölkerungsstand 2021
10 Wikipedia (2021): Liste der Städte in Österreich
11 Bregenz und Eisenstadt sind nicht an der Initiative beteiligt.
12 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTbarkeit jedoch sehr eingeschränkt ist, wurden auch Fra- und wenn möglich die Entwicklung der Wärmeversor-
gebögen an die jeweiligen Stadtregierungen verschickt. gung dargestellt.
Die Analyse soll einen Überblick über den Stand der Um-
setzung der Wärmewende in den Landeshauptstädten Da die Datenlage in den einzelnen Landeshauptstädten
geben und sich auf die wesentlichen Aspekte konzentrie- sehr unterschiedlich ist und auch auf unterschiedliche
ren. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Erhebungsmethoden zurückgegriffen wird, ist es leider
Abbildung jeglicher einzelner Initiativen in dem Bereich. schwierig, direkte quantitative Vergleiche zwischen den
Städten zu ziehen. Ein qualitativer Vergleich ist aber
In jedem Kapitel wird auf die Klimaziele der jeweiligen möglich und es können durchaus Aussagen darüber
Stadt und auf ihre Programme bzw. Instrumente im gemacht werden, welche Städte bei der Forcierung der
Gebäude- bzw. Raumwärmebereich eingegangen. Energie- bzw. Wärmewende bereits ambitionierter vor-
Anhand der öffentlich verfügbaren bzw. der von den gehen und welche hier noch großen Aufholbedarf haben.
Städten zur Verfügung gestellten Daten wird der Stand
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 13WIEN
Smart Klima City Strategie
Bevölkerungsstand 2020¹² 1.914.743 Die Smart Klima City Strategie soll die Umsetzung des
Ziels der Klimaneutralität bis 2040 in den verschiedenen
Bereichen konkretisieren. In einem Entwurf¹⁸ wurden
Entwicklung 2010-2020 +12 % folgende für den Gebäude- bzw. Raumwärmebereich
relevanten Ziele formuliert:
• gänzlicher Ausstieg aus der fossilen Wärmeversorgung
bis 2040
Klimaziele • Senkung des Endenergieverbrauchs pro Kopf für Hei-
zen, Kühlen und Warmwasser in Gebäuden um 20 %
Laut dem Koalitionsabkommen¹³ der Wiener Stadtregie- bis 2030 und um 30 % bis 2040
rung soll Klimaneutralität bis 2040 erreicht werden. Im • Senkung der CO2-Emissionen pro Kopf für Heizen, Küh-
Jänner 2022 wurde ein Entwurf¹⁴ für einen entsprechen- len und Warmwasser in Gebäuden um 55 % bis 2030
den Fahrplan vorgestellt. Darin ist festgelegt, dass fossile und auf null bis 2040
Energie in der Wärmeversorgung bis 2040 nicht mehr • Steigerung der erneuerbaren bzw. dekarbonisierten
eingesetzt werden soll. Ab 2021 wurde ein verbleibendes Energieerzeugung bis 2030 auf das Dreifache und bis
Treibhausgasbudget von 60 Mio. t CO₂-e festgelegt. Bis 2040 auf das Sechsfache gegenüber 2005
2030 sollen die Pro-Kopf-Emissionen um 55 % gegen-
über 2005 gesenkt werden und der Energieverbrauch soll Wiener Klima-Fahrplan
bis 2030 zur Hälfte und bis 2040 vollständig aus erneu- Der Entwurf¹⁹ für den Klima-Fahrplan, der im Jänner
erbaren und dekarbonisierten Quellen gedeckt werden. 2022 präsentiert wurde, enthält neben den neuen Ziel-
setzungen der Smart Klima City Strategie auch ein Maß-
nahmenplan zur Zielerreichung. So soll beispielsweise
Strategien, Programme, ein gesetzlicher Rahmen für den Ausstieg aus fossilen
Instrumente Heizsystemen geschaffen werden (EWG, Energieraum-
planung). Für thermische Sanierung und Kesseltausch soll
Klimaschutzprogramm (KliP II)¹⁵ es Förder-, Pilot- und Begleitprogramme geben. Die Stadt
Die im Jahr 2009 beschlossenen zweiten Klimaschutz- selbst und ihre Unternehmen sollen als Vorbild fungieren
programm (KliP II) für 2020 gesteckten Ziele wurden und deren Gebäude bereits früher durch erneuerbare
nur zum Teil erreicht. So konnten zwar die Pro-Kopf- Energieträger beheizt werden. Im Bereich der Fernwärme
Emissionen u.a. auch aufgrund des starken Bevölke- sollen eine Netzerweiterung und eine Erschließung bzw.
rungswachstums stärker als geplant reduziert werden¹⁶, Einbindung von Tiefengeothermie, Großwärmepumpen
die Erhöhung des Fernwärmeanteils auf 50 % ist jedoch und Wärmespeichern erfolgen. „Erneuerbares Gas“ soll
nicht im vorgesehenen Ausmaß gelungen. Zwischen lediglich zur Spitzenlastabdeckung in KWK-Anlagen ge-
2010 und 2020 ist deren Anteil am Energiebedarf für nutzt werden, nicht aber für Heizung und Warmwasser.
Raumklima und Warmwasser von 37 % auf lediglich
40 % gestiegen¹⁷. Ein weiteres Ziel im Raumwärme- Wiener Wärme und Kälte 2040
bereich war die Verringerung der CO2-Emissionen für Gemäß dem Koalitionsabkommen und den für den
Heizung, Warmwasser und Kälte durch die Veränderung Wärmebereich angekündigten Zielen wird derzeit ein
des Energieträgermixes. Wie die aktuellen Daten (siehe Konzept für die Dekarbonisierung der Wärme- und Kälte-
unten) zeigen, kam es hier in den letzten 10 Jahren versorgung bis 2040 erarbeitet, welches bis Ende 2022
allerdings zu keinen großen Veränderungen. fertiggestellt werden soll. Eine entsprechende Studie mit
12 Statistik Austria (2021): Bevölkerungsstand
13 SPÖ & NEOS (2020): Die Fortschrittskoalition für Wien
14 Stadt Wien (2022): Wiener Klima-Fahrplan - Unser Weg zur klimagerechten Stadt (Entwurf)
15 Stadt Wien (2009): Klimaschutzprogramm der Stadt Wien - Fortschreibung 2010-2020
16 Stadt Wien (2019): Fortschrittsbericht über die Umsetzung des Klimaschutzprogramms (KliP) der Stadt Wien
17 Statistik Austria (2021): Nutzenergieanalyse(KliP) der Stadt Wien
18 Stadt Wien (2021): Smart Klima City Strategie Wien - Der Weg zur Klimamusterstadt (Entwurf)
19 Stadt Wien (2022): Wiener Klima-Fahrplan - Unser Weg zur klimagerechten Stadt (Entwurf)
14 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORT
Szenarien für die Dekarbonisierung des Wiener Energie- Wärmeversorgung Wiens
systems bis 2040²⁰ wurde von der Wien Energie bereits
veröffentlicht. Diese sieht im Bereich der Wärmeversor- Energiebedarf für Raumklima
gung vor, dass bis 2040 ein vollständiger Ausstieg aus und Warmwasser²²
Erdgas auch in Bestandsgebäuden erforderlich ist und Im Jahr 2020 betrug der Energiebedarf für Raumklima
dass „erneuerbares Gas“ entsprechend den politischen und Warmwasser in Wien knappe 55 PJ. Das sind 44 %
Vorgaben in der Wärmeversorgung weitestgehend nicht des gesamten Energiebedarfs der Stadt. In 10 Jahren ist
zum Einsatz kommen soll. Möglichkeiten werden in der der Bedarf für Raumklima und Warmwasser um 10 %
Umstellung fossiler Heizsysteme auf Wärmepumpen (−6,4 PJ) gesunken, was vor allem mit einer Reduktion
oder Fernwärme gesehen. Gleichzeitig kann die Dekarbo- des Erdgasverbrauchs um 16 % (−4,5 PJ) einherging.
nisierung der Fernwärme durch die Nutzung von Tiefen- Heute werden 42 % der Energie in Form von Erdgas und
geothermie, (Groß-)Wärmepumpen und Wärmespeicher 40 % in Form von Fernwärme verbraucht. 10 % gehen
erfolgen. auf elektrischen Strom, 4 % auf Heizöl und 4 % auf die
direkte Nutzung von erneuerbarer Energie (Biomasse,
Klimaschutz-Gebiete Umgebungswärme) zurück.
(WrBO § 2b Energieraumpläne)²¹
Mit der Novellierung der Wiener Bauordnung im Jahr 61 % der Energie für Raumklima und Warmwasser wird
2018 wurde der Gemeinderat ermächtigt, Klimaschutz- von Privathaushalten und 36 % im Dienstleistungssek-
Gebiete (im Gesetz „Energieraumpläne“ genannt) zu tor verbraucht. Die restlichen 3 % gehen auf das Konto
verordnen. In einem solchen Gebiet müssen Neubauten von Industrie und Landwirtschaft. Während im Dienst-
mit einem erneuerbaren Heizsystem oder mit Fernwärme leistungssektor bereits 57 % der Energie in Form von
ausgestattet werden. Die Verordnungen werden be- Fernwärme und nur 18 % in Form von Erdgas verbraucht
zirksweise erarbeitet. Für 8 Bezirke wurden bereits 2020 wird, gehen bei den Haushalten nur 30 % des Verbrauchs
Energieraumpläne beschlossen. Die restlichen Bezirke auf Fernwärme und immer noch 57 % auf Erdgas zurück.
hätten ursprünglich bis Ende 2021 folgen sollen. Diese Heizöl ist hingegen im Dienstleistungssektor mit einem
Frist wurde allerdings um ein Jahr nach hinten verscho- Anteil von 8 % noch stärker verbreitet als bei Haushalten.
ben. Bis Ende 2022 sollen sich dann 8 von 10 Neubauten
in einem solchen Klimaschutz-Gebiet befinden.
Wien: Energiebedarf für Raumklima und Warmwasser (2020)
64.000
64.000
56.000
56.000
48.000
48.000
40.000
40.000 Kohle
Heizöl
32.000
32.000
Erdgas
24.000
24.000 Strom
Terajoule (TJ)
Fernwärme
16.000
16.000
Erneuerbare Energien
8.000
8.000
0
0
2010
2010 2011 2012
2011 2012 2013
2013 2014
2014 2015 2016 2017
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2018 2019 2020
Datenquelle: Statistik Austria (2021)
25.000
20 Wien Energie (2021): Szenarien für die Dekarbonisierung des Wiener Energiesystems bis 2040
21 Stadt Wien (o. J.): Klimaschutz-Gebiete - Energieraumpläne für Wien (wien.gv.at)
22 Statistik Austria (2021): Nutzenergieanalyse (Anm.: inkl. Warmwasser der Privathaushalte,
20.000
das in der Nutzenergieanalyse der Statistik Austria unter Prozesswärme subsumiert ist)
15.000
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 15
10.000Wien: Energiebedarf für Raumklima und Warmwasser (2020)
100 % 2%
8%
90 %
18 %
80 %
70 % 57 % 13 %
60 % Heizöl
Relative Anteile der Energieträger
Erdgas
50 %
Strom
40 % Fernwärme
8%
Erneuerbare Energien
57 %
30 %
20 %
30 %
10 %
3% 4%
Privathaushalte Dienstleistungssektor
Datenquelle: Statistik Austria (2021)
Wien: Heizsysteme in Privathaushalten
100 % 1% 1%
3% 3% 1% 3%
90 %
80 %
46 % 46 % 46 % 49 %
50 % 47 %
70 %
60 % Kohleheizungen
Relative Anteile der Heizsysteme
Ölheizungen
50 % 5% 4% 6% Gasheizungen
6% 5%
7% Stromheizungen
40 %
Fernwärmeanschluss
30 % Erneuerbare Systeme
44 % 44 % 45 % 43 %
20 % 38 % 41 %
10 %
1% 2% 3% 2% 2% 2%
09/10 11/12 13/14 15/16 17/18 19/20
Datenquelle: Statistik Austria (2021)
16 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORT2.500
2.000
1.500
1.000
Heizsysteme in Privathaushalten²³ hingegen die Fernwärmeerzeugung aus brennbaren Ab-
49 % der Wiener Haushalte heizen mit Erdgas, 43 % fällen (+4 %-Pkt. auf 19 %). Der Anteil der Fernwärme,
500
mit Fernwärme, 5 % mit elektrischem Strom, 2 % mit die in KWK-Anlagen (fossile Energien, Abfall und Bio-
erneuerbaren
0 Systemen (Biomasse, Solar, Wärmepum- masse) erzeugt wird, beträgt heute insgesamt 83 %.
pe) und 1 % mit2010
Heizöl.2011 2012an Haushalten
Der Anteil 2013 2014mit2015 2016 2017 2018 2019
Fernwärmeanschluss konnte in 10 Jahren um 5 %-Pkt. Thermische Sanierungen²⁵
gesteigert werden, während der Anteil an Gasheizungen Die thermisch-energetische Sanierungsrate lag in Wien
um 1 %-Pkt. gesunken ist. Damit wird immer noch die im Jahr 2018 bei 1 % und damit deutlich unter dem
Hälfte der Wiener Haushalte mit fossilen Heizsystemen Durchschnittswert der zehn Jahre davor (∅ 2009–2018:
beheizt. Da auch die Anzahl der Haushalte insgesamt 1,5 %). Damit liegt man in Wien auch deutlich unter dem
gestiegen ist, sind in 10 Jahren sogar über 25.000 Gas- österreichischen Schnitt von 1,4 % (2018) und weit weg
heizungen dazugekommen. von der notwendigen Sanierungsrate von 3 %.
3.500
Fernwärmeerzeugung²⁴
3.000 Treibhausgasemissionen²⁶
Der Anteil der Fernwärmeerzeugung aus fossilen Rohstof- Die gesamten Treibhausgasemissionen Wiens im Non-
fen ist 2.500
in 10 Jahren von 70 auf 65 % gesunken. Während EH-Bereich²⁷ sind zwischen 2010 und 2019 um 2,8 %
die Nutzung von Erdgas in Heizwerken (−4 %-Pkt. auf auf rd. 6,2 Mio. t CO2-e nur leicht gesunken. Die Pro-Kopf-
2.000
5 %) und Heizöl (−7 %-Pkt. auf 2 %) leicht verringert Emissionen lagen 2019 bei 3,3 t CO2-e (mit EH: 4,6 t).
werden konnte, ist die Anwendung von Erdgas in KWK- Die Emissionen im Gebäudesektor konnten im selben
1.500
Anlagen gestiegen (+6 %-Pkt. auf 58 %). Gleichzeitig Zeitraum um rd. 12 % gesenkt werden und haben einen
konnte1.000
der Anteil der Fernwärme aus erneuerbaren Anteil von 24 % an den Gesamtemissionen (ohne EH).
Quellen nur um 1 %-Pkt. auf 16 % gesteigert werden. Allerdings ist das eine geringere Reduktion als im öster-
Seit 2019 hat die Umgebungswärme erstmals einen
500 reichischen Durchschnitt, wo eine Senkung der Emis-
nennenswerten Anteil von 2 %. Stärker zugenommen hat sionen im Gebäudebereich um rd. 21 % erreicht werden
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wien: Fernwärmeerzeugung
25.000
25000
20.000
20000
15.000 Öl
15000
Erdgas (HW)
Erdgas (KWK)
Terajoule (TJ)
10.000
10000 Abfälle
Bioenergie
5.000
5000 Umgebungswärme
0
0
2010
2010 2011 2012
2011 2012 2013
2013 2014
2014 2015 2016 2017
2015 2016 2017 2018 2019 2020
2018 2019 2020
Datenquelle: Statistik Austria (2021)
23 Statistik Austria (2021): Energieeinsatz der Haushalte (Anm.: nur Hauptwohnsitze berücksichtigt)
24 Statistik Austria (2021): Energiebilanzen
25 Umweltbundesamt (2020): Definition und Messung der thermisch-energetischen Sanierungsrate in Österreich
26 Umweltbundesamt (2021): Bundesländer Luftschadstoff-Inventur 1990-2019
27 EH = Emissionshandel. Im EU-Emissionshandel sind große Anlagen von Industrie- und Energiewirtschaft erfasst. Non-EH bezeichnet hingegen
die Bereiche außerhalb des Emissionshandelssystems, wie Verkehr, Gebäude, Abfallwirtschaft, Landwirtschaft und F-Gase
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 17500
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Wien: Treibhausgasemissionen
3.500
3.500
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000
2.000 Energieerzeugung
Gebäudesektor
1.500
1.500
Abfallwirtschaft
1.000
1.000
kt CO2e
500
500
00
2010
2010 2011
2011 2012
2012 2013
2013 2014
2014 2015
2015 2016
2016 2017
2017 2018
2018 2019
2019
Datenquelle: Umweltbundesamt (2021)
konnte.²⁸ Die Emissionen des Energiesektors, der zwar Kritisch ist zu sehen, dass die Sanierungsrate noch weit
dem EH-Bereich zugerechnet wird, zu dem jedoch neben entfernt von der erforderlichen Sanierungsrate von 3 %
der Strom-
25000auch die Fernwärmeerzeugung (exkl. Abfall liegt. Eine Verdreifachung der Bemühungen in Wien ist
verbrennung) zählt, sind um 16 % geringer als 2010. notwendig. Hier braucht es ein klares Konzept, wie die
Sowohl im Gebäude- als auch im Energiesektor nahmen thermische Sanierung vorangetrieben werden kann. Ob-
20000
die Emissionen zwischen 2010 und 2014 ab und stiegen wohl der Ausstieg aus Erdgas ernsthaft diskutiert wird,
dann wieder an. Die Emissionen der Abfallwirtschaft darf nicht übersehen werden, dass in Wien auch im Neu-
(inkl. Abfallverbrennung
15000 für Fernwärme) blieben konstant. bau noch immer Erdgasheizungen installiert werden. Mit
der vollständigen Umsetzung der Energieraumpläne soll
erreicht werden, dass 8 von 10 Neubauten ohne Gas-
10000
Kommentar von GLOBAL 2000 heizungen errichtet werden. Die Umsetzung ist derzeit
aber noch nicht vollständig und auch ein Anteil von 20 %
Positiv sieht
5000GLOBAL 2000, dass die Stadt Wien im Gasheizungen in Neubauten ist nicht länger vertretbar.
Koalitionsübereinkommen das ambitionierte Ziel bis 2040 Hier braucht es deutlich stärkere rechtliche Klarstellungen
klimaneutral zu werden, verankert hat. Allerdings gilt es in der Bauordnung.
0
dieses Ziel noch in Strategien
2010 und konkrete
2011 2012 2013 2014Umsetzungs-
2015 2016 2017 2018 2019 2020
schritte zu übersetzen. Im Klimafahrplan ist hier vermerkt, Als klare Handlungsempfehlungen für Wien lassen sich
dass man erst auf bundespolitische Rahmenbedingungen aus den vorliegenden Ergebnissen somit folgende Schritte
warten will. Damit würde man aber wertvolle Zeit verlie- ableiten:
ren, denn die Stadt Wien hat die Kompetenzen, die not- • Erstellung eines Sanierungsfahrplans zur Anhebung der
wendigen Schritte für den Ausstieg aus fossiler Energie Sanierungsrate auf 3 %
im Wärmebereich zu setzen. • Ausarbeitung von Landesgesetzen, insbesondere in der
Bauordnung um einen geordneten Ausstieg aus Erdgas
Dass es bereits eine Studie zum Ausstieg aus fossilen umzusetzen, anstatt auf Regelungen des Bundes zu
Energieträgern der Wien Energie gibt, kann als Schritt warten
in die richtige Richtung bewertet werden, ebenso die • Sicherstellung der Finanzierung, unter anderem durch
Ankündigung, bis zum Ende des Jahres 2022 ein fertiges Zweckbindung der Wohnbauförderung, um die Leist-
Konzept für den Ausstieg aus Öl und Gas im Wärmebe- barkeit und Durchführbarkeit der Wärmewende in Wien
reich zu liefern. sicherzustellen
28 Umweltbundesamt (2021): Klimaschutzbericht 2021
18 GLOBAL 2000 – KLIMAREPORTGRAZ
Im November 2020 wurde vom Grazer Gemeinderat ein
Bevölkerungsstand 2020²⁹ 290.910 Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung eines umfassenden
Klimaschutz-Plans gefasst. Dieser ist noch in Bearbeitung
und soll voraussichtlich folgende Ziele³¹ beinhalten:
Entwicklung 2010-2020 +12 % • Bis 2040 werden im Stadtgebiet Graz die Treibhaus-
gasemissionen jährlich 10 % reduziert. Im Jahr 2040
verbleiben somit maximal 1 CO2-e pro Grazer:in an
nicht vermeidbaren Restemissionen. Diese sollen
Ziele „nachhaltig“ kompensiert werden.
• Bis 2030 wird das Haus Graz (Magistrat + Holding) sei-
Bereits im Jahr 2008 wurden vom Grazer Gemeinderat in ne Treibhausgasemissionen jährlich um 20 % reduzie-
einem Grundsatzbeschluss zur Erarbeitung des Energie- ren. Im Jahr 2030 verbleiben somit maximal ½ t CO2-e
masterplans Graz³⁰ folgende Klimaschutzziele definiert: pro Mitarbeiter:in an Restemissionen. Diese sollen
• Reduktion des Pro-Kopf-CO2-Ausstoßes auf max. 1 t „nachhaltig“ kompensiert werden.
pro Jahr
• Reduktion des Energieeinsatzes auf ein Drittel Dieses Ziel würde bei gleichbleibendem Bevölkerungs-
• Steigerung des Anteils erneuerbarer Energien auf 75 % wachstum eine Reduktion der Gesamtemissionen um
etwa 75 % gegenüber 2018 bedeuten.
Teilziele Evaluierung 2020
Massiver Ausbau der Fernwärme: +20 % Fernwärme- Anzahl mehr als verdoppelt
anschlüsse bis 2020 gegenüber 2008
Graz als Solarhauptstadt: 1 m² Sonnenkollektor pro nicht erreicht, kann nur durch Groß-Solaranlage
Einwohner:in erreicht werden
Verstärkte Nutzung von Abwärme und erneuerbaren 2014 lag der Anteil bei 7 %
Energieträgern: 50 % Anteil im Fernwärmesystem bis 2019 lag der Anteil bei 23 %
2030 und 100 % bis 2050
Erhöhung der thermischen Sanierungsrate auf 3 % keine Evaluierung erfolgt
bis 2020
-15 % elektrische Warmwasserbereitung und keine Evaluierung erfolgt
-10 % Stromheizungen bis 2020 gegenüber 2008
Reduktion des Energieeinsatzes für Wärme in keine Evaluierung erfolgt
den Haushalten um 3 % pro Jahr
Reduktion der CO2-Emissionen der Haushalte keine Evaluierung erfolgt
um 20 % gegenüber 2008
29 Statistik Austria (2021): Bevölkerungsstand
30 Stadt Graz (2008): Aktionsprogramm „Kommunales Energie- und Klimaschutzkonzept Graz 2020 (KEK GRAZ 2020)“ – Grundsatzbeschluss
31 Stadt Graz (o. J.): Klimaschutzplan - Zwischenbericht (Einseiter)
KLIMAREPORT – GLOBAL 2000 19Sie können auch lesen