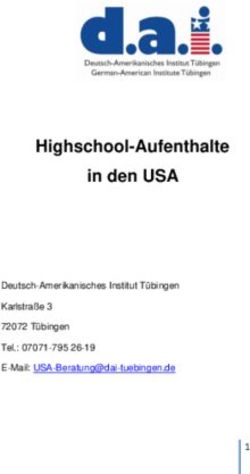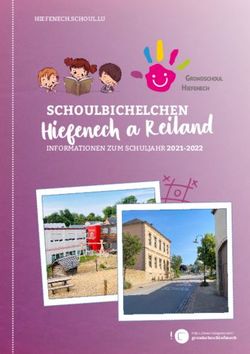Tiergestützte Pädagogik - Konzept für den Einsatz eines Schulhundes an der Wilhelm-Busch-Schule
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wilhelm-Busch-Schule
Springweg 21- 23
45473 Mülheim an der Ruhr
Tiergestützte Pädagogik
Konzept für den Einsatz eines Schulhundes
an der Wilhelm-Busch-Schule
von Ann-Katrin Olson
Oktober 2020
FlokiInhaltsverzeichnis
1. Tiergestützte Pädagogik 3
2. Was ist ein Schulhund? 3
3. Warum ein Schulhund an der Wilhelm-Busch-Schule? 4
3.1. Klassenklima 4
3.2. Umgang mit Aggressionen 5
3.3. Kommunikation 5
3.4. Grob- und Feinmotorik 5
3.5. Sensibilität fördern 6
3.6. Akzeptanz anderer 6
3.7. Förderung des Selbstbewusstseins 6
4. Grundvoraussetzungen 6
4.1. Schule 6
4.2. Kinder und Jugendliche 7
4.3. Lehrkraft Frau Olson 8
4.4. Schulhund Floki 8
5. Hygieneplan und Infektionsprävention 9
5.1. Hygiene / Gesundheitsvorsorge Hund 9
5.2. Schulung und Verhalten der SchülerInnen 10
5.3. Zugangsbeschränkungen 10
6. Ziele der Arbeit mit Floki 10
7. Einsatz im Unterricht 11
8. Literatur 13
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 21. Tiergestützte Pädagogik Tiere und besonders Hunde begleiten den Menschen schon seit Jahrhunderten; sie unterstützten als Jagdhelfer, Wachhunde und Weggefährten. Mittlerweile ist bekannt, dass Haustiere auch das Wohlbefinden des Menschen deutlich steigern: Die Herzfrequenz und der Atemrhythmus verlangsamen und beruhigen sich. Diese Reaktionen sind nicht nur im privaten Bereich sondern auch bei SchülerInnen zu beobachten, die in der Schule Kontakt zu Tieren haben (vgl. Konzept für das Projekt „Schulhund“ an der Willy-Brandt-Gesamtschule 2010, S. 3). Die Tiergestützte Pädagogik basiert auf den Erfahrungen, die bereits in den 1960er Jahren mit der Tiergestützten Therapie gemacht wurden. Der Kinderpsychotherapeut Boris M. Levinson beobachtete, dass sein Hund leicht Kontakt zu seinen jungen Patienten aufnehmen konnte. Er setzte das Tier daher gezielt zur Therapie ein und veröffentlichte 1969 das Standardwerk zur Tiergestützten Therapie „Pet-Oriented Child Psychotherapie“ (vgl. Kuhn 2012, S. 39f.). Seit der Jahrtausendwende scheint sich die Anwesenheit von Tieren im Schulunterricht erhöht zu haben; Beetz beobachtete einen vermehrten Einsatz und verstärktes Interesse an dem Thema Tiergestützte Pädagogik (vgl. Beetz 2015, S. 13). Obwohl Hunde unterstützend bei Menschen jeden Alters effektiv eingesetzt werden können, wie z. B. in Seniorenheimen, Krankenhäusern oder Wohngruppen, finden sich doch nach Marhofer (zitiert von Beetz) mit mehr als 40% die meisten Hunde an Förderschulen (vgl. ebd., S. 20). 2. Was ist ein Schulhund? Die meisten Schulhunde sind Privathunde, die eine hundeführende Lehrkraft im Unterricht begleiten. Als Grundlage dafür dient ein pädagogisches Konzept, das den Einsatz des Hundes in der Schule regelt und die schulischen Voraussetzungen beinhaltet. Individuelle Voraussetzungen des Hundes und der SchülerInnen werden ebenfalls darin berücksichtigt. Der Schulhund unterstützt im Unterricht die pädagogische Erziehungsarbeit der Lehrkraft und hilft dabei, dass die SchülerInnen in ihrer sozial-emotionalen Kompetenz gefördert werden. Weitere zu fördernde Bereiche sind die Kommunikation und die psychische und physische Gesundheit der SchülerInnen. Der Schulhund muss ruhig, gut erzogen und stressresistent sein. Er darf keine Anzeichen von Aggressionen zeigen und sein Gesundheitszustand muss regelmäßig und sorgfältig überprüft und dokumentiert werden (vgl. Konzept für das Projekt „Schulhund“ an der Willy-Brandt- Gesamtschule 2010, S. 4). Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 3
3. Warum ein Schulhund an der Wilhelm-Busch-Schule?
„Die allgemeine Wirkung von Hunden auf Menschen ist bekannt - das Wohlbefinden wird
gesteigert und damit die Lebensfreude. Hunde begegnen jedem Menschen wertfrei - sie zeigen
ihre Kooperationsbereitschaft und Anpassungsfähigkeit ohne Vorbehalte. Ihr natürliches
Bedürfnis nach Zuwendung lässt unvoreingenommen und vertrauensvoll körperliche Nähe zu.
Die Bindung zum Menschen macht sie zum idealen sozialen Partner auf vier Pfoten. Hunde
können auf verschiedenen Ebenen wertvolle Vermittler sein - als sozialer Katalysator und
Medium, als Eisbrecher und Brückenbauer, als Co-Therapeut und Animateur sind sie
unentbehrliche Begleiter mit unterstützender Funktion in vielen Bereichen des menschlichen
Lebens geworden.“ (Röger-Lakenbrink 2011, S. 87).
Die Schülerschaft der Wilhelm-Busch-Schule setzt sich aus Kindern mit den unterschiedlichsten
familiären, kognitiven und emotional-sozialen Voraussetzungen zusammen. SchülerInnen mit den
sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfen Lernen, Sprache und Emotional-soziale
Entwicklung lernen hier gemeinsam. In der Mittelstufe, dem Einsatzbereich des Schulhundes, sind
die Kinder und Jugendlichen zwischen 11 und 14 Jahren alt und besuchen die Klassenstufen fünf
bis sieben. Viele SchülerInnen zeigen Verhaltensauffälligkeiten und / oder haben bereits häufig
negative Lernerfahrungen gemacht. Das Selbstbewusstsein vieler Kinder leidet darunter und
beeinflusst wiederum ihre Erfahrungen und ihr Verhalten in der Schule. In den Klassen treffen
daher verschiedene individuelle Bedürfnisse aufeinander. Diese können durch die Begleitung
durch einen Schulhund aufgefangen werden:
Ziele für den Einsatz eines Schulhundes in der Mittelstufe der Wilhelm-Busch-Schule sind die
Stärkung der Persönlichkeit der SchülerInnen, Gesundheitsprävention, der Abbau von
Schulängsten, die Erweiterung der kognitiven Fähigkeiten und ein achtsamer und respektvoller
Umgang mit der Natur und ihren Lebewesen (vgl. Schulhundkonzept der GGS Styrum). Im
Folgenden werden einige Wirkungsbereiche des Schulhundes vorgestellt.
3.1. Klassenklima
Die Anwesenheit eines Hundes im Klassenraum wirkt sich positiv auf die SchülerInnen und damit
auf das Klassenklima aus. Der positive Einfluss bezieht sich nach Röger-Lakenbrink et. al. auf die
Bereiche der (Lern-) Motivation, Aktivierung, Stressreduktion, und die soziale Interaktion (vgl. 2011,
S. 88). Streicheleinheiten und Lese- und Kuschelpausen werden gezielt zur Belohnung, Motivation
und Entspannung eingesetzt.
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 43.2. Umgang mit Aggressionen Schulhunde reagieren sensibel auf Aggression und ziehen sich zurück. So zeigen sie auf eine neutrale Weise, dass sie sich nicht wohlfühlen. Das können Kinder meist gut annehmen und ihr Verhalten regulieren. Kinder mit auffälligem Sozialverhalten finden in dem Hund so einen Kommunikationspartner, dem sie nicht aggressiv begegnen müssen. Sie werden aus der Isolation herausgeholt, die ein aggressives Verhalten oft mit sich bringt. Regeln, die zum Umgang mit dem Hund gehören, einzuhalten, ist für die meisten Kinder kein Problem. Kotrschal und Ortbauer (2003) kamen bei ihrer Forschung zu dem Schluss, dass die Anwesenheit eines Hundes in einer heterogenen Grundschulklasse den Klassenzusammenhalt wachsen lässt und extremes Verhalten, wie Aggressionen oder Hyperaktivität, zurückgeht. Außerdem wurden verschlossene Kinder besser in die Gruppe integriert und die Aufmerksamkeit für die Lehrkraft und den Lernstoff erhöhte sich (vgl. Kotrschal 2003, S. 147). 3.3. Kommunikation SchülerInnen können im Umgang mit dem Schulhund ihre Kommunikationsfähigkeit stärken und eine sensible Wahrnehmung der Körpersprache des Hundes erlernen (vgl. Roger-Lakenbrink 2011, S. 88 & Beetz 2015, S. 46f.). Der Hund wird außerdem zum Gesprächsanlass und Gesprächsgegenstand unter den SchülerInnen. Das ist zu begrüßen, weil sehr stille Kinder zum Sprechen und Erzählen angeregt werden. Die Sprechfreude und Sprechgeschwindigkeit können sich so verbessern. Der Schulhund wird an der Wilhelm-Busch-Schule ausdrücklich nicht in sprachtherapeutischen Situationen eingesetzt. Die gezielte Kommunikation erfordert ebenfalls eine erhöhte Konzentration, z.B. wenn es um die richtigen Kommandos für den Hund geht. 3.4. Grob- und Feinmotorik Durch den taktilen Umgang mit dem Hund, wie das Streicheln und Füttern, kann sich die Grob- und Feinmotorik der Kinder verbessern. Sie erleben weiches Fell, leinen den Hund an, öffnen den Futterbeutel und lernen ein Leckerchen richtig zu füttern. Einige Kommandos an den Hund werden durch Handzeichen ergänzt, die von den SchülerInnen deutlich gezeigt werden müssen, um mit dem Hund zu kommunizieren. Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 5
3.5. Sensibilität fördern
Ein Schulhund reagiert auf liebevolle Zuwendung mit positiven Reaktionen. So können auch
SchülerInnen, die sonst wenig Zuneigung erfahren und vielleicht häufig impulsiv oder unbeherrscht
auftreten, lohnende Handlungsalternativen erleben. In der Interaktion mit dem Hund müssen sich
die Kinder auf den Hund einstellen und seine Körpersprache lesen lernen.
3.6. Akzeptanz anderer
Die Kinder stärken ihre Empathie, ihr Verantwortungsgefühl und das Regelverständnis und damit
ihre soziale und emotionale Intelligenz, wenn sie in die Versorgung des Schulhundes eingebunden
werden. Sie müssen auch akzeptieren, dass der Schulhund selbst entscheidet, wann er
gestreichelt werden will oder wann er seine Ruhe haben möchte. Das Akzeptieren seiner
Bedürfnisse ist ein wichtiges Lernziel für die SchülerInnen. Diese Erkenntnisse aus dem Umgang
mit dem Schulhund können auf die Interaktion mit den anderen Kindern der Klasse und Schule
übertragen werden.
3.7. Förderung des Selbstbewusstseins
Eine gelungene Kommunikation mit dem Schulhund setzt ein klares Auftreten der SchülerInnen
voraus. Sie können sich so als selbstwirksam erfahren. Auch ihre Konzentration und die Freude
am Schulbesuch können gefördert werden. Ein Hund bietet den Schülerinnen zudem
unvoreingenommene Zuwendung und er nimmt sie wertfrei an (vgl. Röhl 2017, S. 121 ff.).
Ängstliche SchülerInnen können ihr Kontaktverhalten und ihre Selbstsicherheit schulen, wenn sie
sich nach einiger Zeit trauen, Kontakt aufzunehmen.
4. Grundvoraussetzungen
4.1. Schule
Da es sich laut dem Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen bei
einem Hund nicht um ein Lernmittel im Sinne des § 30 Abs. 1 SchulG handelt, entscheidet die
Schulleitung über den Einsatz eines Schulhundes im Rahmen der schulischen Eigenverantwortung
(vgl. §3 Abs. 1 und 2 SchulG); vgl. MSW NRW 2015, S. 1, Punkt 1.
Die Schulleitung der Wilhelm-Busch-Schule unterstützt den regelmäßigen Einsatz des
Schulhundes Floki im Unterricht von Frau Olson ab dem Schuljahr 2020/21. Im weiteren Verlauf
sind auch der Einsatz in anderen Klassen, als Lesehund und ein AG-Angebot denkbar.
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 6Laut der Handreichung zu Rechtsfragen zum Einsatz eines Schulhundes (MSW NRW 2015, S. 1, Punkt 1) werden die Schulkonferenz und weitere Mitwirkungsgremien, wie Klassenpflegschaft, Schulpflegschaft und Lehrerkonferenz im Sinne einer guten Zusammenarbeit an der Entscheidung beteiligt. Ebenso wird der Schulträger beteiligt und über die in der Schule getroffenen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz informiert. Die geltenden Hygienemaßnahmen werden für den Einsatz des Schulhundes eingehalten (siehe „Hygieneplan und Infektionsprävention“). Auch das Kollegium der Wilhelm-Busch-Schule und die Eltern der Schülerinnen von Frau Olson sollen mit dem Einsatz eines Schulhundes einverstanden sein und über die Pläne informiert werden. Dem Kollegium wurde im Rahmen einer Lehrerkonferenz am 01.10.2020 das Schulhundkonzept vorgestellt. Das Einverständnis der Eltern wurde bereits abgefragt. Die Eltern werden auf einem Elternabend am 26.10.2020 zudem über die konkreten Abläufe informiert und können Fragen und Bedenken äußern. Die SchülerInnen sind in der Schule auch im Umgang mit dem Schulhund unfallversichert: „Soweit die Schulleitung unter Beteiligung der schulischen Mitwirkungsgremien über den Einsatz eines Schulhundes im Unterricht entschieden hat, unterliegen die Schülerinnen und Schüler dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz (vgl. § 2 Abs. 1 Nr. 8b SGB VII).“ Floki ist über die Halterin durch eine „Tierhalterhaftpflichtversicherung“ haftpflichtversichert (MSW NRW 2015, S. 2, Punkt 5 Unfallversicherung). 4.2. Kinder und Jugendliche Die SchülerInnen werden vor dem konkreten Einsatz des Schulhundes sorgfältig geschult (siehe „Schulung und Verhalten der SchülerInnen“). Die Klasse MS 1 wird auf den Umgang mit dem Hund, seine Bedürfnisse und seine Körpersprache vorbereitet. Es werden gemeinsame Regeln erarbeitet. Auch das Thema Angst vor Hunden wird dabei behandelt. Alle SchülerInnen üben wiederholt, wie sie sich richtig auf den Hund zubewegen, sich ihm nähern und ihn streicheln können, sodass ein natürlicher Umgang mit dem Hund entstehen kann. Der Einsatz des Hundes in der Schule erfolgt nur im Team Hund /Hundeführerin. Frau Olson wird stets darauf achten, dass sich der Schulhund wohl fühlt und ihn vor Stresssituationen schützen: „Das artgemäße Verhaltensbedürfnis der Tiere darf nicht eingeschränkt werden. Unsachgemäße Behandlung oder Haltung fördern die Aggressivität der Tiere und erhöhen so die Sicherheitsrisiken.“ (MSW RISU-NRW 2017, S. 61, I 7.1). Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 7
4.3. Lehrkraft Frau Olson Zwischen der Hundehalterin Frau Olson und dem Hund besteht eine enge und vertrauensvolle Beziehung. Bereits seit dem Welpenalter wird die Entwicklung und Erziehung von Floki durch TrainerInnen eines Hundevereins unterstützt. Theoretisches und praktisches Wissen zum Umgang mit Hunden liegt bei der Hundeführerin vor. Eine Familienanbindung ist ebenfalls seit der Geburt des Hundes im Haushalt des Züchterehepaars gegeben. Frau Olson trägt die Verantwortung für die medizinische Versorgung des Hundes und beachtet relevante Tierschutzaspekte. Deren Einhaltung ist wichtig für die Vermeidung von Unfällen. 4.4. Schulhund Floki Floki ist ein 2,5 Jahre alter, gepflegter und gesunder Golden Retriever-Rüde, der seit Mitte Juli 2018 bei Frau Olson und ihrem Mann lebt. Floki und seine fünf Geschwister sind bis dahin sehr behütet und familiär bei einem Züchterehepaar aus Wuppertal aufgewachsen. Seine positive Wirkung auf Kinder und Erwachsene konnte bereits im privaten Bereich sowie auch bei kleineren Einsätzen an der Ausbildungsschule von Frau Olson wahrgenommen werden. Floki ist ausgeglichen und stressresistent und zeigt keinerlei aggressive Tendenzen. Er bellt sehr selten und zieht sich bei Unsicherheit zurück. Futter nimmt er vorsichtig und sanft aus den Fingern. Er ist menschen- und kinderfreundlich (vgl. MSW NRW 2015, S. 1, Punkt 2) sowie leinenführig, abrufbar und beherrscht die Grundkommandos. Zudem hat er keinen Herden- oder Jagdtrieb und ist gut sozialisiert. Als Golden Retriever ist er rassetypisch nicht schreckhaft oder geräuschempfindlich gegenüber lauten Geräuschen oder rennenden Kindern. Floki kann gut alleine sein und könnte daher über einen gewissen Zeitraum auch alleine im Klassenraum oder einem Nebenraum verbleiben. Die Kommunikation zwischen Floki und der Hundeführerin verläuft überwiegend nonverbal, bzw. ist durch kurze Kommandos geregelt, sodass der Unterricht dahingehend weitestgehend störungsfrei verlaufen kann. Er wird regelmäßig geimpft, entwurmt und einer Tierärztin vorgestellt. Er wird außerdem regelmäßig auf Parasiten (Zecken, Flöhe) untersucht und vorsorglich dagegen geschützt (vgl. MSW NRW 2015, S. 2, Punkt 4). Frau Olson als Hundeführerin ist Mitglied des HSV Duisburg- Rehwiese e-V., der dem DVG (Deutscher Verband der Gebrauchshundsportvereine e.V.) und VDH (Verband für das Deutsche Hundewesen) angehört. Floki hat im September 2020 zusammen mit der Hundeführerin Frau Olson die Ausbildung zum sogenannten „verkehrssicheren Begleithund“ nach der Prüfungsordnung für die internationalen Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 8
Gebrauchshundeprüfungen der FCI (Federal Cynologique Internationale) im HSV Duisburg
Rehwiese e.V. erfolgreich abgelegt, die u.a. eine Unbefangenheitsprobe vorsieht.
5. Hygieneplan und Infektionsprävention
5.1. Hygiene / Gesundheitsvorsorge Hund
• der Klassenraum ist ausreichend groß und wird regelmäßig gelüftet (vgl. Landeszentrum
Gesundheit NRW 2015, S. 3)
• im Klassenraum ist die Möglichkeit zum regelmäßigen Händewaschen gegeben
(fließendes Wasser, Seifenspender, Papiertücher); vgl. MSW NRW 2015, S. 2, Punkt 4
• der Klassenraum wird ggf. von der Hundeführerin zusätzlich gereinigt
• Desinfektionsmittel und Reinigungsmittel sind im Raum vorhanden; Gefäße, Decken und
Spielzeug für den Hund werden separat aufbewahrt und regelmäßig gereinigt (vgl.
Landeszentrum Gesundheit NRW 2015, S. 3)
• der Schule liegt stets ein tierärztliches Gesundheitsattest, der Impfausweis in Kopie und ein
Entwurmungsprotokoll vor (vgl. RISU-NRW 2017, S. 87, II 3.1)
• das Gesundheitsamt der Stadt Mülheim an der Ruhr verwies in einem Telefonat am 29.06.2020
auf die „Ergänzung zum Rahmen-Hygieneplan - Anforderungen an eine Tierhaltung in
Gemeinschaftseinrichtungen“ des Landeszentrums Gesundheit NRW und nannte eine
regelmäßige Gesundheitskontrolle des Schulhundes durch einen Tierarzt als Voraussetzung für
eine zeitlich begrenzet aber regelmäßige Tierhaltung in der Schule: „Die Tiere sind regelmäßig
eure veterinärmedizinischen Kontrolle zu unterziehen […]. (ebd. 2015, S. 2)
• die Gesundheitsfürsorge für einen Schulhund umfasst nach der „Ergänzung zum Rahmen-
Hygieneplan“ unter anderem:
• „einen vollständigen Impfschutz,
• ein zeitnahes Entfernen von Ektoparasiten wie Flöhe, Zecken, Läuse und Milben,
• sofortige Tierarztbesuche bei Krankheitsanzeichen,
• eine regelmäßige Entwurmung,
• eine artgerechte Haltung.“ (ebd.)
• für die Gesundheitsfürsorge übernimmt die Hundeführerin die Verantwortung
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 95.2. Schulung und Verhalten der SchülerInnen
Die SchülerInnen werden auf den Einsatz des Schulhundes vorbereitet (vgl. MSW NRW 2015, S.
2, Punkt 4). Zunächst lernen sie wichtiges Grundwissen zum Thema Hund und erarbeiten dann
konkretes Umgangswissen für den Kontakt mit dem Schulhund. Die wichtigen Regeln zum
Umgang mit Hunden im Allgemeinen und Floki im Speziellen werden schriftlich als auch durch
Bilder festgehalten und als Rituale etabliert (vgl. Schulhundkonzept der GGS Styrum):
• Vor und nach dem Streicheln wasche ich mir die Hände.
• Floki entscheidet alleine, zu wem er geht.
• Floki hat seine eigene Decke. Hier hat er Pause.
• Es ist immer nur ein Kind bei Floki und darf ihn streicheln.
• Ich darf Floki ein Kommando geben, wenn ich die Leckerchen von Frau Olson bekommen
habe. Ein Leckerchen darf nicht wieder weggenommen werden.
Um den Einsatz von Floki zu dokumentieren und zu evaluieren, wird ein Fragebogen für die
SchülerInnen eingesetzt. Die Kinder sind insgesamt dazu angehalten, empathisch, rücksichtsvoll
und artgerecht mit dem Schulhund umzugehen. So können Unfälle, z.B. solche, die beim Spielen
entstehen könnten, vermieden werden.
5.3. Zugangsbeschränkungen
Der Schulhund hat keinen Zugang zu anderen Klassenräumen, in denen er nicht eingesetzt wird
sowie zur Schulküche oder anderen Räumen, in denen Lebensmittel zubereitet werden.
6. Ziele der Arbeit mit Floki
Floki soll den Unterricht der Hundeführerin Frau Olson begleiten. Die Lerngruppe, die
Klassenlehrerin und der Schulhund sollen in einem begrenzten zeitlichen und räumlichen Rahmen
gemeinsam lernen. Floki soll Frau Olson zunächst an einem Tagen in der Woche im Unterricht und
in einer Lerngruppe begleiten. Die SchülerInnen sollen gut für die Begegnung mit dem Schulhund
ausgebildet sein, sodass sie eine Beziehung zu ihm aufbauen können. Dann können sie von
seiner regelmäßigen Anwesenheit profitieren und ihre soziale und emotionale Kompetenz
erweitern. Der Schulhund soll ihnen Aufmerksamkeit und Wärme schenken und so den
Lebensraum Schule aufwerten. Innerhalb der Klasse soll das soziale Gefüge durch Floki gestärkt
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 10werden. Auf individueller Ebene können die SchülerInnen ihre verbale und nonverbale
Kommunikationsfähigkeit verbessern.
Die Kinder lernen individuell und in der Klassengemeinschaft Verantwortung für sich und das
eigene Verhalten sowie für den Hund zu übernehmen (vgl. Konzept für das Projekt „Schulhund“ an
der Willy-Brandt-Gesamtschule 2010, S. 8).
Konkret kann die gelenkte Interaktion mit Floki als Anreiz oder Belohnung für einzelne
SchülerInnen eingesetzt werden. Mit allen Kindern kann eine Beschäftigung mit ihm als Auszeit zur
Entspannung und „Warm-up“ oder „Cool-down“ genutzt werden. Zum Beispiel kann sein
Futterbeutel ein paar Mal im Klassenraum für ihn versteckt werden, sodass er ihn suchen muss.
7. Einsatz im Unterricht
• Floki soll an einem Tagen in der Woche eingesetzt werden. In der Klasse soll er sich ohne Leine
bewegen; auf den Fluren wird er angeleint. In den Pausen ist Floki nicht auf dem Schulhof.
• Floki konnte die Räumlichkeiten bereits ohne SchülerInnen kennenlernen und sich
zurechtfinden. Er hat einen eigenen Ruheplatz, auf dem er ungestört liegen kann.
• In den ersten Tagen wird es eine vorsichtige Annäherung zwischen Floki und den Kindern
geben. Er darf sich frei im Klassenraum bewegen und sich streicheln lassen. Die Kinder können
ihn mit Leckerchen begrüßen und verabschieden, was ritualisiert geschehen wird. So gibt es
einen festen Handlungsrahmen und der Hund und die Kinder sammeln positive Erfahrungen.
• Ein Wasserdienst wird für Floki eingerichtet. Die SchülerInnen, die damit an der Reihe sind,
kümmern sich um frisches Wasser für den Hund.
• Als Schulhund kann Floki in der Klasse MS1 mit seiner Anwesenheit einen positiven Einfluss auf
die SchülerInnen ausüben. Er bietet Trost, Begleitung und Beruhigung. Die Kinder werden durch
die theoretische Arbeit zum Thema, die neu aufgestellten Regeln zum Umgang mit dem Hund
und der Ausübung eines weiteren Klassendienstes eingebunden. Sie werden dazu angehalten,
darauf zu achten, dass kein Müll und Lebensmittel auf dem Boden liegen und frisches Wasser
bereitsteht. Ebenso muss aufmerksam darauf geachtet werden, dass die Lautstärke im Raum
angemessen bleibt. Dieses Verhalten wird sich wahrscheinlich schnell von selbst einstellen.
• Die Beschäftigung mit Floki kann zudem als Belohnung und Motivation eingesetzt werden
(Leckerchen geben, streicheln, neben dem Hund sitzen).
• Ist Floki der Lerngegenstand bestimmter Stunden können die Kinder zusammen mit dem Hund
üben, Kommandos selbstsicher und deutlich zu geben oder ihre Gefühle über den Hund zu
verbalisieren.
Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 11• Floki kann auch im Bereich der Leseförderung eingesetzt werden. Leseschwache Kinder können dem Hund unter Aufsicht vorlesen und finden in ihm einen unvoreingenommenen und geduldigen Zuhörer. Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 12
8. Literatur Beetz, A. (2015): Hunde im Schulalltag. Grundlagen und Praxis. 3.Auflage. München: Reinhardt. Konzept für das Projekt „Schulhund“ an der Willy-Brandt-Gesamtschule Mülheim (2010) Kotrschal, K.; Ostbauer, B. (2003): Behavioral effects of the presence of a dog in a classroom. In: Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of The Interactions of People & Animals, 16.2003, Heft 2, S. 147-159. Kuhn I. (2012): Hunde als therapeutische Weggefährten. Gespräche mit Experten über Therapiebegleithunde im therapeutischen Kontext in Theorie und Praxis. Frankfurt / Main: Peter Lang Verlag. Landeszentrum Gesundheit NRW (2015): Ergänzung zum Rahmen-Hygieneplan - Anforderungen an eine Tierhaltung in Gemeinschaftseinrichtungen. zu finden unter: https://www.lzg.nrw.de/_php/login/dl.php?u=/_media/pdf/service/Pub/krankenhaushygiene/ 2c_kinder_und_jugendeinrichtungen_Merkblatt_Tierhaltung_20150121.pdf zuletzt aufgerufen am 29.06.2020 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (215): Handreichung - Rechtsfragen zum Einsatz eines Schulhundes. zu finden unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulgesundheitsrecht/Schulhund/Allgemeine-Hinweise- Schulhund.pdf zuletzt aufgerufen am 20.06.2020 Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2017): Richtlinien zur Sicherheit im Unterricht an allgemeinbildenden Schulen in Nordrhein-Westfalen (RISU-NRW) zu finden unter: https://www.schulministerium.nrw.de/docs/Recht/Schulrecht/Erlasse/02_RiSU-NRW_2017.pdf zuletzt aufgerufen am 20.06.2020 Röger-Lakenbrink, I. (2011): Das Therapiehunde-Team. Ein praktischer Wegweiser. 5. Auflage. Nerdlen/ Daun: Kynos. Röhl, T. (2017): Wohlwollende Zuhörer. Lesehunde in Schulen als Quasi-Akteure. In: Burzan, N.; Hitzler, R. (Hrsg.): Auf den Hund gekommen. Interdisziplinäre Annäherung an ein Verhältnis. Wiesbaden: Springer. Schulhundkonzept der GGS Styrum (Mülheim an der Ruhr) Schulhundkonzept an der WBS Ann-Katrin Olson Oktober 2020 13
Sie können auch lesen