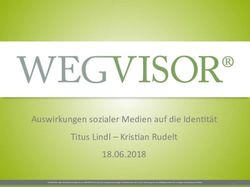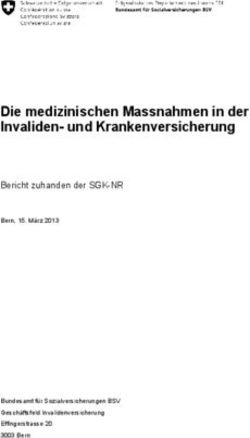Vielfältige Tierwelt in Gossau
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vielfältige Tierwelt in Gossau
Dank Landschaftsentwicklungskonzept LEK und Vernetzungsprojekt
und dank sachgerechter Bewirtschaftung durch die Landwirte und Waldbesitzer
bietet Gossau Lebensraum für viele Tierarten
Foto: HSR Kasper Ammann
Gemeinde Gossau, Landschaftsvorstand Heiri Wintsch
HSR Hochschule für Technik Rapperswil, Peter Bolliger und Marco Bertschinger
André Rey, Tierökologe Zürich
1Inhaltsverzeichnis
Säugetiere……………………………… Feldhase 3
Vögel Distelfink 4
Dorngrasmücke 5
Goldammer 6
Grünspecht 7
Kiebitz 8
Neuntöter 9
Rohrammer 10
Sumpfrohrsänger 11
Teichrohrsänger 12
Reptilien Blindschleiche 13
Waldeidechse 14
Libellen Blauflügel-Prachtlibelle 15
Frühe Heidelibelle 16
Gefleckte Smaragdlibelle 17
Kleine Königslibelle 18
Kleiner Blaupfeil 19
Spitzenfleck 20
Südlicher Blaupfeil 21
Westliche Keiljungfer 22
Zweigestreifte Quelljungfer 23
Heuschrecken Feldgrille 24
Grosse Goldschrecke 25
Lauchschrecke 26
Langflügelige Schwertschrecke 27
Roesels Beisschrecke 28
Sumpfgrashüpfer 29
Sumpfgrille 30
Sumpfschrecke 31
Warzenbeisser 32
Tagfalter Aurorafalter 33
Brauner Feuerfalter 34
Dunkler Dickkopffalter 35
Gewöhnliches Widderchen 36
Kleiner Würfelfalter 37
Malvendickkopffalter 38
Märzveilchenfalter 39
Mauerfuchs 40
Schachbrett 41
Schwalbenschwanz 42
Senfweissling 43
Silberscheckenfalter 44
Skabiosenscheckenfalter 45
Tagpfauenauge 46
Violetter Silberfalter 47
Die vorliegende Broschüre zeigt diejenigen Tierarten in Gossau, welche speziell gefördert werden sollen. Nicht
aufgeführt sind alltägliche Arten, wie Amseln und Meisen, auch wenn diese ein wesentlicher Teil der
Artenvielfalt sind und uns erfreuen.
Die Broschüre wendet sich an die Landwirte, Waldbesitzer, Gemeindearbeiter und auch an die Gartenbe-sitzer
in Gossau. Sie zeigt die Tierarten und ihre Ansprüche und gibt Hinweise, mit welchen Massnahmen diese
gefördert werden können. Viele dieser Massnahmen kommen mehreren Tierarten zu gut.
Beispiele sind:
Anlage von Buntbrachen, dornenreichen Hecken und extensiv genutzten Wiesen
Gestaffelter Schnitt von Wiesen und stehen lassen von Altgrasstreifen
Lichte Wälder und Hochstammobstgärten mit alten Bäumen erhalten und fördern
Stufige Waldränder, Laub- und Asthaufen schaffen
Schilf- und Hochstaudenfluren abschnittsweise schneiden, so dass die Hälfte über den Winter stehen
bleibt
Gestalten von naturnahen Gärten und Tolerieren von Brennesselbeständen
Belassen von Krausäumen und abgeblühter Pflanzen in Gärten und Parks
2Säugetiere
Feldhase
Lepus europaeus
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: G. Klaut
Verbreitung Der Feldhase besiedelt alle Teile der Schweiz. Schwer-
punkt ist das Mittalland und die klimatisch begünstigten
Tallagen der Alpen und des Jura. Die Art steigt bis in Hö-
hen von 1500 m.ü.M.
Ökologie, Biologie Der Feldhase ist vorwiegend dämmerungs- und nachtak-
tiv. Seine Nahrung besteht aus verschiedenen Pflanzen-
teilen, welche nach einmaligen Durchlaufen des Verdau-
ungstraktes als Kot erneut gefressen wird. Die Weibchen
des Feldhasen sind sehr produktiv und können 3-5 mal
pro Jahr Junge werfen (total ca. 10/Jahr). Die Art ist nicht
territorial.
Lebensraum Der Feldhase bewohnt offene Acker- und Wiesenbauge-
biete welche mit Hecken, kleinen Wäldchen und Brach-
land durchzogen sind.
Massnahmen Förderung von strukturreichen Acker- und Wiesen-
baugebieten. Anlage von Buntbrachen, Hecken und ex-
tensiv genutzten Wiesen.
3Vögel
Distelfink
Carduelis carduelis
Foto: Peter Bolliger
Verbreitung Der Distelfink kommt in der ganzen Schweiz vor und steigt
im Jura bis 1000 m, in den Alpen bis ca. 1400 m (lokal bis
1900 m). Verbreitungslücken bestehen vor allem in den
Zentralalpen und in den Südtälern.
Ökologie, Biologie Der Distelfink hält sich gerne in der Nähe von Siedlungen
auf. Er zeigt eine starke Bindung an Wildkrautfluren und
Ruderalvegetation, wo er die nötigen Sämereien findet. Er
baut sein Nest in Astgabeln in der Krone von mittelhohen
Laubbäumen
Lebensraum Der Distelfink nistet an Waldrändern, in Hochstamm-
Obstgärten und in Siedlungen. Auf der Suche nach Säme-
reien, seiner Hauptnahrung, streift er selbst zur Brutzeit
weit umher. Sämereien verzehrende Distelfinken beo-
bachtet man in blütenreichen Wiesen, auf Brach- und Ru-
deralflächen, in Gärten oder entlang von Wegen mit
Krautsäumen.
Massnahmen Samenangebot vermehren durch Belassen von Kraut-
säumen und -fluren sowie abgeblühter Pflanzen in Gärten
und Parkanlagen, Förderung blütenreicher Wiesen und
Gärten.
4Vögel
Dorngrasmücke
Sylvia communis
Foto: G.Klaut
Verbreitung Die Dorngrasmücke kommt in der ganzen Schweiz in den
tiefen Lagen vor. Die höchtgelegenen Bruznachweise lie-
gen bei ca. 1500 m. Heute ist das ganze Areal nur noch
lückenhaft besiedelt.
Ökologie, Biologie Die Dorngrasmücke ist ein Insektenfresser (Spinnen,
Heuschrecken, Tagfalter) und überwintert südlich der Sa-
hara (Langstreckenzieher). Das Nest wird in niederem
Dornengestrüpp angelegt.
Lebensraum Die Dorngrasmücke ist eine typische Art ungenutzter
Randzonen der offenen Kulturlandschaft. Sie zeigt eine
starke Bindung an dornenreiche Niederhecken welche
von mehrjährigen Krautfluren und Altgrasbeständen um-
geben sind. Die Art ist auf ein reiches Insektenangebot
angewiesen.
Massnahmen Magerwiesen mit niederen Dornenhecken und ausge-
dehnten Krautfluren erhalten (pflegen!) und fördern. Stü-
rungen durch Menschen möglichst gering halten.
5Vögel
Goldammer
Emberiza citrinella
Foto: Markus Jenny
Verbreitung Das Verbreitungsareal der Goldammer in der Schweiz
deckt sich recht gut mit dem Vorkommen von Ackerbau.
Jura und Mittelland sind geschlossen besiedelt, ebenso
die Täler der Zentralalpen. Die Goldammer fehlt dagegen
weitgehend in höheren Lagen der Nordalpen.
Ökologie, Biologie Im Frühling und Sommer lebt die Goldammer von Insek-
ten und deren Larven; nach Abblühen der ersten Kräuter
im Mai/Juni werden Sämmereien immer wichtiger. In
strengen Wintern wandert die Goldammer in den Mittel-
meerraum ab, in schneefreien, milden Wintern bilden sich
Trupps von mehreren dutzend Goldammern, die auf der
Suche nach Sämereien weit umherstreifen und am Abend
in einer Gehölzgruppe nächtigen. Im Frühling sind Gold-
ammern streng territorial und verteidigen ihr Revier durch
anhaltendes Singen.
Lebensraum Die Goldammer besiedelt Hecken, Gehölzstreifen, Wald-
ränder und verwilderte Gärten im bzw. am Rand des Kul-
turlandes. Vereinzelt trifft man sie auch in grossen Verjün-
gungsflächen im Waldesinnern an.
Massnahmen Dichte Hecken und stufige Waldränder erhalten und för-
dern. Die Art lässt sich mit Buntbrachen gut fördern.
6Vögel
Grünspecht
Picus viridis
Foto: G.Klaut
Verbreitung Der Grünspecht ist ein Jahresvogel und kommt in der
ganzen Schweiz bis zur Baumgrenze vor.
Ökologie, Biologie Der Grünspecht ernährt sich von Insekten, insbesondere
von Ameisen bzw. deren Puppen und Larven, die er am
Boden aufspürt. Er brütet in selbstgezimmerten Baumhöh-
len.
Lebensraum Der Grünspecht besiedelt lichte, durch Grasflächen aufge-
lockerte Wälder mit reichem Altholzbestand und angren-
zenden Wiesen. Diese Ansprüche erfüllen Laubholzwäl-
der mit lichten Stellen und Waldwiesen, subalpine Lär-
chenwälder, Auenwälder, Kastanienhaine, Obstanlagen,
Parks und durchgrünte Siedlungsquartiere.
Massnahmen Lichte Wälder und Hochstammobstgärten mit alten Bäu-
men erhalten und fördern.
7Vögel
Kiebitz
Vanellus vanellus
Rote Liste CH: CR
Vom Aussterben bedroht
Foto: Marcel Ruppen
Verbreitung Der Kiebitzbestand ist Ende der Siebzigerjahre drastisch um 80%
auf rund 100 Brutpaare pro Jahr zusammengebrochen. Der Be-
stand verteilt sich auf 25 - 30 Brutplätze in der Schweiz. Die wich-
tigsten davon liegen in Ackerbaugebieten (Wauwilermoos/LU),
Feuchtgebieten (Neeracherried/ZH, Frauenwinkel und Nuolener
Ried/SZ, Auried/FR), revitalisierten Flächen (Flachsee
Unterlunkhofen/AG, Fraubrunnenmoos/BE) und auf Flachdächern
(Flughafen Kloten/ZH, Emmen/LU).
Ökologie, Biologie Der Kiebitz ist von Ende Februar bis im November bei uns anzu-
treffen. Als Kurzstreckenzieher überwintern unsere Kiebitze v.a. an
der Atlantikküste in Frankreich und im Mittelmeerraum.
Die Brutzeit beginnt ab April in Flächen mit kurzer Vegetation. Die
Art macht ein offenes Bodennest und legt 4 gut getarnte Eier. Die
Jungen sind Nestflüchter und auf ein reiches, zugängliches Insek-
tenangebot in weichen, feuchten Böden angewiesen. Die Wirbello-
sen werden aus dem Boden gepickt, Regenwürmer werden mit
dem Fuss aus dem Boden an die Oberfläche geklopft (Imitation
von Regen). Die Kiebitzküken werden im Alter von 35 -40 Tagen
flügge.
Lebensraum Der Kiebitz bevorzugt zur Brutzeit offen, flache Ebenen mit locke-
rer, niedriger Vegetation und möglichst wenigen vertikalen Struktu-
ren wie Büschen, Bäumen, Hecken. Ursprünglich wurden
Seggenriede, Pfeifengraswiesen, feuchte Wiesen und Weiden be-
siedelt. Heute besetzt der Kiebitz zusätzlich Ackerland, Brachland
und kurzrasige Flächen auf Flugplätzen, seltener auch trockenere
Schotter- und Ruderalflächen. Für den Nistplatz wird lückige, kurze
Vegetation bevorzugt. Nach dem Schlüpfen sind für die Jungen
nahrungsreiche Flächen mit Deckung und wenig Hindernissen
wichtig.
Massnahmen Erhalt von Feuchtgebieten und Wiedervernässen von ehemaligen
Feuchtwiesen, Schaffung von temporären Flachgewässern und
nassen Geländemulden mit langer Randlinie. Auf Ackerflächen:
Schutz vor landwirtschaftlichen Maschineneingriffen und Schaffung
eines Angebots an geeigneten, weit gepflanzten Kulturen. Schutz
vor Beutegreifern mit Weidezäunen; Schutz vor Störungen durch
Information, Besucherlenkung, temporäre Wegschliessung und
Leinenpflicht für Hunde.
Autor: ZVS Zürcher Vogelschutz/Birdlife Zürich, Mathias Villiger
8Vögel
Neuntöter
Lanius collurio
Foto: Markus Jenny
Verbreitung Der Neuntöter besiedelt alle Landesteile mit Ausnahme
der alpinen Stufe. Seine dichtesten Bestände findet man
in mittleren Lagen zwischen 800 und 1300 m, wo in Hang-
lagen, die von ihm verlangten Habitat-Requisiten (Hecken,
magere Wiesen, Insektenreichtum) am ehesten anzutref-
fen sind.
Ökologie, Biologie Nester des Neuntöters befinden sich in dichten Hecken,
meistens nur 0,5–1,5 m über Boden. Als spezialisierter In-
sektenjäger verharrt er während Minuten auf immer den-
selben Ansitzen in seinem Revier, namentlich auf Bü-
schen, Pfählen oder Drahtleitungen. Im Stossflug stürzt er
sich vom Ansitz auf seine Beute. Heuschrecken, Käfer,
kleine Reptilien u.ä. werden erbeutet und später gelegent-
lich im Buschwerk aufgespiesst oder eingeklemmt. Bei
diesen Beutedepots handelt es sich möglicherweise um
„Vorratslager“ für Tage mit schlechter Witterung. Der
Neuntöter brütet jährlich nur einmal; seine Aufenthalts-
dauer im Brutgebiet reicht von Mitte Mai bis Mitte August.
Als „Ostzieher“ überquert der Neuntöter auf seinem Weg
ins Winterquartier in Ostafrika den Balken, Kleinasien und
die Arabische Halbinsel.
Lebensraum Offene Landschaften mit dornenreichen Hecken und in-
sektenreichen, lückigen und/oder kurzhalmigen Wiesen
und Weiden im Umkreis von 100–200 m um den Brutplatz.
Gelegentlich an Waldrändern (Brombeer-Gestrüp) oder in
umfangreichen Waldlichtungen. Wichtig ist ein grosses
Angebot an Insekten und kleinen Wirbeltieren sowie An-
sitzwarten auf Büschen, Bäumen oder Pfählen.
Massnahmen Förderung von dichten, dornenreichen Hecken in extensiv
genutzten, zeitweise kurzhalmigen Wiesen und Weiden.
9Vögel
Rohrammer
Emberitza schoeniclus
Foto: G.Klaut
Verbreitung Die Rohrammer bewohnt die niederen Lagen des Mittel-
landes. Im Jura besiedelt die Art die Seeufer und Feucht-
gebiete der Talsohlen, in den Alpen findet man sie nur in
den grossen Tälern. In der Südschweiz brütet die Rohr-
ammer nur in der Magadinoebene. Die Art steigt selten
über 800 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Art baut das Nest bevorzugt in Riedwiesen. Das Nest
wird am Boden angelegt. Die Nahrung besteht im Sommer
vorwiegend aus Spinnen und Insekten. Im Winter ernährt
sich der Kurzstrecken-Teilzieher hauptsächlich von Gras
und Schifsamen.
Lebensraum Die Rohrammer ist eine typische Art der Feuchtgebiete.
Sie besiedelt Riedwiesen und Schilfbestände die mit ein-
zelnen Büschen und Bäumen durchsetzt sind.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von natürlichen Feuchtgebieten
und Gewässerufern insbesondere von Riedwiesen und
Schilfröhrricht. Die Riedwiesen sollen traditionell im Sep-
tember gemäht werden. Wichtig für die Nahrungsgrundla-
ge der Rohrammer ist das Belassen von Altgrasstreifen
(Insekten für die Aufzucht der Jungen). Der Schnitt der
Schilff- und Hochstaudenfluren soll im Herbst abschnitt-
weise alternierend zur Hälfte erfolgen, damit immer ein
Teil über Winter stehen bleibt. Einzelne Büsche und Bäu-
me in Feuchtgebieten erhalten und fördern.
10Vögel
Sumpfrohrsänger
Acrocephalus palustris
Foto: G.Klaut
Verbreitung Der Sumpfrohrsänger bewohnt die Seen- und Flussgebie-
te der Nordschweiz und steigt selten über 1000 Meter auf.
Südlich der Alpen gibt es nur wenige Vorkommen der Art.
Ökologie, Biologie Die Art baut das Nest bevorzugt in Hochstaudenfluren.
Das Nest wird meist zwischen die Halme von Spierstau-
den oder Brennesseln gefochten. Früher brütete die Art
auch in Getreidefeldern. Die Nahrung besteht aus Spin-
nen und Insekten.
Lebensraum Der Sumpfrohrsänger ist typisch für naturnahe Fluss- und
Seeufer. Er brütet aber auch fern von Gewässern, wenn
ausreichend Hochstaudenfluren mit Spierstaude und
Brennessel vorhanden sind.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von natürlichen Gewässerufern
insbesondere von Hochstaudenfluren. Der Schnitt der
Hochstaudenfluren soll abschnittweise alternierend zur
Hälfte erfolgen. Der Schnitt soll im Herbst vorgenommen
werden.
11Vögel
Teichrohrsänger
Acrocephalus scirpaceus
Foto: Internet unbekannter Herkunft
Verbreitung Weit verbreitete Brutvogelart in Europa und der Schweiz un-
terhalb von 700 m ü. M. Lokal auch höher.
Langstreckenzieher, der in Westafrika überwintert. In der
Schweiz von Mitte April bis Mitte Oktober anzutreffen.
Ökologie, Biologie Eine der singfreudigsten Arten, mit beinahe ununterbroche-
nem, rhythmischem Gesang mit regelmässigen Wiederholun-
gen. Sitzt oft schief auf einem Schilfhalm und springt auf die-
sem auf und ab. Die Brutzeit dauert von Mitte Mai bis Mitte
August, wobei das typische napfförmige Nest und den Schilf-
halmen befestigt wird. Entlang des Neuenburgersees erreicht
die Art die höchste Brutdichte der Schweiz (ca. 2000-2500
Paare). Der Teichrohrsänger ist der häufigste Wirtsvogel des
Kuckucks. In erster Linie gehören Zweiflügler, Blattläuse,
Eintags- und Köcherfliegen, Spinnen und kleine Wasser-
schnecken zur Beute des Teichrohrsängers. Ab und zu wer-
den kleine Beeren und Samen aufgenommen
Lebensraum Bewohnt Schilfgebiete und ist deshalb auf das Vorhanden-
sein von Feuchtgebieten angewiesen. Er ist aber eher an-
spruchslos und kann bereits in 50 cm breiten Schilfstreifen
erfolgreich brüten.
Massnahmen Der Teichrohrsänger ist in der Schweiz nicht gefährdet. Die
grösste Gefahr droht ihm, im Verlust von Feuchtgebieten und
Schilfvorkommen, sowohl in der Schweiz, wie auch im Über-
winterungsgebiet und auf dem Zug. Ihm dient das abschnitt-
weise Stehenlassen von Altschilfbeständen, in denen er sich
im Frühjahr nach der Ankunft niederlassen kann. Das neue
Schilfwachstum setzt jeweils erst ab Mai bei warmem Wetter
richtig ein.
(2010: Balzari und Gygax, Vogelarten der Schweiz, Haupt. Bern.)
12Reptilien
Blindschleiche
Angius fragilis
Foto: André Rey
Verbreitung Die Blindschleiche ist in der ganzen Schweiz weit verbrei-
tet und steigt bis in Höhen von über 2000 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Blindschleiche ernährt sich vor allem von Nackt-
schnecken und Würmern. Sie frisst aber gelegentlich auch
Insekten. Das Weibchen bringt die Jungen oft in Laub-
oder Komposthaufen zur Welt.
Lebensraum Blindschleichen leben an luftfeuchten, eher schattigen
Stellen, in Hecken, Waldrändern, an Ufern von Bächen
und Teichen, in Kies- und Tongruben und in Gärten und
Parkanlagen. Man findet sie dort oft unter Steinen oder in
Stein-, Heu- oder Komposthaufen sowie in Holzstapeln.
Massnahmen Strukturreiche Hecken mit Krautsäumen, Laub- und Ast-
haufen erhalten und fördern.
13Reptilien
Waldeidechse
Lacerta vivipara
Foto: André Rey
Verbreitung Die Waldeidechse kommt im gesamten Gebiet der Alpen-
nordseite und der Zentralalpen, bis auf eine Höhe von
3000 m.ü.M. vor. Ihre Verbreitungsschwerpunkte liegen im
Wallis, in den Alpen und Voralpen und im Jura.
Ökologie, Biologie Die Waldeidechse ernährt sich hauptsächlich von Insek-
ten, Regenwürmern und Spinnen. Die Jungen werden le-
bend geboren.
Lebensraum Die Waldeidechse lebt in den tiefen Lagen gern in feuch-
ten Biotopen wie Gräben, Bach- und Teichufer sowie
Moor und Riedgebiete aber auch in lichten Wäldern und
Waldrändern. In der subalpinen Stufe besiedelt sie südex-
ponierte Wiesen. Wichtige Habitatselemente sind vegeta-
tionsfreie Stellen und Kleinstrukturen wie Baumstrünke
und Asthaufen.
Massnahmen Strukturreiche, ungepflegte wechselschattige Wälder und
Waldränder erhalten und fördern. Schaffung von Klein-
strukturen in Feuchtgebieten und entlang von Gräben.
14Libellen
Blauflügel-Prachtlibelle
Calyopteryx virgo
Foto: André Rey
Verbreitung Die Blauflügel-Prachtlibelle kommt an sauerstoffreichen
Fliessgewässern der Äschenregion in der ganzen
Schweiz vor. Sie wird in den tieferen Flussregionen von
der Gebänderten Prachtlibelle abgelöst.
Ökologie, Biologie Die Larve ist auf schnellfliessende, kühle und sauerstoff-
reiche Bäche und Flüsse mit heterogener Sohlenstruktur
angewiesen. Sie ernährt sich vor allem von Insektenlarven
und Krebstieren. Das Larvenstadium dauert zwei Jahre.
Als adultes Insekt stellt sie kleinen Fluginsekten nach. Für
den Schlupfvorgang werden aus dem Wasser ragende
Planzen benötigt. Die männlichen Tiere überwachen von
über das Wasser hängenden Sitzwarten aus ihr Revier.
Lebensraum Die Blauflügel-Prachtlibelle besiedelt offene Uferpartien
von Bächen und Flüssen. Wie erwähnt sind im Wasser
stehende Vegetation (v.a. Weiden, Einzelbüsche und
Hochstauden), Sitzwarten und eine gute Wasserqualität
für die Art bedeutsam.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von naturnahen Fliessgewäs-
sern mit natürlicher Gewässersohle und unverbauten
Ufern. Die Uferbestockung sollte nicht mehr als 40 %
ausmachen, die übrigen Flächen sollten offen bleiben
(Hochstauden Wiesen). Erhaltung einer guten Wasser-
qualität. Mahd der Uferböschungen erst ab Ende August
vornehmen. Gewässerbett-Unterhalt abschnittweise im
Winter (April - Oktober) vornehmen.
15Libellen
Frühe Heidelibelle
Sympetrum fonscolombii
Foto: André Rey
Verbreitung Die Frühe Heidelibelle wird aus allen Landesteilen gemel-
det, am häufigsten fliegt sie jedoch in den tiefen Lagen
des Mittellandes. Die Art zählt zu den Wanderlibellen und
fliegt je nach Witterungsverlauf in unterschiedlicher Anzahl
ein. Daneben pflanzt sich die Art auch fort und überwintert
auch erfolgreich. Nach einer erfolgreichen Fortpflanzung
wandern die geschlüpften Tiere oft ab und suchen sich
neue Fortpflanzungs-gewässer.
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt im Flug über der freien Wasserfläche.
Die Larvenentwicklung dauert 7-9 Wochen. In günstigen
Jahren können bis zu 3 Gegerationen pro Jahr möglich
sein. Die Larven leben räuberisch von Insektenlarven,
Kleinkrebsen und ähnlichem. Die Imagos jagen nach Flug-
insekten. Die Schlüpfperiode der Imagos dauert beinahe
die gesamte Vegetationsperiode und erstreckt sich vom
Mai bis November.
Lebensraum Die Art besiedelt bevorzugt temporäre, flache und gut
besonnte Gewässer wie Grubengewässer oder überflutete
Wiesen und Äcker.
Massnahmen Flachen Pioniertümpel erhalten und neuschaffen, Förde-
rung von überfluteten Wiesen und Äckern.
16Libellen
Gefleckte Smaragdlibelle
Somatochlora flavomaculata
Foto: Hansruedi Wildermuth
Verbreitung Die Gefleckte Smaragdlibelle kommt vor allem im östli-
chen und westlichen Mittelland vor, gelegentlich findet
man die Art auch in den tiefgelegenen Alpentälern und
im Tessin. Die Art steigt in Höhen von etwa 600, seltener
auch bis 1000 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt über flachem Wasser, oft in dichter
Vegetation versteckt. Die Larvenentwicklung dauert drei
Jahre. Larve ernährt sich vor allem von Insektenlarven
und Krebstieren. Als adultes Insekt stellt sie kleinen
Fluginsekten nach.
Lebensraum Fliegt über Flachmooren und Sumpfwiesen mit einge-
streuten Kleingewässern sowie über dicht verwachsenen
Verlandungszonen von Flüssen und Seen, langsam flies-
senden Gräben und Bächen. Die Larvengewässer mit
Schlammgrund können zeitweise austrocknen, ohne dass
die Tiere Schaden nehmen.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von naturnahen Flachmooren,
Sumpfwiesen und Verlandungszonen mit eingestreuten
Tümpeln, Schlenken, Gräben und alten Torfstichen.
17Libellen
Kleine Königslibelle
Anax parthenope
Foto: G. Klaut
Verbreitung Die Kleine Königslibelle ist vor allem im Mittelland verbrei-
tet, seltener findet man sie auch in den tief gelegenen
Voralpentälern, im Wallis und im Tessin. Die wärmelei-
bende Art ist erst seit einigen Jahren im Mittelland boden-
ständig gewreden. Sie steigt bis in eine Höhe von 600,
seltener auch bis 1100 m-ü.M..
Ökologie, Biologie Die Eier werden an lebensed oder totes Pflanzenmaterial
an der Wasseroberfläche abgelegt. Die Larven leben in
sonnigem Flachwasser zwischen untergetauchten Pflan-
zen. Sie haben eine variable, von der Temperatur abhän-
gige Entwicklungszeit von mehreren Monaten bis zu zwei
Jahren. In günstigen Jahren können zwei Gerationen her-
vorgebracht werden. Sowohl die Larve als auch die Libelle
ernährt sich räuberisch von kleinen Wassertieren (Insek-
tenlarven, Kaulquappen) respektive Fluginsekten.
Lebensraum Die Kleine Königslibelle besiedelt schilfbestandene Seen
und Altarme mit Schwimm- und Tauchblattvegetation, so-
wie kleinen Pioniergewässer.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von vegetationsreichen Kies-
grubengewässern, sowie Pioniertümpeln.
18Libellen
Kleiner Blaupfeil
Orthetrum coerulescens
Rote Liste CH: NT
Potentiell gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Der Kleine Blaupfeil kommt in der ganzen Schweiz bis auf
eine Höhe von 1800 m.ü.M. vor. Er ist im ganzen Gebiet
ziemlich selten, einzig im Kanton Zürich ist die Art relativ
häufig.
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt in flache Gewässerbereiche über
Schlamm aus Ton, Lehm, Torf oder Kalk sowie über lo-
ckeren Beständen submerser Vegetation. In fliessenden
Gewässern werden die Eier stets in stömungsarmen Be-
reichen abgelegt. Die Larven haben eine Entwicklungszeit
von zwei Jahren. Sowohl die Larve als auch die Libelle
ernährt sich räuberisch von kleinen Wassertieren (Insek-
tenlarven, Kaulquappen) respektive Fluginsekten. Die Art
ist in der Regel standorttreu, kann aber wenn geeignete
Wanderkorridore vorhanden sind bis zu 60 Km weite Stre-
cken zurücklegen.
Lebensraum Die Art ist typisch für Quellmoore und Hangrieder, wo sie
Quelltümpel, Rinnsale und Hangbächlein besiedelt.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von Hangriedern, Quellmooren
sowie Wiesenbächlein und -Gräben. Erhaltung eines ho-
hen Grundwasserspiegels und Verhinderung von Nähr-
stoffeintrag durch Pufferzonen. Erhaltung von Mähwiesen
in den angrenzenden Gebieten (möglichst wenig Um-
bruchflächen). Ufernahe Vegetation nur einmal im Herbst
mähen. Gewässerunterhalt generell abschnittweise vor-
nehmen.
19Libellen
Spitzenfleck
Libellula filva
Foto: André Rey
Verbreitung Der Spitzenfleck ist im Mittelland verbreitet, kommt aber
zerstreut und nur lokal häufiger vor. In der Westschweiz
sind nur noch zwei Fundorte bekannt Die Art steigt bis in
eine Höhe von 700 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt über seichten Stellen an
Seggenhorsten oder über freier Wasserfläche in der Nähe
eines Röhrichtsaumes. Die Larvenentwicklung dauert
zwei Jahre. Sowohl die Larve als auch die Libelle ernährt
sich räuberisch von kleinen Wassertieren (Insektenlarven,
Kaulquappen) respektive Fluginsekten.
Lebensraum Der Spitzenfleck ist ein typischer Bewohner der Auen von
Tieflandflüssen. Er besiedelt eher grosse, saubere und
nicht zu warme, vegetationsreiche stehende oder langsam
fliessende Gewässer mit guter Besonnung und freier
Wasserfläche. Weiter scheinen Uferröhrichte und wald-
ähnliche Partien für sein Vorkommen nötig zu sein.
Massnahmen Partielle Auslichtung des Baumbestandes an Auengewäs-
sern um die Beschattung des Uferröhrrichts gering zu hal-
ten (südexponierte Seite). Uferpartien abschnittweise im
Herbst mähen. Pufferzonen ausscheiden zur Verhinde-
rung von Nährstoffeintrag. Gewässerunterhalt, insbeson-
dere die Mahd der krautigen Uferpartien abschnittweise
vornehmen. Das Gewässer sollte frei von Graskarpfen
gehalten werden.
20Libellen
Südlicher Blaupfeil
Orthetrum brunneum
Foto: André Rey
Verbreitung Der Südliche Blaupfeil ist vor allem im wärmeren Mittel-
land verbreitet, besonders entland der Flusstäler von Aa-
re, Reuss und Thur. Lokal kommt die Art auch im Wallis
und Tessin vor.
Ökologie, Biologie Die Männchen setzen sich gerne an vegetationsfreie Stel-
len am Ufer. Die Larven leben eingegraben im feinen
Grund des Ufers, ihre Entwicklung dauert 2 Jahre. Sowohl
die Larve als auch die Libelle ernährt sich räuberisch von
kleinen Wassertieren (Insektenlarven, Kaulquappen) res-
pektive Fluginsekten.
Lebensraum Die Art lebt an langsam fliessenden kleinen Gräben und
an spärlich bewachsenen, flachen Weihern mit lehmig-
kiesigem Untergrund. Man findet den Südlichen Blaupfeil
aber auch in Quellrinnsalen von Kiesgruben.
Massnahmen Langsam fliessende, vegetationsarme Rinnsale oder
Teiche mit kiesig-lehmigen Untergrund erhalten und neu
anlegen. Unterhalt etappenweise vornehmen. Gräben und
Fliessgewässer abschnittweise entkrauten und Ufer offen
und Gehölzfrei halten. Wo möglich Ufer abflachen.
21Libellen
Westliche Keiljungfer
Gomphus pulcellus
Rote Liste CH: VU
Verletzlich
Foto: A. Rey
Verbreitung Die Westliche Keiljungfer besiedelt das Mittelland und
kommt vereinzelnt auch im Wallis vor. Sie fehlt im Jura
und im Tessin. Sie steigt in Höhen um 800 Meter.
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt auf der freien Wasseroberfläche. Die
Larvenentwicklung dauert 2 bis 3 Jahre. Die Larve ernährt
sich räuberisch von kleinen Wassertieren (v.a. Bachflohk-
rebse und Insektenlarven). Die Libelle jagt nach Flugin-
sekten.
Lebensraum Die westliche Keiljungfer ist die einzige einheimische
Flussjungfer welche vorzugsweise stehende Gewässer
besiedelt. Sie bevorzugt klare, vegetationsarme Gewässer
mit Kies-Ufern, kommt aber auch in langsam fliessenden
Flussabschnitten, Stauseen und in eutrophen Moorwei-
hern vor. Die wesentlichsten Eigenschaften des Lebens-
raumes sind gut besonnte Gewässer mit vegetationsar-
men, flach auslaufenden Ufern mit sandig-kiesigem Sub-
strat, denen tiefere Wasserzonen mit schlammigem Fein-
sediment vorgelagert ist. Die Imagos benötigen für die
Jagd und als Ruhehabitat ufernahe Wiesen. Die Larven
benötigen eine gute Wasserqualität und leben in sandigen
Bereichen mit Ansammlungen von totem Pflanzenmaterial
(z.B. Fallaub).
Massnahmen Erhaltung und Förderung von stehenden Pionier-
gewässern mit kiesig-sandigen Ufern und nahegelegenen
extensiv genutzten Wiesen. Pflege- und Entbu-
schungsmassnahmen sollen bei mehreren kleineren Ge-
wässern im Rotationsprinzip, bei grösseren Gewässern
abschnittweise erfolgen. Extensiv genutzte Pufferzonen
(mind. 10 m) entlang der Gewässer ausscheiden.
22Libellen
Zweigestreifte Quelljungfer
Cordulegaster boltonii
Foto: André Rey
Verbreitung Die Zweigetreifte Quelljungfer lebt in den tiefen und mittle-
ren Lagen der ganzen Schweiz. Sie steigt in Höhen um
1800 Meter.
Ökologie, Biologie Die Eiablage erfolgt durch Einpflügen des Hinterleibs in
das Sediment. Die Larvenentwicklung dauert 3 bis 5 Jah-
re. Die Larve ernährt sich räuberisch von kleinen Wasser-
tieren (v.a. Bachflohkrebse und Insektenlarven), die Libel-
le jagt Fluginsekten.
Lebensraum Die Larven leben eingegraben im feinen Sediment von
strömungsarmen Bereichen von Bächen und Gräben. Be-
sonders typisch sind Quellaustritte mit Kalktuffablagerun-
gen. Dort findet man sie in kleinsten, kaum tellergrossen
Wasseransammlungen. Oft handelt es sich dabei mehr
um überrieselte Moospolster als um erkennbare Gewäs-
ser. Die Art kann sich nur in Gewässern entwickeln die
nicht von Gehölzen oder Schilf überwachsen sind.
Fortpflanzugshabitate der Art sind langsamfliessende,
seichte und vegetationsarme Quellrinnsale, Bäche und
Gräben im Offenland sowie im Wald. Als Jagdhabitat der
Imagos sind Waldlichtungen und Streuwiesen bekannt.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von kleinen, langsam fliessen-
den Quellbächen und Gräben im Offenland sowie im Wald
ohne Verbauungen und ohne starke Verkrautung. An Stel-
len mit Drüsigem Springkraut (Impatiens glandulifera) wird
eine schonende Beweidung empfohlen.
23Heuschrecken
Feldgrille
Gryllus campestris
Foto: André Rey
Verbreitung Die Feldgrille besiedelt tiefgelegene und warme Gebiete
der ganzen Schweiz. Sie steigt bis in eine Höhe von 600
m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Feldgrille ist überwiegend herbivor. Es werden ver-
schiedene Gräser und Kräuter, seltener auch tote Tiere
und kleine Insekten verzehrt. Das Weibchen legt die Eier
meist in ihrer selbst gegrabenen Höhle in den Boden ab.
Lebensraum Die Feldgrille ist eine wärme- und trockenheitsliebende
Art. Sie besiedelt trockene Wiesen und Weiden, trockene
Waldränder, Ruderalflächen und trockene Stellen in
Feuchtgebieten. Aufgrund der Höheren Sonneneinstrah-
lung werden Hanglagen mit niederer und lückiger Vegeta-
tion bevorzugt.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse beträgt etwa 3 ha. Selten treten
geflügelte Disperser auf.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von südexponierten Wiesen und
Weiden in Hanglagen oder Böschungen. Förderung von
niedriger und lückiger Vegetation.
24Heuschrecken
Grosse Goldschrecke
Chrysochraon dispar
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Die Grosse Goldschrecke besiedelt die Nordschweiz und
das Wallis. Sie steigt bis in eine Höhe von 1000 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Grosse Goldschrecke frisst neben Gräsern wie Pfei-
fengras auch krautige Pflanzen und Blätter von Sträu-
chern. Die Eier werden in markhaltige Stengel von Him-
beere, Engelwurz, Rohrkolben, Kratzdisteln, Binsen und
Seggen (nicht in Schilf) abgelegt.
Lebensraum Die Art besiedelt Feuchtwiesen, Hochmoor- und Graben-
ränder, aber auch Schlagfluren und langrasige Trockenra-
sen. Durch ihr Eiablageverhalten ist die Art auf verbrachte
Stellen oder ungemähte Säume angewiesen.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse ist unbekannt. Flugfähige Disper-
ser sind bekannt. Die Art ist sehr Ortstreu. Es können Dis-
tanzen (normale flugunfähige Form) von midestens 120 m
bei Weibchen resp. 160 m bei Männchen zurückgelegt
werden.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von feuchten Graben- Wald- und
Heckensäumen. Ausscheidung von Pufferzonen entlang
von Gewässern. Wichtig sind parziell unngemähte Flä-
chen welche über Winter stehen bleiben.
25Heuschrecken
Lauchschrecke
Mecostethus parapleurus
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Die Lauchschrecke ist den tiefen Lagen des Mittellandes,
des Jura, des Wallis und im Tessin verbreitet. Die Art ist
vielerorts zurückgegangen.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier in den Boden. Die Art ernährt
sich von verschiedenen Gräsern.
Lebensraum Die Lauchschrecke bewohnt feuchte Wiesen und Gewäs-
serufer. Sie kommt aber gelegentlich auch auf trockenen,
langrasigen Wiesen vor.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse ist unbekannt. Die Tiere sind flug-
fähig und können geeignete Biotope in Umkreis von einem
Kilometer Entfernung innerhalb von drei Jahren besiedeln.
Massnahmen Extensiv genutzte Wiesen und feuchte Hochstaudenfluren
und Riedwiesen erhalten und fördern. Da Heuschrecken
empfindlich auf mikroklimatische Veränderungen reagie-
ren, sollen die Wiesen gestaffelt gemäht werden. Weiter
sollen Altgrasstreifen und Heckenkrautsäume stehen ge-
lassen werden. So können sich die Tiere das für ihr Ent-
wicklungsstadium optimale Mikroklima selber aussuchen.
26Heuschrecken
Langflügelige Schwertschrecke
Conocephalus discolor
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Die Langflügelige Schwertschrecke besiedelt die tieferen
Lagen der ganzen Schweiz. Verbreitungsschwerpunkte
sind im Zürcher Oberland, um den Neuenburgersee, an
der Rhone und bei Genf zu finden. Die Art ist vielerorts zu-
rückgegangen.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier mit Hilfe des Legebohrers in
Pflanzenstengel verschiedener Gräser und Binsen. Die Art
ernährt sich von verschiedenen Gräsern und Insekten.
Lebensraum Die Langflügelige Schwertschrecke ist eine wärmebedürf-
tige Art. Sie bewohnt bevorzugt feuchte Wiesen, Rieder
und Rohrricht, ist aber nicht zwingend an feuchte Lebens-
räume gebunden. So besiedelt die Art auch trockene
Hochstaudenfluren und langrasige Wiesenbrachen. Wich-
tig für die Art ist die vertikale Struktur der Vegetation (op-
timal 40-60 cm) und das vorhandensein von markhaltigen
Krautpflanzen für die Eiablage.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse ist unbekannt. Die Tiere sind flug-
fähig und wandern entlang von Saumstrukturen. Beson-
ders entlang von Fliessgewässern können die Eier durch
Pflanzenstengel passiv verbreitet werden.
Massnahmen Hochrasige Wiesen, Schilfbestände, Hochstaudenfluren
und Riedwiesen erhalten und fördern. Da Heuschrecken
empfindlich auf mikroklimatische Veränderungen reagie-
ren, sollen die Wiesen gestaffelt gemäht werden. So kön-
nen sich die Tiere das für ihr Entwicklungsstadium optima-
le Mikroklima selber aussuchen. Weiter sollen Altgras-
streifen und Heckenkrautsäume stehen gelassen werden,
so dass die Tiere genügend Pflanzenstengel für die Eiab-
lage finden.
27Heuschrecken
Roesels Beisschrecke
Metrioptera Roeseli
Foto: André Rey
Verbreitung Die Roesels Beisschrecke besiedelt Jura, Mittelland, das
Wallis und Engadin. Sie steigt in eine Höhe von 2000
m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Roesels Beisschrecke ernährt sich vorzugsweise von
verschiedenen Gräsern und kleinen Insekten. Die Eier
werden durch ein selbstgebissenes Loch in die Stengel
von Krautpflanzen abgelegt.
Lebensraum Die Art besiedelt trockene und feuchte Wiesen und Stau-
densäume. Man kann sie sowohl an trockenen Bahnbor-
ten als auch an langrasigen Flussufern finden. Sie lebt
auch in mässig gedüngten Wiesen.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse ist unbekannt. Die Tiere sind in
der Regel nicht flugfähig und können bis zu einem Kilome-
ter zurücklegen. Die Holoptere (lange Flügel, flugfähig)
Form der Art kann dann Distanzen von bis zu 5 Kilome-
tern überwinden.
Massnahmen Erhalten und fördern von extensiv bewirtschafteten Wie-
sen und Krautsäumen. Da Heuschrecken empfindlich auf
mikroklimatische Veränderungen reagieren, sollen die
Wiesen gestaffelt gemäht werden. Weiter sollen Altgras-
streifen und Heckenkrautsäume stehen gelassen werden.
So können sich die Tiere das für ihr Entwicklungsstadium
optimale Mikroklima selber aussuchen. Zudem ist bei Ar-
ten die ihre Eier in Pflanzenstengel legen, das stehenlas-
sen von Altgrasstreifen und Staudensäumen über den
Winter besonders wichtig (Überwinterung der Eier).
28Heuschrecken
Sumpfgrashüpfer
Chorthippus montanus
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Der Sumpfgrashüpfer besiedelt die ganze Schweiz mit
Ausnahme der Alpensüdseite. Er steigt bis in eine Höhe
von 1500 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Der Sumpfgrashüpfer ernährt sich von Pfeifengras, Schilf,
und verschiedenen Seggenarten. Die Eiablage erfolgt in
feuchte Erde oder in den Wurzelfilz von Carex-Bulten.
Lebensraum Der Sumpfgrashüpfer zählt zu den Arten welche die
feuchtesten Lebensräume besiedeln. In der montanen
Höhenstufe ist die Art dann nicht mehr ganz so hygrophil.
Der Sumpfgrashüpfer ist ein typischer Bewohner von
feuchten und staunassen Wiesen sowie Waldmooren. Die
Art ist auf nicht allzu dichte und nicht allzu hohe (max. 40
cm.) Vegetation angewiesen.
Mindestarealgrösse, Mobilität Als Mindestarealgrösse werden in der Literatur mehrere
Hektaren angegeben. Neue Biotope werden durch flugfä-
hige Tiere besiedelt (makroptere Form).
Massnahmen Erhaltung und Förderung von extensiv (1-2 Schnitte) ge-
nutzten nassen Wiesen und Weiden. Da Heuschrecken
empfindlich auf mikroklimatische Veränderungen reagie-
ren, sollen die Wiesen gestaffelt gemäht werden. Weiter
sollen Altgrasstreifen und Heckenkrautsäume stehen ge-
lassen werden. So können sich die Tiere das für ihr Ent-
wicklungsstadium optimale Mikroklima selber aussuchen.
29Heuschrecken
Sumpfgrille
Pteronemobius heydenii
Rote Liste CH: 2
Stark grfährdet
Foto: A. Rey
Verbreitung Die Sumpfgrille lebt in tiefgelegenen, warmen Gebieten
der Schweiz. Ihre Verbreitungsschwerpunkte sind die Re-
gionen um den Genfer- Bieler- Thuner- und
Neuenburgersee, das östliche Mittelland und das Tessin.
Sie steigt bis in eine Höhe von 850 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Sumpfgrille ist überwiegend herbivor. Es werden ver-
schiedene Gräser und Kräuter, seltener auch tote Insek-
ten verzehrt. Das Weibchen legt die Eier in feuchte Bo-
denstellen ab.
Lebensraum Die Sumpfgrille ist eine wärme- und feuchtigkeitsliebende
Art. Sie besiedelt vernässte, extensiv genutzte Wiesen
und Weiden wie Pfeifengraswiesen, Klein- und Grosseg-
genrieder. Bevorzugt wird ein kleinflächiges Mosaik aus
verschiedenen trockenen, feuchten und offenen Flächen.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse beträgt etwa 100 m2. Die Mobili-
tät der Art ist kurz nach der Imaginalhäuting vermutlich re-
lativ gross, weil alle Individuen lange Flügel besitzen. Spä-
ter werden die Flügelspitzen abgeworfen.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von Kalkflachmooren und an-
grenzender Flächen. Die Bewirtschaftung der Flächen soll
extensiv sein, kann aber sowohl durch Beweidung,
Sommermad oder Herbstmad erfolgen.
30Heuschrecken
Sumpfschrecke
Stethophyma grossum
Rote Liste CH: 2
Stark gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Die Sumpfschrecke besiedelt die ganze Schweiz. Sie
steigt bis in eine Höhe von 2400 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Die Sumpfschrecke frisst verschiedene Gräser und Seg-
gen. Die Eier werden in einen Cocon eigehüllt in den Bo-
den und zwischen Gräsern abgelegt.
Lebensraum Die Sumpfschrecke ist sehr hygrophil und besiedelt ex-
tensiv genutzte Binsen- und Seggenrieder. Bevorzugt
werden Grosseggenrieder, man trifft die Art aber auch an
Grabenrändern mit unterschiedlicher Vegetation und in
Pfeifengraswiesen mit umfangreichen Seggeneinschlüs-
sen. Weitere Voraussetzungen für das Vorkommen der
Art ist eine extensive Bewirtschaftung und eine lückige
niedere Vegetationsstruktur.
Mindestarealgrösse, Mobilität Die Mindestarealgrösse beträgt 400-1200 m2. Geignete
Biotope in bis zu 400 m Entfernung können innerhalb von
zwei Jahren besiedelt werden. Männliche Tiere können
bis zu 1500 m zurücklegen. Es sind funktionsfähige
Ausbreitungschneisen von 5 m Breite bekannt.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von extensiv genutzten Nass-
wiesen (1-2 Schnitte, kein Mulchen, keine Düngung). Er-
haltung von Grabenrändern welche nur einmal pro Jahr
abschnittweise gemäht werden dürfen. Förderlich für die
Art ist ein Nebeneinader gemähter und ungemähter
Nasswiesenparzellen.
31Heuschrecken
Warzenbeisser
Deticus verrucivorus
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Der Warzenbeisser besiedelt die ganze Schweiz bis in die
subalpine Sufe. Im Mittelland kommt die Art nur
vereinzelnt in Feuchtgebieten oder Magerwiesen vor.
Ökologie, Biologie Die Nahrung der Larven und Imagos besteht aus 2/3 tieri-
scher und 1/3 pflanzlicher Kost. Dabei werden neben Kä-
fern vorwiegend Heuschrecken und deren Larven gefres-
sen. Die Eier werden bevorzugt in vegetationslosen oder
wenig bewachsenen Boden abgelegt. Das Substrat darf
nicht zu sandig sein und muss eine hohe Wasserkapazität
aufweisen. Die Eier überliegen mindestens ein Jahr im
Boden und schlüpfen frühestens im 2. Frühjahr. Die Lar-
ven schlüpfen Mitte April und sind ab Juli erwachsen.
Lebensraum Der Warzenbeisser benötigt für die Embrionalentwicklung
hohe Temperaturen und eine relativ hohe Bodenfeuchtig-
keit. Er besiedelt daher Magerwiesen in niederschlagsrei-
chen Regionen, sowie Flachmoore mit hoher Wärmeein-
strahlung. Wichtig sind Wechsel von dichter und kurzrasi-
ger Vegetation, sowie offene Bodenstellen
Mindestarealgrösse, Mobilität Das Mobilitätsverhalten der Art wird von verschiedenen
Autoren unterschiedlich eingeschätzt. Die Mobilität der Art
ist trotz gutem Flugvermögen vermutlich gering und liegt
maximal bei 100 m. Das Minimumareal wird in der Litera-
tur mit 2.4 ha bezeichnet.
Massnahmen Erhalten und Fördern von sonnigen, extensiv genutzten,
saumreichen Magerwiesen und Flachmooren mit stellen-
weise lückiger Vegetation. Heuschrecken reagieren emp-
findlich auf mikroklimatische Veränderungen welche z.B.
bei einer Mahd erfolgen. Wichtig ist daher ein gestaffeltes,
kleinräumiges Mähen der Wiesen und das Belassen von
Altgrasstreifen und Krautsäumen. Magerwiesen ab Mitte
Juli, Riedwiesen ab September mähen (jeweils max 1
Schnitt).
32Tagfalter
Aurorafalter
Anthocharis cardamines
Foto: Stefan Hose
Verbreitung Der Aurorafalter kommt in der ganzen Schweiz von der kollinen
bis in die subalpine Stufe vor. Die Art ist vielerorts immer noch
häufig, gebietsweise ist jedoch ein leichter Rückgang festzustel-
len.
Ökologie, Biologie Der Aurorafalter ist die erste Tagfalterart welche im Frühling
schlüpft. Das Weibchen legt die Eier in der Regel auf die Blüten
des Wiesenschaumkrautes (Cardamine pratensis). Es werden
aber auch andere Kreuzblütler (Brassicaceae) wie
Knoblauchsrauke angenommen. Die Raupe ernährt sich von Blü-
ten und Schoten. Die Verpuppung findet an Grashalmen statt.
Lebensraum Der Aurorafalter besiedelt frische Waldränder und lichte Wälder
mit angrenzenden, blütenreichen Wiesen. Wichtig für die Art sind
waldrandnahe, extensiv genutzte mesophile Wiesen (mit mittlerer
Nährstoff- und Wasserversorgung) und strukturreiche Waldrän-
der mit einem vorgelagerten Krautsaum.
Massnahmen Frische Waldränder mit Krautsäumen und angrenzenden blüten-
reichen Wiesen erhalten und fördern. Waldrandnahe Wiesen und
Waldlichtungen mit Wiesenschaumkraut ab 15. Juni 2 x mähen.
Bei jedem Wiesen-Schnitt sollten an wechselnden Stellen Alt-
grasstreifen stehen gelassen werden (ca. 10%). So finden die
Falter auch nach der Mahd noch genügend Nektar und Eier,
Raupen und Puppen werden nicht vollständig mit dem Schnittgut
abgeführt.
33Tagfalter
Brauner Feuerfalter
Lycaena tityrus
Foto: André Rey
Verbreitung Der Braune Feuerfalter kommt in der ganzen Schweiz
vor und steigt bis auf 2500 Meter. Im Mittelland ist die Art
gebietsweise zurückgegangen.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier an den Blattbasen von Wie-
senampfer (Rumex acetosa) und Kleinem Sauerampfer
(Rumex acetosella) ab. Die Verpuppung findet am Boden
statt. Der Falter saugt gerne an Tymian (Thymus
serpyllum), Dost (Origanum vulgare) und Margriten
(Leucanthemum vulgare).
Lebensraum Der Braune Feuerfalter ist eine mesophile Art. Er lebt in
langrasigen, extensiv genutzten Wiesen welche reich an
Sauerampfer sind. Die Art besiedelt sowohl mässig tro-
ckene als auch mässig feuchte Wiesen in welchen die
Raupenfutterpflanze vorkommt. Wichtig für die Falter
sind blütenreiche Saumgesellschaften zur Nektarauf-
nahme.
Massnahmen Erhaltung und Förderung extensiv genutzter Wiesen und
blütenreicher Saumgesellschaften. Wichtig ist auch das
gestaffelte Mähen der Wiesen und das Belassen von Alt-
grasstreifen über Winter. So finden die Falter auch nach
der Mahd noch genügend Nektar und Eier, Raupen und
Puppen werden nicht vollständig mit dem Schnittgut ab-
geführt.
34Tagfalter
Dunkler Dickkopffalter
Erynnis tages
Foto: André Rey
Verbreitung Der Dunkle Dickkopffalter kommt in der ganzem Schweiz
vor und steigt bis in eine Höhe von 2000 m.ü.M.. Im Mit-
telland ist die Art gebietweise zurückgegangen.
Ökologie, Biologie Die Eier werden an Hornklee (Lotus corniculatus), Hufei-
senklee (Hypocrepis comosa) oder Bunte Kornwicke
(Coronilla varia) abgelegt. Die Falter saugen gern an
Kriechendem Günsel (Ajuga reptans) oder Frühlings-
Fingerkraut (Potentilla neumanniana), und sonnen sich
mit Vorliebe auf offenen Humusstellen. Zur
Überdauerung von Schlechtwetterperioden hängen sie
sich gern an den Blütenstand von Betonie (Betonica
officinalis) und Johanniskraut (Hypericum perforatum).
Lebensraum Die Art fliegt auf trockenen und wechselfeuchten Mager-
wiesen und extensiv genutzten Weiden, auf denen die
Raupenfutterpflanze wächst. In der subalpinen Stufe fin-
det man die Art auch in Waldlichtungen und entlang von
Waldwegen.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von Magerwiesen und extensiv
genutzten Weiden. Wichtig ist auch das gestaffelte Mä-
hen der Wiesen und das Belassen von Altgrasstreifen
und Krautsäumen über Winter. So finden die Falter auch
nach der Mahd noch genügend Nektar und Eier, Raupen
und Puppen werden nicht vollständig mit dem Schnittgut
abgeführt.
35Tagfalter
Gewöhnliches Widderchen
Zygaena fillipendulae
Foto: André Rey
Verbreitung Das Gewöhnliche Widderchen besiedelt alle Teile der
Schweiz und steigt bis in die alpine Stufe.
Ökologie, Biologie Die Eier werden an Hornklee (Lotus corniculatus) abge-
legt. In der Literatur werden noch einige weitere Futter-
pflanzen genannt (Fabaceaen). Die Falter saugen bevor-
zugt an lila und violetten Blüten wie Knautie (Knautia
arvensis), Skabiose (Scabiosa columbaris), Flockenblu-
me (Centaurea jacea), Wasserdost (Eupatorium
cannabinum), Teufelsabbiss (Succisa pratensis) und Lu-
zerne (Medicagi sativa).
Lebensraum Die Art besiedelt unterschiedliche Lebensräume wie Ma-
gerwiesen, Feuchtwiesen, Ruderalflächen, mageren Bö-
schungen und extensiv genutzte Flächen im Siedlungs-
gebiet.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von extensiv genutzten Wiesen
und Ruderalflächen. Wichtig ist auch das gestaffelte Mä-
hen der Wiesen und das Belassen von Altgrasstreifen
und Krautsäumen über Winter. So finden die Falter auch
nach der Mahd noch genügend Nektar und Eier, Raupen
und Puppen werden nicht vollständig mit dem Schnittgut
abgeführt.
36Tagfalter
Kleiner Würfelfalter
Pyrgus malvae
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Der Kleine Würfelfalter kommt auf der Alpennordseite, im
Mittelland sowie im Jura vor. Er steigt bis in eine Höhe
von über 2000 m.ü.M..
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier an die Blattunterseite von
Frühlingsfingerkraut (Potentilla neumanniana) und Auf-
rechtem Fingerkraut (Potentilla errecta) ab. Die Verpup-
pung findet an der Basis Raupenfutterpflanze statt. Der
Falter saugt gerne an Frühlingsfingerkraut, Kriechendem
Günsel (Ajuga reptans), Mehlprimel (Primula farinosa)
und Eisenhutblättrigem Hahnenfuss (Ranunculus
aconitifolius).
Lebensraum Der Kleine Würfelfalter lebt in Magerwiesen und Flach-
mooren.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von extensiv genutzten Mager-
wiesen und Riedwiesen. Wichtig ist auch das gestaffelte
Mähen der Wiesen und das Belassen von Altgrasstreifen
über Winter. So finden die Falter auch nach der Mahd
noch genügend Nektar und Eier, Raupen und Puppen
werden nicht vollständig mit dem Schnittgut abgeführt.
37Tagfalter
Malvendickkopffalter
Charcharodus alceae
Rote Liste CH: 1
Vom Aussterben bedroht
Foto: André Rey
Verbreitung Der Malvendickkopffalter kommt in der Schweiz lokal bis
in Höhen von 1000 m.ü.M. vor. In den letzten Jahren hat
sich die Art wieder ausgebreitet und ist gebietweise wie-
der häufiger geworden.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier auf die Blattoberseite der
Kleinen Malve (Malva neglecta) und der Wilden Malve
(Malva sylvestris) ab. Weiter werden Sigmarswurz
(Malva alceae) und Stockrose (Alcea officinalis) als Rau-
penfutterpflanzen genannt. Die Verpuppung findet in der
Streueschicht am Boden statt. Der Falter saugt gerne an
Kriechendem Günsel (Ajuga reptans), Acker-taubnessel
(Lamium purpureum) und Waldimmergrün (Vinca minor).
Lebensraum Der Malvendickkopffalter ist eine wärmeliebende Art. Er
besiedelt Rebberge, Steinbrüche, Ruderalstellen, verbra-
chende Glatthaferwiesen und einschürige Magerwiesen.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von Wildkrautfluren an tro-
ckenwarmen Stellen, welche nur alle 1-2 Jahre gemäht
werden. Erhaltung von trockenwarmen, einschürigen
Magerwiesen. Förderung der erwähnten Malvenarten.
38Tagfalter
Märzveilchenfalter
Argynnis adippe
Syn. Fabriciana adippe
Rote Liste CH: 3
gefährdet
Foto: André Rey
Verbreitung Der Märzveilchenfalter besiedelt die ganze Schweiz bis
in die subalpine Stufe. Das westliche und zentrale Mittel-
land hat die Art weitgehend geräumt.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier auf das Waldveilchen (Viola
reichenbachiana) und Feldsteifmutterchen (Viola tricolor).
Lebensraum Der Märzveilchenfalter bewohnt Magerwiesen die an
Waldränder grenzen oder von Hecken durchzogen sind,
sowie lichter Wald und Schlagfluren. Der
Larvallebensraum der Art sind warme Krautsaume.
Massnahmen Erhaltung und Förderung von extensiv genutzten Mager-
wiesen mit angrenzenden, nur parziell gemähten Wald-
oder Heckensäumen. Wiesen gestaffelt ab Juli 1-2 mal
mähen, Krautsäume alternierend abschnittweise zu 50%
mähen.
39Tagfalter
Mauerfuchs
Lasiommata megera
Foto: André Rey
Verbreitung Der Mauerfuchs, ursprünglich in der ganzen Schweiz in
der kollinen und montanen (bis subalpin) Stufe verbreitet,
und war bis vor wenigen Jahren aus dem Mittelland und
der Zentralschweiz fast verschwunden. Neuerdings brei-
tet sich die Art wieder aus und ist gebietsweise häufiger
geworden.
Ökologie, Biologie Das Weibchen legt die Eier vorwiegend auf verdorrte
Grasbüschel. Die Raupe frisst die Blätter der Aufrechten
Trespe (Bromus erectus) und verschiedenen Schwingel-
arten (Festuca spec.). Die Verpuppung findet auf Stei-
nen, Holzstücken oder dürrem Gras statt. Der Falter be-
sucht Blüten verschiedener Pflanzenarten.
Lebensraum Der Mauerfuchs liebt warme, trockene Biotope. Dazu
gehören Rebberge, extensiv bewirtschaftete Wiesenbö-
schungen und Waldränder. Sonnenplätze auf Trocken-
mauern oder Schotterböden sind wichtige Lebensraum-
elemente.
Massnahmen Trockene Magerwiesen mit Schotter- oder Felsstellen,
oder Trockenmauern erhalten und fördern. Wichtig ist
auch das gestaffelte Mähen der Wiesen und das Belas-
sen von Altgrasstreifen und Krautsäumen über Winter.
So finden die Falter auch nach der Mahd noch genügend
Nektar und Eier, Raupen und Puppen werden nicht voll-
ständig mit dem Schnittgut abgeführt.
40Sie können auch lesen