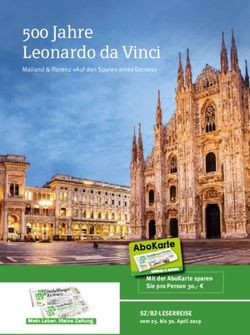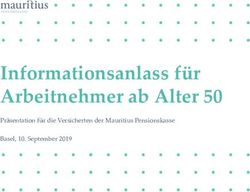Wie finanziere ich einen Heim-Pflegeplatz? - Eine Orientierungshilfe für die Finanzierung eines Heimaufenthaltes in Vorarlberg - femail
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wie finanziere ich einen Heim-Pflegeplatz? Eine Orientierungshilfe für die Finanzierung eines Heimaufenthaltes in Vorarlberg
Impressum: Herausgeber FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg, www.femail.at Gestaltung grafik caldonazzi, Martin Caldonazzi www.caldonazzi.at Fotos FEMAIL, Fotolia Druck Druckerei Wenin, Dornbirn 2. Auflage, Mai 2016
Pflege kostet und wird damit zur Leistung. Pflege hat immer mit Geld zu tun, was spätestens dann relevant wird, wenn die Pflege zu Hause nicht mehr möglich ist. FEMAIL greift mit dieser Kurzinformation ein Thema aus der Beratungspraxis auf und lädt ein, zeitgerecht und informiert über dieses Thema nachzu- denken. Die vorliegende Broschüre war bereits nach einem Jahr ihres Erscheinens vergriffen. Dies macht deutlich, welche Relevanz das Thema hat. Inhalt • Vermögenseinsatz • Schenkung • Unterhaltspflicht/Kostenersatz nach Mindestsicherung • Unterhaltsanspruch in der Ehe/Eingetragene Partnerschaft • Lebensgemeinschaft • Geld für den Lebensunterhalt im Heim • Ausgleichszulage für PensionsbezieherInnen
Finanzierung eines Heimaufenthaltes Der Aufenthalt in einem Pflegeheim ist grundsätzlich selbst zu bezahlen. Wenn die dazu notwendigen Mittel nicht oder nicht mehr zur Gänze vorhanden sind, besteht Anspruch der Übernahme der (Differenz-)Kosten durch die Min destsicherung (Antragstellung bei den Bezirkshaupt mannschaften über die Wohnsitzgemeinde). Voraussetzung für die Kostenbeteiligung durch die Mindestsicherung: - Pflegebedürftigkeit – ab Pflegestufe 3 (Ausnahmen möglich) - Einsatz des eigenen Einkommens (Pension, Pflegegeld, ...) - Unterhaltsanspruch gegenüber der Ehepartnerin/ dem Ehepartner (sofern möglich) - Einsatz des eigenen Vermögens (Sparguthaben, Liegenschaften, …) - Einsatz der Zinsen vom verschenkten Vermögen, sofern die Schenkung bei der Antragsstellung in der Mindestsicherung nicht mehr als 10 Jahre zurück liegt
Vermögenseinsatz Die pflegebedürftige Person hat ihr gesamtes ver- wertbares Vermögen (Liegenschaften, Barvermögen, Sparbücher, Wertpapiere, usw.) einzusetzen. Es ist ausschließlich das Vermögen der pflegebedürftigen Person betroffen. Das Vermögen der Ehepartnerin/des Ehepartners ist nicht betroffen. Gemeinsames Vermö- gen wird 50:50 aufgeteilt (z.B. Sparbuch). Ist Vermögen vorhanden, das nicht sofort eingesetzt werden kann (Schonvermögen), so besteht die Möglichkeit, vorerst Mindestsicherung zu beziehen. Dies geschieht in Form eines Darlehens, das über eine Grundbucheintragung sichergestellt wird. Schonvermögen bezeichnet Vermögenswerte die der- zeit nicht oder nur unvorteilhaft (niedriger Verkaufser- lös) eingesetzt werden könnten. Hier wird aber eine Verwertung verlangt, wenn es zielführend ist.
Geschütztes Vermögen Vom Einkommens- und Vermögenseinsatz ausgenom- men sind - Sparbeträge bis € 10.000,- - Pensionen Sonderzahlungen (13.+14.) - 20 % der Pension - 10 % des Pflegegeldes der Pflegestufe 3 (€ 45,18 Stand 2016) - angesparte Pensionsvorsorge für die Ehepartnerin/ den Ehepartner in der Höhe der unterhaltsrecht- lichen Ansprüche - Eigenheim (Eigentumswohnung), das den Ehepart- nern oder eingetragenen Partnern, Kindern oder Enkeln zur Deckung des unmittelbaren Wohnbe- darfs dient - Der Unterhaltsanspruch der Ehepartnerin/des Ehe- partners bzw. der Ex-Ehepartner
Schenkungen Wurden von der pflegebedürftigen Person Schenkun gen vorgenommen und liegen diese zum Zeitpunkt der Beantragung der Mindestsicherung nicht länger als 10 Jahre zurück, besteht für die Schenkungsgebe- rin/den Schenkungsgeber gegenüber der Schenkungs- nehmerin/dem Schenkungsnehmer ein Anspruch auf Schenkungszinsen. Die Schenkungsnehmerin/der Schenkungsnehmer wird verpflichtet, jährlich 4% als Zinsen (Kostenersatz leistung) des aktuellen Wertes der Schenkung zu entrichten.Gegenleistungen wie Wohnrecht oder Leibrente werden berücksichtigt und mindern den Wert der Schenkung. Als Grundlage für die Berech nung der Schenkungszinsen dient meist ein Sachver ständigengutachten. Die Verpflichtung zur Zinsleistung ist zeitlich nicht begrenzt, sondern besteht, solange Mindestsicherung bezogen wird. Dieser Anspruch auf Zinsleistung kann nur soweit angenommen werden, soweit das der verpflichteten Person finanziell zumutbar ist und: Es darf dadurch keine neue Notlage entstehen. Die Schenkung, die mit Blick auf eine drohende Pfle gebedürftigkeit erfolgt, gilt als sittenwidrig.
Ein Beispiel Ehepaar S. hat ihr Eigenheim vor 5 Jahren an die Toch- ter überschrieben. Die Tochter hat mir ihrem Mann das Haus ausgebaut und bewohnt das obere Stockwerk. Die Eltern wohnen im Erdgeschoss. Herr S. muss auf- grund seiner schweren Erkrankung ins Pflegeheim. Da die Schenkung des Hauses an die Tochter erst 5 Jahre zurück liegt, muss die Tochter (wenn es ihr Ein- kommen erlaubt) Kostenersatz leisten, ihre Investition wird vom aktuellen Wert abgezogen. Wenn das Eigenheim noch im Besitz des Ehepaares S. stehen würde, wäre das Haus geschütztes Vermögen (Ehefrau und Kinder bewohnen es) und somit auch nicht einzusetzen.
Kostenersatz nach Mindestsicherungsgesetz Bei der Ermittlung der Höhe des Kostenersatzes wird nur das Einkommen, nicht das Vermögen der unter haltspflichtigen Person herangezogen. Die Kosten ersatzleistung soll nicht zu einer Notlage für die Betrof fenen führen. Ein Kostenersatz ist nur zu leisten, wenn die Zumutbarkeitsgrenze nicht unterschritten wird. Eine Unterhaltspflicht haben EhepartnerInnen/Ein- getragene PartnerInnen gegenseitig sowie Eltern für ihre minderjährigen Kinder. Keine Kostenersatzpflicht haben Kinder gegenüber den Eltern, sowie Eltern von volljährigen Kindern.
Unterhaltsanspruch in der Ehe und bei eingetragener Partnerschaft (homosexuelle Paare) Ehepaare haben einen gegenseitigen Unterhaltsan- spruch. Muss die Ehepartnerin/der Ehepartner, die/der alleinig oder zum überwiegenden Teil zum Familien einkommen beiträgt, ins Pflegeheim, hat der/die an- dere einen Unterhaltsanspruch. Bei Kostenbeteiligung durch die Mindestsicherung wird der Unterhaltsan spruch der Ehepartnerin/des Ehepartners mittels zwei er Betrachtungsweisen festgestellt. Einerseits nach dem Allgemein Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBG) und andererseits nach der Bedarfsgerechten Mindestsiche- rung. Die für die Betroffenen günstigere Variante wird angewendet. Der Unterhaltsanspruch im AGBG orientiert sich am Gesamteinkommen des Ehepaares und ist abhängig davon, ob die Ehepartner ein eigenes Einkommen haben (Anspruch: 40% vom Gesamteinkommen) oder über kein Einkommen (Anspruch: 33% vom Gesamt- einkommen) verfügen. Der Lebensbedarf in der Mindestsicherung wird für eine Einzelperson mit € 630,76 (Stand 2016) plus Mie- te und Betriebskosten (ohne Heizkosten) festgelegt.
Lebensgefährten Da Lebensgefährten im Gegensatz zur Ehe keine ge- genseitigen Rechte und Pflichten haben, besteht auch kein wechselseitiger Unterhaltsanspruch. So kann eine Lebensgefährtin/ein Lebensgefährte niemals für die Mitfinanzierung eines Heimaufenthaltes herangezo- gen werden. Auf der anderen Seite besteht auch kein Anspruch auf das Einkommen der Lebensgefährtin/ des Lebensgefährten, wenn dieser eine stationäre Pflege braucht. Für Lebensgefährten empfiehlt es sich im Vorfeld (idealerweise bevor ein Pflegebedarf bzw. fehlende Geschäftsfähigkeit eintritt), Vorkehrungen (Wohnung, Testament, Wünsche bezüglich medizinischer Behand- lung) zu treffen. Die gegenseitige Absicherung von Lebensgefährten muss geregelt werden. Hier ist eine ausführliche Bera- tung und vertragliche Absicherung mittels Notarin/No- tar oder Rechtsanwältin/Rechtsanwalt zu empfehlen.
Geld für den Lebensunterhalt im Heim Der pflegebedürftigen Person verbleiben als frei ver- fügbare Geldmittel während des Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung folgende Geldmittel: • Ist eine Eigenpension vorhanden, verbleibt das an Geldmittel, was unter Geschütztes Vermögen auf- gezählt ist. • Bei alleiniger Finanzierung des Heimaufenthaltes durch die Mindestsicherung verbleibt der pflegebe- dürftigen Person ein Taschengeld in der Höhe von € 138,77 (Stand 2016) pro Monat.
Ausgleichszulage für PensionsbezieherInnen Durch einen Heimaufenthalt der Ehepartnerin/des Ehepartners kann ein Anspruch auf Ausgleichszulage entstehen! Die Ausgleichszulage soll jeder Pensionsbezieherin/ jedem Pensionsbezieher, die/der im Inland lebt, ein Mindesteinkommen sichern. Liegen die Pension und/oder ein anderes Einkommen (z.B. Mieteinnahmen), sowie Ansprüche (z.B. Unter- halt nach Scheidung) unter einem bestimmen Betrag, wird die Differenz als Ausgleichszulage gewährt. Die Richtsätze für die Ausgleichszulage (2016) betra- gen für eine/ein Brutto Netto Alleinstehende Person € 882,76 € 837,76 Ehepaar € 1.323,58 € 1.256,08
Weiterführende Informationen Bezirkshauptmannschaften Vorarlberg BH Bregenz Abteilung Soziales 6900 Bregenz, Bahnhofstraße 41 T 05574 / 4951-52414, bhbregenz@vorarlberg.at BH Dornbirn Abteilung Soziales 6850 Dornbirn, Klaudiastraße 2 T 05572 / 308-53413, bhdornbirn@vorarlberg.at BH Feldkirch Abteilung Soziales 6800 Feldkirch, Schlossgraben 1 T 05522 / 3591-54 414 , bhfeldkirch@vorarlberg.at BH Bludenz Abteilung Soziales 6700 Bludenz, Schloss-Gayenhofplatz 2 T 05552 / 6136-51412, bhbludenz@vorarlberg.at
Pensionsversicherungsanstalt 6850 Dornbirn, Zollgasse 6 T 05 03 03, pva-lsv@pensionsversicherung.at Landesvolksanwaltschaft Vorarlberg 6900 Bregenz, Landwehrstraße 1 T 05574 / 47 027, buero@landesvolksanwalt.at
www.femail.at FEMAIL FrauenInformationszentrum Vorarlberg Marktgasse 6 A-6800 Feldkirch info@femail.at T +43 5522 31002 M +43 699 127 35 259 M +43 664 35 60 603 Türkisch Öffnungszeiten: Frauenservicestelle: Mo – Do 9.00 – 12.00 Uhr Fachstelle Frauengesundheit: Mi 14.00 – 17.00 Uhr Außerhalb der Öffnungszeiten Beratungstermine nach Vereinba- rung. Bei Bedarf und Voranmeldung steht Ihnen gerne eine Dolmetscherin zur Verfügung. FEMAIL Außenstelle Lustenau Neudorfstraße 7 im Kindergarten Rheindorf Öffnungszeiten: Do 8.00 – 13.00 Uhr
Sie können auch lesen