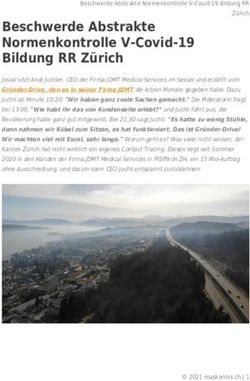Titel: Behandlungsmöglichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung in Pakistan - Bayern.Recht
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
VG Augsburg, Urteil v. 09.04.2018 – Au 3 K 17.34319 Titel: Behandlungsmöglichkeit einer posttraumatischen Belastungsstörung in Pakistan Normenketten: VwVfG § 51 AufenthG § 60 Abs. 7 S. 1 Leitsatz: Eine posttraumatische Belastungsstörung und eine damit im Zusammenhang stehende Depression können in Pakistan nicht nur medikamentös, sondern auch therapeutisch behandelt werden. (Rn. 21) Schlagworte: Pakistan, Beweiswert von Attesten, posttraumatische Belastungsstörung, Behandlungsmöglichkeit in Pakistan, gefälschte Polizeiberichte, Abschiebung, Abschiebungsverbot Fundstelle: BeckRS 2018, 8299 Tenor I. Die Klage wird abgewiesen. II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. Tatbestand 1 Der am ... 1992 geborene Kläger ist pakistanischer Staatsangehöriger aus ... in der Provinz Punjab und Sunnit. Er meldete sich am 24. November 2015 und 14. Dezember 2015 unter dem Aliasnamen, geboren am ... 1992, in ... als Asylbewerber. Am 9. Mai 2016 stellte er unter dem Aliasnamen, einen Asylantrag. 2 Bei seiner Anhörung am 30. Mai 2016 trug er vor, in seinem Heimatdorf habe es einen religiösen Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten gegeben. Im August 2013 seien sie – ca. 12 Personen – nachts gegen ca. 23.00 Uhr auf dem Nachhauseweg von einem Treffen im Nachbardorf gewesen, als sich ihre schiitischen Gegner vor ihnen aufgestellt und geschossen hätten. Dabei seien sein Bruder und drei weitere Personen ums Leben gekommen. Er selbst habe oberhalb des rechten Knies einen Knochendurchschuss erlitten, habe operiert werden müssen und sei ca. sechs Monate im Krankenhaus gewesen. Danach sei es wiederholt zu handgreiflichen Auseinandersetzungen gekommen. Deswegen seien seine Eltern, sein jüngerer Bruder und er selbst zu seiner Cousine in ... gezogen. Er habe wegen der Schießerei die Polizei informiert, die aber nichts unternommen habe. Auf Nachfrage erklärte der Kläger, die Polizei habe schon Ermittlungen aufgenommen und Personen befragt, habe aber die Person, die geschossen habe, nicht gefunden, da sie nicht zu Hause gewesen sei. Bei seiner Cousine sei er einige Monate sicher gewesen. Die Schiiten hätten Kontakt mit seinem acht Jahre jüngeren Bruder aufgenommen und ihm gesagt, dass sie ihn und seine Familie angreifen würden, wenn er mit seiner Tätigkeit als Imam nicht aufhöre. Sein Vater habe dann Kontakt mit einem Schleuser aufgenommen und er – der Kläger –, sein Bruder und sein Neffe seien zusammen ausgereist. Sein Bruder sei im Iran festgehalten worden, so dass er, der Kläger, nicht wisse, wo der Bruder sei. Auf dem Weg zwischen Griechenland und der Türkei habe er erfahren, dass es seinem Vater sehr schlecht gehe. Am 17. Mai 2016 habe er erfahren, dass sein Vater gestorben sei. Er sei durch die situationsbedingte psychische Belastung gestorben.
3 Mit Bescheid vom 10. August 2016 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft, Asylanerkennung und subsidiären Schutz ab, verneinte das Vorliegen von Abschiebungsverboten nach § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG und drohte dem Kläger die Abschiebung nach Pakistan an. Hinsichtlich der angeblichen Bedrohung sei das Vorbringen von pauschalen Aussagen geprägt. Im Übrigen müsse er sich auf inländischen Schutz im Herkunftsland verweisen lassen. 4 Die dagegen erhobene Klage wies das Verwaltungsgericht Augsburg mit Urteil vom 17. März 2017 ab. Es bestünden erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der das Verfolgungsschicksal begründenden Angaben. Der Vortrag hierzu sei in Teilen widersprüchlich und nicht in sich stimmig. Insbesondere sei für das Gericht nicht nachvollziehbar, warum der Kläger den (angeblichen) Übergriff auf ihn und seinen Bruder im Jahr 2011 nicht schon beim Bundesamt erwähnt habe. Insofern habe der Kläger seinen Vortrag gesteigert und sei auch deswegen als nicht glaubhaft einzustufen. Hinsichtlich der beiden im Klageverfahren vorgelegten Polizeiberichte betreffend den Vorfall im August 2013 falle auf, dass diese inhaltlich in Bezug auf die Opfer nicht übereinstimmten. Nur im zweiten Bericht vom 14. August 2013 sei die Tötung des Bruders des Klägers erwähnt, wohingegen nach dem ersten Bericht vom 13. August 2014 zwei andere namentlich benannte Personen getötet worden seien. Laut Aussage des Klägers beim Bundesamt seien hingegen neben seinem Bruder drei weitere Personen umgekommen. Hinzu komme, dass der jüngere Bruder rund acht Jahre jünger sein solle, d.h. zum Zeitpunkt der Ausreise zwischen 14 und 15 Jahre, und von daher begründete Zweifel bestünden, dass jener in diesem Alter und davor bereits Religionsgelehrter (Imam) gewesen sein solle. Ferner sei nicht zu erkennen, weshalb es dem Kläger nicht möglich und zumutbar sein solle, sich eventuellen Bedrohungen durch Ansiedlung in einem anderen Landesteil zu entziehen. 5 Den Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung lehnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof mit Beschluss vom 4. Mai 2017 ab. 6 Am 29. Mai 2017 wandte sich der Kläger zusammen mit seiner ehrenamtlichen Helferin an die Kontaktstelle der ... Er klagte über Ängste, depressive Stimmungstiefs, Motivationsmangel, Kopfschmerzen, Vergesslichkeit und immer wiederkehrende belastende Alpträume. Vor zwei Jahren sei in seinem Dorf ein Bruder in einem Religionskonflikt zwischen Schiiten und Sunniten getötet, er selber angeschossen worden. Einen weiteren Bruder habe er auf der Flucht im Iran aus den Augen verloren, was ihn sehr belaste. In der „Fachdienstlichen Stellungnahme nach Aufnahmegespräch“ des Dipl.-Psych. ... vom 29. Juni 2017 heißt es, der Kläger wirke psychisch akut sehr belastet. Wegen der quälenden Gedanken ob der traumatischen Erlebnisse könne er nachts kaum schlafen, grüble viel und werde ständig von schlimmen Alpträumen geplagt. Tagsüber sei er antriebsgemindert, übermüdet und freudlos und könne sich zu kaum etwas motivieren. Er habe zudem wiederkehrende Todeswünsche, habe eine akute Suizidalität jedoch verneint. Man könne bei ihm von einer mittelschweren Depression bei zugrunde liegender posttraumatischer Belastungsstörung ausgehen. Sein Verhältnis zu den Mitbewohnern in dem Flüchtlingsheim sei eher angespannt und von Misstrauen geprägt. Unterstützung erhalte er lediglich von seiner ehrenamtlichen Helferin. 7 In dem hausärztlichen Befundbericht des Facharztes für Allgemeinmedizin ... vom 7. Juli 2017 heißt es, der Kläger habe sich im Oktober 2016 erstmals wegen depressiver Symptomatik vorgestellt. Das verschriebene Medikament sei jedoch nicht regelmäßig eingenommen worden. Im Verlauf habe sich der psychische Befund bei posttraumatischer Belastungsstörung zunehmend verschlechtert. Es sei zu zunehmenden Angstattacken, Schlafstörungen, am ehesten aufgrund von Flashbacks im Rahmen der posttraumatischen Belastungsstörung, sowie Suizidgedanken gekommen. Im Dezember 2016 sei ein Therapieversuch mit einem Psychopharmaka unternommen worden. Bis April 2017 sei der Kläger nicht mehr gekommen. Dann habe er sich jedoch auf Grund einer erneuten erheblichen Verschlechterung der Symptomatik erneut
regelmäßig vorgestellt. Zwei Psychopharmaka hätten keine Besserung des Befindens bewirkt. Vielmehr sei es zu einer weiteren Verschlechterung gekommen, so dass es im Juni 2017 zu einer akuten Suizidalität gekommen sei, weshalb der Kläger in das Bezirkskrankenhaus ... eingewiesen worden sei. 8 Nach der ärztlichen Kurzinformation einer Ärztin des Bezirkskrankenhauses ... vom 13. Juli 2017 befand sich der Kläger dort vom 19. Juni 2017 bis 14. Juli 2017 zum ersten Mal in stationär-psychiatrischer Behandlung. Bei ihm wurde eine schwere depressive Episode ohne psychotische Symptome diagnostiziert. Die stationäre Aufnahme sei aufgrund der depressiven Symptomatik mit Suizidgedanken und Angstzuständen erfolgt. Bei der Aufnahme sei der Kläger affektiv niedergeschlagen, innerlich angespannt, verängstigt und hoffnungslos gewesen. Die antidepressive Therapie habe zu erhöhter Reizbarkeit und Aggressivität geführt. Unter einer anderen medikamentösen Therapie habe die depressive sowie die Angstsymptomatik rückläufige Tendenz gezeigt. Im weiteren Verlauf sei der Kläger von der Suizidalität klar und glaubhaft distanziert gewesen. Neben der Psychopharmakotherapie habe er im Rahmen seiner Möglichkeiten zuverlässig an dem multimodalen Therapieangebot teilgenommen. Er sei in stabilisiertem Zustand in die ambulante psychiatrische Weiterbehandlung entlassen worden. Zum Entlassungszeitpunkt habe kein Hinweis auf akute Selbst- oder Fremdgefährdung bestanden. Da bei dem Kläger der Verdacht auf eine posttraumatische Belastungsstörung bestehe, weil er schwer verletzt gewesen sei und das Töten seiner Angehörigen gesehen habe, sei im Fall einer Abschiebung mit einer Verstärkung der depressiven Symptomatik und Suizidalität zu rechnen. Entsprechende Sicherungsmaßnahmen würden voraussichtlich notwendig sein. 9 Unter Bezugnahme auf diese ärztliche Kurzinformation stellte der Kläger am 26. Juli 2017 beim Bundesamt einen Folgeantrag bzw. Wiederaufnahmeantrag. Er habe sich zunächst für ca. vier Wochen stationär im Bezirkskrankenhaus befunden. Wie im Asylverfahren bekannt sei, sei er im Heimatland schwer verletzt worden und habe das Töten seiner Angehörigen gesehen. Eine Rückkehr in sein Heimatland sei ausgeschlossen, da die Mörder bei einem Grenzübertritt über undichte Stellen der Polizei sofort erkennen könnten, wenn er sich wieder in Pakistan aufhalte. Es bestehe für ihn keine inländische Fluchtalternative. 10 Mit Bescheid vom 3. August 2017 lehnte das Bundesamt den Antrag auf Abänderung des Bescheids vom 10. August 2016 bezüglich der Feststellung zu § 60 Abs. 5 und 7 AufenthG ab. Die ärztliche Kurzinformation vom 13. Juli 2017 werde schon den von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen an ärztliche Atteste nicht gerecht. Ohne entsprechende eigene Befunderhebung, nämlich die explizite eigene Eruierung der angeblichen traumatischen Erlebnisse, lasse sich eine auf Trauma zurückzuführende psychische Erkrankung nicht erklären. Hier sei man nur den eigenen Angaben des Klägers gefolgt, die sich im Ausgangsverfahren schon als unglaubwürdig herausgestellt hätten. Dessen ungeachtet seien von seltenen Ausnahmefällen abgesehen alle medizinischen Probleme in Pakistan behandelbar, sowohl in den privaten als auch in den öffentlichen Spitälern. Insbesondere die Qualität der Ärzte, die oft sehr gut ausgebildet seien, sei hoch. Insbesondere zur Weiterbehandlung von schweren depressiven Episoden, einer Angststörung und auch einer posttraumatischen Belastungsstörung stünden in Pakistan Fachärzte (Psychologen, Psychiater) zur Verfügung und könnten diese Erkrankungen kostenlos medikamentös und therapeutisch behandeln. 11 Am 18. August 2017 erhob der Kläger Klage. Er beantragt, 12 den Bescheid des Bundesamts vom 3. August 2017 aufzuheben und die Beklagte zu verpflichten, festzustellen, dass bei ihm ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich Pakistans vorliegt. 13
Zur Begründung wurde im Wesentlichen Bezug genommen auf die ärztliche Kurzinformation einer Ärztin des Bezirkskrankenhauses ... vom 13. Juli 2017, die fachdienstliche Stellungnahme des Dipl.-Psych. ... von der ... vom 29. Juni 2017, den Befundbericht des Facharztes für Allgemeinmedizin ... vom 7. Juli 2017, das vom Landratsamt ... zur Reisefähigkeit des Klägers eingeholte Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. ... vom 1. Oktober 2017, das vorläufige fachärztliche Attest des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie ... vom 15. November 2017, das fachärztliche psychiatrische Gutachten zur Vorlage beim Landratsamt ... des gleichen Facharztes vom Januar 2018 und zwei Originalpolizeiberichte der Polizeistation ... vom 24. Oktober 2017 und 13. November 2017 mit Übersetzung. Die Polizeiberichte bezeugten, dass fremde Männer die Mutter des Klägers mit Waffen bedroht und zu Hause aufgesucht hätten. Sie hätten von der Mutter wissen wollen, wo sich der Kläger aufhalte. Die Mutter habe die Täter zweimal bei der zuständigen Polizeibehörde angezeigt. Es sei davon auszugehen, dass der Kläger bei einer Rückkehr nach Pakistan keinen Polizeischutz erhalte und in akuter Lebensgefahr sei. Diese Vorfälle verstärkten seine psychische Erkrankung und verängstigten ihn zusätzlich. 14 Ergänzend wird auf den Akteninhalt und die zum Gegenstand des Verfahrens gemachten Erkenntnisgrundlagen Bezug genommen. Entscheidungsgründe 15 Die zulässige Klage ist unbegründet. 16 Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Feststellung, dass bei ihm ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG hinsichtlich Pakistans vorliegt. Das Bundesamt hat den Antrag auf Änderung des unanfechtbaren Bescheids vom 10. August 2016 bezüglich der Feststellung zu § 60 Abs. 5 und 7 Satz 1 AufenthG zu Recht abgelehnt. 17 1. Die Voraussetzungen für ein Wiederaufgreifen des Verfahrens nach § 51 Abs. 1 bis 3 VwVfG liegen nicht vor. Insbesondere hat sich weder die Sach- oder Rechtslage zugunsten des Klägers geändert noch liegen neue Beweismittel vor, die eine für ihn günstigere Entscheidung herbeigeführt haben würden. Insoweit wird zunächst auf die zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Bescheid Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 AsylG). 18 a) Die zur Klagebegründung vorgelegten Atteste haben keinen Beweiswert. Sie beruhen auf den im Verlauf des Verfahrens ständig gesteigerten eigenen Angaben des Klägers. Da eine posttraumatische Belastungsstörung nur zum Entstehen kommt, wenn ein (außergewöhnlich) belastendes Ereignis stattgefunden hat, dessen Nachweis bei der (fach-) ärztlichen Begutachtung weder zu erbringen noch zu leisten ist, muss das behauptete traumatisierende Ereignis vom Kläger gegenüber dem Tatrichter glaubhaft gemacht werden (vgl. BayVGH, B.v. 23.5.2017 – 9 ZB 13.30236 – juris Rn. 10 m.w.N.). Dies gilt umso mehr, wenn – wie hier – bereits ein rechtskräftiges Urteil vorliegt, in dem erhebliche Zweifel an der Glaubwürdigkeit der das Verfolgungsschicksal begründenden Angaben geltend gemacht werden, und diese Zweifel von den behandelnden/begutachtenden Ärzten ausgeblendet werden. 19 Die Glaubwürdigkeitszweifel haben sich gegenüber dem Erstverfahren noch verstärkt. So äußerte der Kläger am 29. Mai 2017 gegenüber dem Dipl.-Psych., vor zwei Jahren – also im Jahr 2015 – sei in seinem Dorf ein Bruder getötet und er selbst angeschossen worden. Nach seinen Angaben beim Bundesamt und bei Gericht soll sich dieser Vorfall aber im August 2013 auf dem Nachhauseweg von einem Nachbardorf, also unterwegs vor Erreichen des Heimatdorfes, ereignet haben. Gegenüber dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie ... machte er am 12. Januar 2018 wiederum geltend, im Heimatdorf habe ein Angriff einer verfeindeten Glaubensgruppe auf seine Familie stattgefunden, wobei bei dem Angriff sein Bruder
erschossen und das Restaurant der Familie zerstört worden sei (vgl. psychiatrisches Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie ... vom Januar 2018 S. 6 unten). Bei seiner Anhörung durch das Bundesamt hatte er hinsichtlich des von der Familie betriebenen Restaurants lediglich ausgeführt, es sei verkauft worden, weil seine Familie das Haus verlassen und zu einer Cousine gegangen sei. Einerseits soll der Kläger am 19. Juni 2017 beabsichtigt haben, sich von einem Balkon hinunterzustürzen (vgl. fachdienstliche Stellungnahme des Dipl.-Psych. ... vom 29.6.2017), andererseits soll er versucht haben, aus dem Fenster zu springen (vgl. Niederschrift vom 6.4.2018 S. 2 unten). Es ist auch wenig realistisch, dass der Kläger nicht erfahren hat, wer ihn nach dem angeblichen Selbstmordversuch mit Medikamenten am 19. März 2018 bewusstlos aufgefunden und in das Bezirkskrankenhaus ... gebracht hat. Besonders widersprüchlich hat sich der Kläger zu dem Schicksal seines Vaters geäußert. Beim Bundesamt gab er am 30. Mai 2016 an, auf dem Weg von der Türkei nach Griechenland habe er erfahren, dass es seinem Vater sehr schlecht gehe, und am 17. Mai 2016 habe er erfahren, dass sein Vater aufgrund der psychischen Belastung gestorben sei. Gegenüber der behandelnden Ärztin des Bezirkskrankenhauses, im Wiederaufnahmeantrag und in der Klagebegründung vom 18. August 2017 machte er mehr als ein Jahr später geltend, er habe „das Töten seiner Angehörigen“ gesehen, erweckte also den Eindruck, er habe die Ermordung mehrerer Angehöriger – und nicht nur diejenige seines älteren Bruders – mit ansehen müssen. Dementsprechend berichtete er gegenüber Dr. med. ... zunächst, bei dem Überfall, bei dem er selbst Schussverletzungen erlitten habe, seien ein Bruder wie auch der Vater getötet worden (vgl. Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie Dr. med. ... vom 1.10.2017 S. 3). Dann äußerte er jedoch gegenüber Dr. med., während seiner eigenen Flucht sei auch noch sein Vater erschossen worden (vgl. a.a.O. S. 11 unten). Daran anknüpfend äußerte er am 12. Januar 2018 gegenüber dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, als er im Juni 2015 auf seiner Flucht in Griechenland gewesen sei, sei sein Vater bei einem Streit getötet worden. Er habe erst ausgesagt, dass sein Vater auf natürliche Art gestorben sei, weil er Sorge um seine Familie gehabt habe (vgl. psychiatrisches Gutachten des Facharztes für Psychiatrie und Psychotherapie ... vom Januar 2018 S. 4 unten). Demgegenüber trug er erstmals in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2018 vor, seine Mutter habe ihm gegenüber den gewaltsamen Tod seines Vaters zunächst verheimlicht und ihm davon erst sechs Monate nach seiner Ankunft in Deutschland berichtet. 20 Die vom Kläger vorgelegten Atteste haben auch aus einem weiteren Grund keinen Beweiswert. Denn sie setzen sich nicht mit der Problematik auseinander, dass der Kläger die Symptome für das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung erst mehr als drei Jahre nach dem angeblich das Trauma auslösenden Vorfall vom August 2013 geltend gemacht hat. Wird das Vorliegen einer posttraumatischen Belastungsstörung auf traumatisierende Erlebnisse im Heimatland gestützt und werden die Symptome erst längere Zeit nach der Ausreise aus dem Heimatland vorgetragen, so ist in der Regel auch eine Begründung dafür erforderlich, warum die Erkrankung nicht früher geltend gemacht worden ist (vgl. BVerwG, U.v. 11.9.2007 – 10 C 17.07 – juris Rn. 15). Dazu hätte umso mehr Anlass bestanden, als der Kläger die Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung selbst gegenüber seinem Hausarzt erst nach Erhalt des ablehnenden Bundesamtsbescheids vom 10. August 2016 geltend gemacht hat. Soweit der Kläger geltend macht, man habe ihn beim Bundesamt und bei Gericht nicht nach seinen gesundheitlichen Problemen gefragt und ihm keine Gelegenheit gegeben, sich dazu zu äußern, handelt es sich um eine klare Schutzbehauptung. So wurde er zu Beginn seiner Anhörung beim Bundesamt nach seinem gesundheitlichen Befinden gefragt und er verneinte die abschließend gestellte Frage „Haben Sie Ihrem Asylantrag noch etwas hinzuzufügen?“ ausdrücklich. Zudem erklärte er auf Nachfrage, dass er ausreichend Gelegenheit gehabt habe, die Gründe für seinen Asylantrag zu schildern und auch alle sonstigen Hindernisse darzulegen, die einer Rückkehr in sein Heimatland oder in einen anderen Staat entgegenstünden. Psychische Probleme erwähnte er nur hinsichtlich seines Vaters, der durch die psychische Belastung gestorben sei, wie er am 17. Mai 2016 erfahren habe. Erst recht wäre es dem Kläger möglich gewesen, in der schriftlichen Begründung für die Erstklage auf psychische Probleme bei ihm hinzuweisen oder sich hierzu in der mündlichen Verhandlung am 17. März 2017 zu äußern. Insoweit fällt auf, dass er in der mündlichen Verhandlung am 6. April 2018 selbst auf wiederholte Fragen des Gerichts
nach seinen gesundheitlichen Beschwerden von sich aus nur große Angst vor einer Abschiebung und Kniebeschwerden erwähnte. Die Frage nach weiteren gesundheitlichen Beschwerden verneinte er ausdrücklich („Außer dem habe ich nichts an Beschwerden“). Erst auf die suggestive Frage seines Bevollmächtigten, ob er nicht psychische Beschwerden habe, schilderte er verschiedene Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung wie z.B. starke Schlafstörungen und Alpträume. 21 Selbst eine nachgewiesene posttraumatische Belastungsstörung würde nicht zu einer für den Kläger günstigeren Entscheidung führen. Die medizinische Versorgung ist in Pakistan in den staatlichen Krankenhäusern gewährleistet. Bedürftige werden dort kostenlos behandelt. Hierfür genügt bereits die Erklärung des Patienten, dass die Behandlung nicht bezahlt werden könne. Allerdings trifft dies auf schwierige Operationen, z.B. Organtransplantationen, nicht zu. Die Grundversorgung mit nahezu allen gängigen Medikamenten einschließlich Psychopharmaka ist sichergestellt. Für ärztliche Versorgung und Medikamente muss in Pakistan nur ein Bruchteil der in Deutschland hierfür anfallenden Kosten aufgewendet werden, so dass sie für weite Teile der Bevölkerung erschwinglich sind. In den modernen Krankenhäusern in den Großstädten können zudem – unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit – die meisten Krankheiten behandelt werden (vgl. Auswärtiges Amt, Lagebericht Pakistan vom 20.10.2017 IV. 1.2 Medizinische Versorgung S. 25). Insbesondere ergibt sich aus der auf Seite 6 des angefochtenen Bundesamtsbescheids zitierten medizinischen Information des (niederländischen) Medical Advisors Office – MedCOI – vom 27. Januar 2016, dass eine posttraumatische Belastungsstörung und eine damit im Zusammenhang stehende Depression in Pakistan nicht nur medikamentös behandelt werden können, sondern auch eine Behandlung durch Psychiater und Psychologen und mittels einer Psychotherapie möglich ist. 22 b) Bei den beiden vorgelegten Polizeiberichten vom 24. Oktober 2017 und 12. November 2017 handelt es sich zur Überzeugung des Gerichts um Fälschungen. Die Polizeiberichte genügen nicht der ausdrücklich genannten Mindestanforderung, wonach unter dem Bericht die Unterschrift, der Stempel oder der Daumenabdruck des Berichtenden/Anzeigeerstatters vorhanden sein muss. Auch die ID-Kartennummer der Mutter des Klägers fehlt. Zudem ist es völlig unrealistisch, dass den angeblich den Kläger verfolgenden Schiiten aus seinem Heimatdorf verborgen geblieben ist, dass er im Sommer 2015 sein Heimatdorf verlassen hat und nach Europa gereist ist. Des Weiteren ist ein derart massives Verfolgungsinteresse (wiederholtes Erscheinen von vier mit Schusswaffen bewaffneten Männern) auch dann nicht nachvollziehbar, wenn man die Angaben des Klägers zu den Ereignissen vor seiner Ausreise als wahr unterstellt. Im Übrigen geben die vorliegenden Erkenntnismaterialien für eine Verfolgung von Angehörigen der sunnitischen Mehrheitsbevölkerung durch die schiitische Minderheit nichts her. 23 2. Demnach liegen auch die in § 51 Abs. 5 VwVfG i.V.m. §§ 48, 49 VwVfG genannten Voraussetzungen für eine Änderung der unanfechtbaren Entscheidung über ein Abschiebungsverbot nach § 60 Abs. 7 Satz 1 AufenthG nicht vor. Auf die zutreffenden Ausführungen in dem angefochtenen Bescheid (S. 8) wird Bezug genommen (§ 77 Abs. 2 AsylG). 24 Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. Das Verfahren ist gerichtskostenfrei (§ 83b AsylG).
Sie können auch lesen