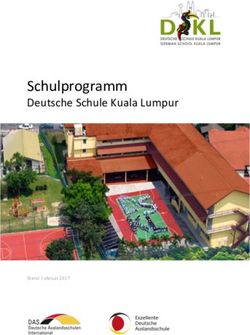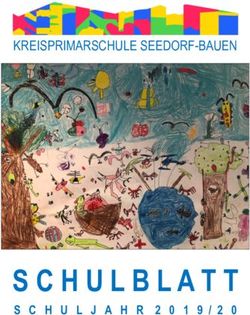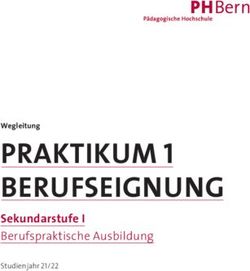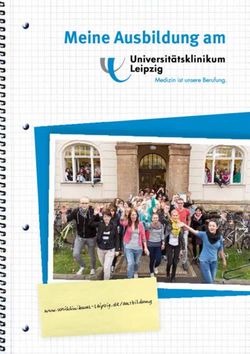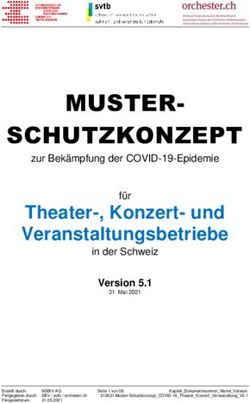Bericht zur Inspektion der Toulouse-Lautrec-Schule - 12S06 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt körperliche und motorische ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bericht
zur Inspektion
der
Toulouse-Lautrec-Schule
12S06
(Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt
körperliche und motorische Entwicklung)
Juni 20191
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 3
1 Rahmenbedingungen der Schule 4
1.1 Voraussetzungen ....................................................................................................................................... 4
1.2 Standort..................................................................................................................................................... 5
2 Ergebnisse der Inspektion 6
2.1 Stärken und Entwicklungsbedarf .............................................................................................................. 6
2.2 Erläuterungen............................................................................................................................................ 6
2.3 Qualitätsprofil .........................................................................................................................................10
2.4 Unterrichtsprofil ......................................................................................................................................11
2.5 Vergleichende Darstellung der prozentualen Verteilung der Bewertungen des Unterrichts.................12
2.6 Vergleichende Darstellung der Bewertungen des Unterrichts anhand des Mittelwerts........................13
3 Daten zur Inspektion 14
3.1 Unterrichtsbesuche .................................................................................................................................14
3.2 Ablauf der Inspektion ..............................................................................................................................16
3.3 Personal/Zuständigkeit ...........................................................................................................................17
4 Bewertungsbogen zum Qualitätsprofil 18
5 Ergebnisse der Online-Befragungen 34
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 2/461
Vorwort
Die Inspektion der Toulouse-Lautrec-Schule wurde im März 2019 durchgeführt. Das Inspektionsteam hat
die Schule von außen in den Blick genommen und gibt mit diesem Bericht eine Rückmeldung zur Qualität
und zum aktuellen Entwicklungsstand der Schule. Die Grundlage für ein gemeinsames Verständnis von gu-
ter Schule ist dabei der Handlungsrahmen Schulqualität in Berlin, der dieses in seinen Qualitätsbereichen
und Qualitätsmerkmalen definiert.
Mit dem Schuljahr 2017/2018 hat die „dritte Runde“ Schulinspektion in Berlin begonnen. Um der Individua-
lität jeder einzelnen Schule gerecht werden zu können, hat die Schulinspektion dabei deutliche Verände-
rungen am Verfahren vorgenommen.1 Der Fokus wird nun auf die Gestaltung der Unterrichtsprozesse, die
Unterrichtsentwicklung mit dem schulinternen Curriculum sowie das Schulleitungshandeln und den Um-
gang mit den Ergebnissen der Schule gelegt.
Bei der Festlegung des Inspektionsrahmens hat das Team das Ergebnis der vorherigen Inspektion, statisti-
sche Daten der Bildungsverwaltung, die Ergebnisse der im Anhang2 einzusehenden Online-Befragungen und
schulspezifische Merkmale berücksichtigt. Für die Inspektion der Toulouse-Lautrec-Schule wurden somit
folgende zusätzliche Qualitätsmerkmale aufgenommen:
E.1 Zusätzliche Sprachförderung
E.2 Ganztag
E.3 Berufs- und Studienorientierung
Darüber hinaus wählte die Toulouse-Lautrec-Schule die Qualitätsmerkmale:
3.2 Schule als Lebensraum
3.3 Kooperationen
Wir bedanken uns bei der Schulgemeinschaft für die Zusammenarbeit und Unterstützung während der
Inspektion und hoffen, der Schule mit diesem Bericht Impulse für die weitere Schulentwicklung zu geben.
Für den weiteren Weg wünschen wir der Schule viel Erfolg.
1
Die kompletten Materialien zur Schulinspektion mit einer ausführlichen Darstellung des Verfahrens stehen unter:
https://www.berlin.de/sen/bildung/unterstuetzung/schulinspektion/
2
Der Anhang ist Bestandteil des ausführlichen Berichts.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 3/461
1. Rahmenbedingungen der Schule
1.1 Voraussetzungen
Die Toulouse-Lautrec-Schule ist seit ihrer Gründung eine gebundene Ganztagsschule und befindet sich im
Bezirk Reinickendorf. Hier lernen Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt
„körperliche und motorische Entwicklung“ sowie den zusätzlichen Förderbedarfen „Lernen“ oder „geistige
Entwicklung". Die Lernenden werden überwiegend mit einem Fahrdienst zur Schule gebracht. Die Schule
erhält Mittel aus dem Bonusprogramm3 der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.
Der Unterricht wird klassen- und jahrgangsübergreifend bei einer Lerngruppengröße zwischen sechs bis
zehn Schülerinnen und Schüler angeboten. Er erfolgt für die Klassenstufen eins bis zehn nach den Rahmen-
lehrplänen der Grundschule, der Integrierten Sekundarschule oder nach den Rahmenlehrplänen „Lernen“
und „geistige Entwicklung“. Im Anschluss an die zehnte Klasse besteht für einige Jugendliche die Möglich-
keit, an einem ein- oder zweijährigen berufsqualifizierenden Lehrgang (BQL) teilzunehmen. Zur Wahl ste-
hen die Berufsfelder „Ernährung und Hauswirtschaft“ oder „Wirtschaft und Verwaltung“. Kinder und Ju-
gendliche mit dem Förderstatus „geistige Entwicklung“ werden in drei Lernstufen unterrichtet (Mittel-,
Ober- und Abschlussstufe). Die Schule weicht von dieser Organisationsform in der Eingangs- und Unterstufe
ab, indem sie die Lernenden bis zur sechsten Klasse in den Regelunterricht einbezieht und erst ab der Mit-
telstufe einen eigenen Klassenverband bildet. Seit dem Schuljahr 2011/2012 ist die Schule „kreidefrei“; die
Unterrichtsräume sind mit interaktiven Whiteboards ausgestattet.
Die Schülerinnen und Schüler der Toulouse-Lautrec-Schule erhalten eine ihrem jeweiligen Bedarf angepass-
te Bildung, Erziehung und Therapie. Einige von ihnen sind schwerstmehrfach behindert, andere wiederum
leiden an Erkrankungen (bspw. Muskeldystrophie) mit progredientem Verlauf. Die Schule setzt auf einen
ganzheitlichen Förderansatz, der die emotionale Begleitung, die Förderung leistungsbezogener Fähigkeiten
sowie Therapie und Pflege berücksichtigt.
Die etwa 180 Kinder und Jugendlichen an der Schule werden von multiprofessionellen Teams (Lehrkräften,
Pädagogischen Unterrichtshilfen, Erzieherinnen und Erziehern, Betreuerinnen und Betreuern) unterrichtet
und betreut. Durch den Jugendgesundheitsdienst Reinickendorf und in Kooperation mit einer Logopädin
werden in den Räumen der Schule therapeutische Maßnahmen (Physio- und Ergotherapie, Logopädie) am
Vor- und Nachmittag durchgeführt. Eine Schulsozialarbeiterin des freien Trägers Trapez e. V. bietet Bera-
tungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie das Kollegium an.
Die personelle Ausstattung der Schule lag zum Inspektionszeitraum bei ca. 98 %. An der Schule sind 87 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter für 26 Klassen zuständig, darunter 44 Lehrkräfte. Mit 30 Stunden erteilen
Sonderpädagoginnen und -pädagogen Hausunterricht. Einige Lehrkräfte sind neben ihrer Unterrichtsver-
pflichtung noch stundenweise mit Beratungsaufgaben im Bezirk tätig. Für die zusätzliche Sprachförderung
stehen vierzehn Unterrichtsstunden pro Woche zur Verfügung. Die Schule ermöglicht regelmäßig Praktika
für Interessierte, die sich im pädagogischen Bereich qualifizieren wollen.
Das Schulleitungsteam besteht aus der langjährig tätigen Schulleiterin, dem ersten und zweiten Konrektor
sowie der koordinierenden Erzieherin. Alle der Schule zustehenden Funktionsstellen sind besetzt.
Umfangreiche Informationen zur personellen und sächlichen Ausstattung der Schule, zur Zahl der Schüle-
rinnen und Schüler sind im Schulverzeichnis des Landes Berlin abgebildet. Dort ist auch der vorherige In-
spektionsbericht zu finden.
Sie gelangen zu den Daten der Toulouse-Lautrec-Schule über die Startseite des Schulverzeichnisses:
https://www.bildung.berlin.de/Schulverzeichnis/
3
Schulen mit einer hohen sozialen Belastung erhalten zusätzliche Mittel zur Förderung der Schülerinnen und Schüler.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 4/461 1.2 Standort Die vorliegenden Standortbedingungen stimmen in wenigen Teilen mit dem Text des vorherigen Inspekti- onsberichts überein. Das zweigeschossige Gebäude der Toulouse-Lautrec-Schule wurde im Jahr 1986 als Förderzentrum bedarfs- gerecht und barrierefrei gebaut. Die breiten Flure sind für rollstuhlfahrende Kinder und Jugendliche mit niedrigen Handläufen versehen, an zentralen Stellen befinden sich Automatiktüren. Mehrere Innen- und Außenfahrstühle sind vorhanden. Ein Leitsystem erleichtert die Orientierung in dem großen Gebäude, das einen sauberen und gepflegten Eindruck macht. Der Hausmeister hat seine Dienstwohnung im Schulgebäu- de. Zum Inspektionszeitpunkt war noch an einigen Stellen in den Fluren die Deckenverkleidung zwecks Er- neuerung der Brandschutzklappen demontiert. Das Foyer bildet eine über beide Etagen offene Halle im Stil eines Wintergartens mit Freitreppe und Empore. Durch die große Glasfront und das Glasdach fällt viel Licht in diesen Bereich, der mit zahlreichen großen Grünpflanzen ansprechend gestaltet ist. Im Schulgebäude finden sich zahlreiche Arbeiten der Kinder und Jugendlichen, die in Vitrinen oder Bilderrahmen ausgestellt sind. Alle Lernenden können kostenlos ein eigenes Schließfach nutzen. Für den Schulsport wird eine große Sporthalle genutzt, die Abstellmöglichkeiten für Sport-Rollstühle bietet. In der Sporthalle finden regelmäßig Turniere und Wettkämpfe statt, an denen auch Schulen aus anderen Bezirken teilnehmen. Ein Therapieschwimmbad mit Geräteraum, stationären Liftern und Pflegeliegen bietet Platz für fünfzehn Personen. Das Schwimmbecken wurde vor wenigen Jahren saniert. Die angeschlossenen Umkleidemöglichkeiten sind mit Dusch- und Wickelliegen sowie Duschrollstühlen ausgestattet. Nach dem Schulbetrieb nutzen auch Vereine das Schwimmbad. Der geräumige Speisesaal bietet Platz für 140 Personen. Dieser ist hell und freundlich gestaltet und verfügt über eine separate Essensausgabe. Die Kinder und Jugendlichen essen an roll- und höhenverstellbaren Ti- schen. Im Bedarfsfall wird der Speisesaal auch als Veranstaltungsraum genutzt. Ergänzend gibt es einen Mehrzweckraum, der mit einer großen Leinwand, einer höhenverstellbaren Bühne sowie Licht- und Ton- technik ausgestattet ist. Die technische Ausstattung der Schule ermöglicht eine umfangreiche Nutzung digitaler Medien im Schulall- tag. Alle Klassenräume haben neben den interaktiven Whiteboards in den sogenannten Medienecken zwei internetfähige Rechnerarbeitsplätze für die Lernenden, die mit dem Computer der Lehrkräfte vernetzt sind. Im Computerraum befinden sich zehn Arbeitsplätze, die alle elektrisch höhenverstellbar sind. Flexibel nutz- bar ist der IT-Koffer mit zehn Tablets und einem Laptop; die Geräte sind über das W-LAN ans Internet an- gebunden. Die Schule verfügt über verschiedene Fachräume. Der Kunstbereich nutzt einen Brennofen für Töpferarbei- ten und seit einem Jahr eine Maschine für das Siebdruckverfahren. Weitere Fachräume sind für Holz- oder Textilarbeit, Musik und Naturwissenschaften eingerichtet. Die Lehrküche, ebenfalls mit höhenverstellbaren Arbeitsplatten, ermöglicht ein barrierefreies Arbeiten. Im Snoezelenraum können vielfältige Übungen zur Sinneswahrnehmung und Muskelentspannung angeboten werden. Vier Räume sind eigens für die am Vor- und Nachmittag stattfindenden therapeutischen Physio-, Ergo- und logopädischen Maßnahmen reserviert. In der Regel bilden zwei Klassenräume inklusive des dazwischen liegenden Gruppenraums eine Lerneinheit. Tische und Stühle der Lernenden sind in den Unterrichtsräumen überwiegend höhenverstellbar. Das Außengelände ist großzügig angelegt. Es umfasst mehrere kleine Spielhöfe und einen Innenbereich zwischen den Gebäudeflügeln. Auf dem Hof ist eine Korbschaukel installiert. Im Schulgarten können die Kinder und Jugendlichen an rollstuhlgerecht konzipierten unterfahrbaren Hochbeeten arbeiten. Die „Spiel- stube“ bietet Rückzugsmöglichkeiten für Groß und Klein, aber auch Spiel- und Arbeitsbereiche. BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 5/46
1
2. Ergebnisse der Inspektion
2.1 Stärken und Entwicklungsbedarf
Stärken
von Empathie und gegenseitigem Respekt geprägte Schulkultur
transparentes und zielorientiertes Handeln der Schulleiterin
vielfältige Kooperationen zur anregenden Ausgestaltung des Schullebens
bedarfsorientierte Fördermaßnahmen und Projekte für die heterogene Schülerschaft
auf die Lernenden individuell abgestimmte Angebote zur Berufsorientierung
Entwicklungsbedarf
stärkere Einbeziehung individualisierter Lernprozesse im Unterricht
abgestimmte Zusammenarbeit zwischen Lehrkräften sowie Erzieherinnen und Erziehern
2.2 Erläuterungen
„Das Leben stellt unsere Schülerinnen und Schüler vor große Herausforderungen. Dafür stärken wir sie.“ ist
Teil und zugleich Kerngedanke des inklusiven Leitbildes, dem sich das Kollegium verpflichtet sieht. In der
Schule wird eine fürsorgliche, freundliche Willkommenskultur gelebt, die den Kindern und Jugendlichen
Struktur, Unterstützung, Anerkennung sowie Herausforderungen für ihre Schullaufbahn bietet und gesell-
schaftliche Teilhabe ermöglicht. Gezielt werden sportliche Veranstaltungen und die Teilnahme an regiona-
len Wettbewerben in das Schulleben integriert. So nehmen Schülerinnen und Schüler an „Jugend trainiert
für Paralympics“ oder am „Toulouse-Lautrec-Brennballcup“ teil, den die Lehrkräfte des Sportfachbereiches
als ein berlinweites Brennballturnier neben der „Rollstuhlbasketball Schulliga Berlin“ an verschiedenen
Sportstätten organisieren und ausrichten. Ab der siebten Klasse werden die Kinder und Jugendlichen durch
den monatlichen Refresher „Kraft- und Muskelprogramm“ dazu ermuntert, einfache Übungen in ihrer Frei-
zeit durchzuführen. Wöchentlich erhalten die Erst- bis Sechstklässler im hauseigenen Therapieschwimmbe-
cken Schwimmunterricht. Für Schülerinnen und Schüler mit geistiger Entwicklungsverzögerung besteht
dieses Förderangebot bis zur Abschlussstufe. Seit Jahren gibt es eine feste Zusammenarbeit mit dem Ge-
sundheitsdienst des Bezirks, der ergo- und physiotherapeutische Maßnahmen Vorort in Einzel- oder Grup-
pensituationen durchführt.
Durch gezielte und dem Schulprofil Rechnung tragende Vernetzung mit Kooperationspartnern, die sich
organisatorisch, finanziell und mitunter auch personell einbringen, schafft die Schule für ihre Schülerinnen
und Schüler ein abwechslungsreiches Angebot an Aktivitäten. Während Alba-Berlin sich u. a. an den Rolli-
Basketballturnieren beteiligt, realisiert „Herzenswünsche e. V.“ eine Reittherapie oder eine ganztägige
Fahrt mit der Schülerschaft und dem pädagogischen Personal in einen Freizeitpark. Klavierunterricht richtet
die Musikschule Reinickendorf aus. Parallel finanziert die Schule über die Personalkostenbudgetierung und
das Bonusprogramm zusätzliche Arbeitsgemeinschaften im kreativen Bereich, z. B. Töpferkurse oder Medi-
enprojekte, die auch die Erstellung von Kurzvideos beinhalten. Darüber bindet sie auch das tägliche Bera-
tungsangebot der Sozialarbeiterin ein, die aktiv in Schulentwicklungsprozesse einbezogen wird. Die Schule
präsentiert sich auch nach außen und wirbt z. B. für einen regelmäßigen Austausch mit der benachbarten
Grundschule durch gegenseitige Einladungen zu Festen, Aufführungen oder auch Fortbildungsveranstaltun-
gen für Lehrkräfte. Darüber hinaus kooperiert sie bzw. das Kollegium im Rahmen der „Qualitätsoffensive
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 6/461
Lehrerbildung4“ mit der Universität Potsdam und ermöglicht unterschiedlichen Berufsgruppen Hospitati-
ons- und Praktikumsmöglichkeiten. Überzeugend und medial wirkungsvoll aufbereitet gelingt es der Schule,
neue Kooperationen einzugehen und die Bestehenden zu pflegen, um das Lern- und Freizeitangebot im
Interesse der Schülerinnen und Schüler vielfältig und inklusiv zu gestalten.
Die Ausgestaltung des Schullebens sowie die Steuerung der Entwicklungsprozesse lenkt die Schulleiterin
durch einen partizipativen Führungsstil. Sie bindet die beteiligten Gruppen zielgerichtet in Veränderungs-
und Beteiligungsprozesse ein, indem sie umfassend informiert, Ideen aufgreift, Entscheidungen transparent
darlegt und für eine konstruktive Arbeitsatmosphäre sorgt. In der regelmäßig tagenden Steuergruppe wer-
den beispielsweise Studientage sowie Dienstbesprechungen vor- und nachbereitet, Fortbildungsthemen
abgestimmt, Themen der Fachkonferenzleitungen aufgegriffen oder die Weiterarbeit am schulinternen
Curriculum vorstrukturiert. Konferenz- und Sitzungstermine werden protokolliert und sind für das Kollegi-
um im geschützten „internen Bereich“ der aktuellen, informativen Schulhomepage jederzeit einsehbar.
Diese ist gleichzeitig Informations- und Arbeitsmedium für das Kollegium. Hier kann u. a. der Stand zur
schulprogrammatischen Arbeit eingesehen werden, Termine werden kommuniziert oder die Lehrkräfte
tauschen sich zu Unterrichtsinhalten aus. Zusätzlich gibt es Stellwände im Lehrkräftezimmer mit Hinweisen
zu inner- oder außerschulischen Veranstaltungen, zu anstehenden Konferenz- und Gremienterminen oder
der Gesamtelternversammlung. Die Zusammenarbeit des Schulleitungsteams, zu der auch die koordinie-
rende Erzieherin gehört, ist vertrauensvoll und aufeinander abgestimmt, die Aufgabenverteilung sachbezo-
gen und verlässlich. Vom Kollegium und den Eltern wird besonders anerkannt, dass die Schulleitungsmit-
glieder eine Kultur der offenen Tür pflegen. Insbesondere die Schulleiterin ist detailliert über die Entwick-
lungs- und Lebensumstände der Kinder und Jugendlichen informiert und steht sowohl schulintern als auch
mit Externen im engen Austausch.
Im Bereich der Unterrichtsentwicklung wurde vor knapp eineinhalb Jahren mit der Erarbeitung des schulin-
ternen Curriculums begonnen. Verantwortlich sind die Fachkonferenzvorsitzenden, die sich an einem Zeit-
plan orientieren können, der die Fertigstellung für das Jahr 2020 vorsieht. Der Austausch hierzu fand an
Studientagen, in Fachkonferenzen und auch in Dienstbesprechungen statt, stellenweise mit thematischer
Unterstützung aus dem regionalen Fortbildungsangebot. Die Lehrkräfte einigten sich auf eine einheitliche
Matrix für die Fachcurricula sowie für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“, die mit Ausnahme
des Faches Musik vorliegen und erste Bezüge zu übergeordneten Themen (ÜT), zur Sprach- und Medienbil-
dung sowie zum Schulprogramm aufzeigen. Im ersten Schritt haben sich die Mitglieder der Fachkonferen-
zen auf Themenfelder geeinigt, die für Doppeljahrgangsstufen erarbeitet werden. Dabei variiert der Ar-
beitsstand zwischen den Fächern von detailliert ausgearbeitet bis hin zu Stoffverteilungsplänen, bei denen
Bezüge zu anderen Fächern oder Projekten noch unkonkret sind. Parallel zur curricularen Arbeit erfolgte die
Fortschreibung des Schulprogrammes, dem als Entwicklungsvorhaben die Leistungsbewertung unter Be-
rücksichtigung des vielfältigen und besonderen Unterstützungsbedarfs der Lernenden zu entnehmen ist.
Die separaten, fachübergreifenden Erarbeitungen der Basiscurricula zur Sprach- und Medienbildung sowie
zu den schulintern verabredeten ÜT, welche zu erwerbende Kompetenzen über die Fächer und Jahrgänge
hinweg ausweisen sollen, stehen derzeit noch aus. Ein Studientag zum Auftakt der Erstellung des Medien-
konzepts hat kürzlich stattgefunden. Verabredet wurden die Auseinandersetzung mit dem Thema „Unter-
stützte Kommunikation“ und der Einsatz von technischen Hilfsmitteln und Anwendungsprogrammen. Dies
ist für Kinder oder Jugendliche wichtig, die sich nicht oder nur eingeschränkt über die Lautsprache mitteilen
können. „Gut und Böse“ ist das Motto, das präventiv für die verantwortungsvolle Nutzung des Internets
sensibilisiert und in allen Klassen durchgeführt wird. Die Kooperation mit dem Medienzentrum „Clip“ er-
möglicht interessierten Jugendlichen weiterführende Inhalte, beispielsweise zur Bildbearbeitung. Die Schu-
le, die seit acht Jahren „kreidefrei“ ist, fördert bei ihren Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung
mit digitalen Medien, was sich auch im Unterricht zeigt.
Es bestätigt sich erneut, dass der Unterricht an der Toulouse-Lautrec-Schule von einer lernförderlichen und
schülerzugewandten Unterrichtsatmosphäre geprägt ist. Daran haben alle am Schulleben Beteiligten ihren
Anteil. Die Klassenräume sind einladend u. a. mit Schülererarbeiten, Ämterkarten sowie Lernplakaten ge-
4
Weitere Informationen unter: www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 7/461 staltet, ebenso verfügen sie über ein reichhaltiges Angebot von Spiel- und Lernmaterialien. Überwiegend sind zwei oder drei Erwachsene in den Unterricht eingebunden. Sie gehen auf die unterschiedlichen Unter- stützungsbedürfnisse der Lernenden zugewandt und individuell ein. Dabei findet größtenteils eine auf Ab- sprache basierende Zusammenarbeit sowie eine effiziente Nutzung der Unterrichtszeit statt. Häufig infor- mieren die Lehrkräfte zu Stundenbeginn über den geplanten Inhalt oder die Tagesstruktur, lassen dabei Vermutungen anstellen oder binden Fachrequisiten ein. Kleine Bewegungsübungen, Lernspiele oder die Arbeit an Lernstationen lockern das Unterrichtsgeschehen auf, das überwiegend motivierend und anregend gestaltet ist. Die Lehrkräfte vermitteln in allen Jahrgängen fachliche Inhalte. Sie stellen insbesondere in den höheren Klassenstufen sowie in der Schülerfirma „Cake Club“ und im berufsqualifizierenden Lehrgang (BQL) Bezüge zu anderen Unterrichtsfächern oder zur Lebenswelt der Jugendlichen her. So findet z. B. die Vorbe- reitung einer Kurzpräsentation für Deutsch zum Thema „Berufswahl“ im ITG-Kurs statt, zur Optimierung des eigenen Lernverhaltens wird ein Kurzfilm mit Lerntipps gedreht, das Projekt „Dinosaurier“ bezieht musikali- sche, künstlerische, mathematische und sprachfördernde Elemente ein. Generell treten die Lehrkräfte als Sprachvorbilder auf. Sie achten auf eine korrekte Satzbildung und Aussprache, ebenso werden Fachbegriffe geklärt. Insbesondere Lese- und Sprechanlässe werden regelmäßig geschaffen, Schreibanlässe dagegen weniger. Im Vergleich zur letzten Inspektion setzten die Lehrkräfte gemeinsam mit den pädagogischen Mit- arbeiterinnen und Mitarbeitern nur noch in etwa der Hälfte der Stunden unterschiedliche und schülerakti- vierende Methoden ein. Insgesamt dominiert die Anleitung durch die Lehrerinnen und Lehrer, auf die das Üben oder die Bearbeitung neuer Aufgabenstellungen in Einzelarbeit folgt. Elemente kooperativer Arbeitsformen sind im Vergleich zur letzten Inspektion seltener Bestandteil des Un- terrichts. Wenn jedoch Partner- oder Gruppenarbeitsaufträge durch die Lehrkraft initiiert werden, helfen sich die Lernenden untereinander, kontrollieren gegenseitig ihre Arbeitsergebnisse oder besprechen sich zum Arbeitsablauf. Dabei begegnen sich die Kinder und Jugendlichen untereinander rücksichtsvoll und un- terstützend. Die Förderung von Teamkompetenzen oder teamorientierten Aufgabenstellungen treten noch in den Hintergrund. Der Unterricht enthält vielfach kleinschrittig gestaltete Phasen und wird stark durch die Lehrenden gelenkt. Bei Schwierigkeiten im Aufgabenverständnis oder im Arbeitsprozess motivieren, ermu- tigen und unterstützen die Lehrkräfte gemeinsam mit den weiteren am Unterricht beteiligten Erwachse- nen. Den Warte- und Leerlaufphasen im Stundenverlauf begegnen die Kinder- und Jugendlichen geduldig. Im Bereich der Individualisierung liegen die Ergebnisse in der Gesamtauswertung jetzt knapp unter dem Berliner Mittelwert der Schulart. Der Anteil der Stunden, in denen die Schülerinnen und Schüler nach indi- viduellem Vermögen eigenständig Verantwortung für ihren Lernprozess übernehmen, hat sich deutlich verringert. Fragestellungen ohne vorgegebenen Lösungsweg, die zum Forschen und Nachdenken anregen oder einen Austausch über mögliche Strategien erfordern, sind die Ausnahme. Jedoch geben die Lehrkräfte Raum für den gemeinsamen Austausch über die gewählten Lösungswege in der Lerngruppe. Kurze, gezielte Einzelförderung findet in allen Jahrgangsstufen statt. Differenziert gestaltete Lernangebote, wie das Arbei- ten an Lernstationen, unterstützende Zusatz- und Fördermaterialien oder Aufgaben mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sind vermehrt in Klasse eins bis sechs eingebunden. Unabhängig von der Jahrgangs- stufe ist die digitale Medienbildung oftmals Bestandteil im Unterricht. Die Kinder und Jugendlichen sind in kleinen Rechercheaufträgen an den Klassencomputern geübt und nutzen darüber hinaus selbstständig digi- tale Lernprogramme. Ebenso können viele von ihnen mit dem interaktiven Whiteboard umgehen, das häu- fig durch die Lehrkräfte unter Verwendung digitaler Lehrwerke in den Unterricht einbezogen wird. Fast alle Kinder und Jugendlichen der Schule nehmen am gebundenen Ganztag teil. Der Unterricht findet bis zum Mittagsband statt, am Nachmittag folgen Betreuung, Arbeitsgemeinschaften und an zwei bis drei Tagen in der Woche Unterrichtsangebote. Therapeutische Maßnahmen sind über den gesamten Tag ver- teilt, ebenso die individuelle Begleitung durch Erzieherinnen und Erzieher, Betreuerinnen und Betreuer oder Honorarkräfte. Die Rhythmisierung des Schultages im Sinne gezielter An- und Entspannungszeiten berücksichtigt auch die spontane Schaffung von Rückzugsmöglichkeiten für die Lernenden und sowie das fürsorgliche Eingehen auf individuelle Bedürfnisse. Für die Klassen sind Bezugserzieherinnen und -erzieher zuständig. Fest im Nachmittagsbereich etabliert sind die Hausaufgabenzeit sowie kreative Bastel- und Ge- staltungsangebote, z. B. Korbflechten, Filzen oder Töpfern. Zusätzliche Wahlmöglichkeiten bieten u. a. die Rollstuhl- oder Fußball-AG, die Cheerleader-Gruppe, die Pflege des Schulgartens und seit kurzem auch BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 8/46
1 Zumba. Elemente zum sozialen Lernen werden über das Spielen einbezogen, nicht aber systematisch aus dem Vormittagsbereich weitergeführt. Gleiches lässt sich auch zur Medien- und Sprachbildung feststellen. Gezielte und gemeinsam vereinbarte Absprachen innerhalb des Kollegiums stehen noch aus und wurden im Rahmen der Mitarbeit am schulinternen Curriculum bislang nicht vereinbart. Individuell und bezogen auf ihre Lerngruppe binden einzelne Erzieherinnen und Erzieher kleine Leseübungen oder Spiele, die u. a. eine Wortbildsicherung beinhalten, in die Nachmittagsgestaltung ein. Obwohl Strukturen zur Beteiligung an schulischen Entwicklungsprozessen und zur Förderung der Zusammenarbeit aller Berufsgruppen durch die Schulleitung angelegt sind, werden diese nicht einheitlich genutzt. Mitteilungen oder gar Absprachen zwi- schen Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern erfolgen oft auf Zuruf. Das eigentlich hierfür reservierte Zeitfenster am wöchentlichen Gremientag nutzen wenige Klassenteams, obwohl es hierzu eine Absprache gibt. Die Zusammenarbeit innerhalb des Erzieherteams ist durch ein uneinheitliches Aufgabenverständnis und Kommunikationsschwierigkeiten geprägt. Eine Auswirkung ist, dass bereits im zweiten Jahr keine Feri- enfahrt in das Landschulheim Walter May organisiert werden konnte. Für das kommende Schuljahr ist da- her als teambildende Maßnahme Supervision unter externer Anleitung geplant. Vorbereitet wird dies durch die Schulleitung in Absprache mit der koordinierenden Erzieherin. Ein wichtiger schulischer Schwerpunkt ist die Beratung und Unterstützung der Jugendlichen bei der Berufs- orientierung, die jetzt durch ein BSO-Team koordiniert wird. Die berufsorientierenden Maßnahmen und Angebote sind jahrgangsbezogen und bauen aufeinander auf. Sie sehen eine enge Begleitung durch die Lehrkräfte vor. In den siebten Klassen stehen die Veranschaulichung beruflicher Möglichkeiten und der Einstieg mit der Arbeit des Berufswahlpasses, in dem bis zum Schulabschluss u. a. die erfolgten berufsorien- tierenden Maßnahmen dokumentiert werden, im Mittelpunkt. Die Schülerinnen und Schüler besuchen im Rahmen des Berufsorientierungsprogrammes (BOP) das Annedore-Leber-Berufsbildungswerk (ALBBW) und absolvieren hier in der achten Klasse eine zweitägige Potentialanalyse sowie ein zweiwöchiges Praktikum in den Werkstätten, Laboren oder dem Lernbüro. Neben dem regulären dreiwöchigen Betriebspraktikum in der neunten Klasse bringen sich interessierte Jugendliche in die Schülerfirma „Cake Club“ ein. Wöchentlich produzieren sie Backwaren, die an die Schulgemeinschaft verkauft werden. Auch im zehnten Jahrgang fin- det ein Praktikum statt. Die Praktika werden durch die Lehrkräfte begleitet und individuell mit den Lernen- den ausgewertet. Die Heranwachsenden und deren Eltern werden zudem engmaschig durch die Schulsozi- alarbeiterin und die Agentur für Arbeit persönlich beraten und begleitet. Einige Jugendliche wechseln in die von der Schule angebotenen berufsqualifizierenden Lehrgänge (BQL), die ihnen einen erhöhten Praxisanteil bieten. Ziel ist es, in kleinen Lerngruppen den Berufseinstieg vorzubereiten, den Übergang in Werkstätten zu erleichtern oder einen höherwertigen Schulabschluss zu erreichen, dies können die Berufsbildungsreife (BBR) oder die erweiterte Berufsbildungsreife (eBBR) sein. Der Toulouse-Lautrec-Schule gelingt es seit vielen Jahren engagiert und überzeugend, die ihnen anvertrau- ten Kinder und Jugendlichen in vielfältiger Weise zu unterstützen, ihre individuellen Fähigkeiten auszubil- den sowie personale und soziale Kompetenzen zu stärken. BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 9/46
1
2.3 Qualitätsprofil5
Bewertung
Qualitätsbereich 1: Qualitätsentwicklung
2011/2012 2018/2019
1.1 Schulprogramm B *
1.2 Interne Evaluation A *
Bewertung
Qualitätsbereich 2: Unterricht, Lehr- und Lernprozesse
2011/2012 2018/2019
2.1 Schulinternes Curriculum/Unterrichtsentwicklung A B
2.1.a Sprachbildung * B
2.1.b Medienbildung * B
2.2 Unterrichtsgestaltung siehe Unterrichtsprofil
2.3 Systematische Förderung und Beratung A A
Bewertung
Qualitätsbereich 3: Schulkultur
2011/2012 2018/2019
3.1 Beteiligung A *
3.2 Schule als Lebensraum A A
3.3 Kooperationen * A
Bewertung
Qualitätsbereich 4: Schulmanagement
2011/2012 2018/2019
4.1 Schulleitungshandeln und Schulgemeinschaft A A
4.2 Schulleitungshandeln und Qualitätsmanagement A A
Bewertung
Qualitätsbereich 5: Professionalisierung und Personalmanagement
2011/2012 2018/2019
5.1 Personalentwicklung und Personaleinsatz A *
5.2 Arbeits- und Kommunikationskultur im Kollegium A *
Bewertung
Qualitätsbereich 6: Ergebnisse der Schule
2011/2012 2018/2019
6.1 Schulleistungsdaten und Schullaufbahn A A
Bewertung
Schulspezifische Qualitätsmerkmale
2011/2012 2018/2019
E.1 Zusätzliche Sprachförderung * B
E.2 Ganztag B B
E.3 Berufs- und Studienorientierung * A
E.5 Schulprofil # *
* (nicht bewertet): Dieses Qualitätsmerkmal war im Inspektionsrahmen der vorherigen Inspektion nicht ent-
halten bzw. es ist im Inspektionsrahmen dieser Inspektion nicht enthalten.
5
Das Qualitätsprofil der Toulouse-Lautrec-Schule beinhaltet verpflichtende Qualitätsmerkmale (grau unterlegt) und schulspezifi-
sche Merkmale. Hierzu und zur Definition der Bewertungen siehe Kapitel 4.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 10/461
2.4 Unterrichtsprofil
6
Mittelwert
Unterrichtsbedingungen ++ + - --
2011/2012 2018/2019
2.2.1 Lehr- und Lernzeit 75 % 20 % 5% 0% 3,87 3,70
2.2.2 Lern- und Arbeitsbedingungen 98 % 3% 0% 0% 3,92 3,98
2.2.3 Strukturierung und transparente Zielausrichtung 48 % 53 % 0% 0% 3,54 3,48
2.2.4 Kooperation des pädagogischen Personals
44 % 52 % 4% 0% 3,71 3,41
(bewertet in xx Unterrichtssequenzen)
2.2.5 Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht 98 % 3% 0% 0% 3,95 3,98
2.2.6 Pädagogisches Klima im Unterricht 93 % 8% 0% 0% 3,95 3,93
2.2.7 Förderung der Leistungs- und Anstrengungsbereit-
65 % 30 % 3% 3% 3,82 3,58
schaft
Mittelwert
Unterrichtsprozess ++ + - --
2011/2012 2018/2019
2.2.8 Reflexion des Lernprozesses 5% 13 % 25 % 58 % * 1,65
2.2.9 Fachimmanentes, fachübergreifendes und
28 % 73 % 0% 0% 3,64 3,28
fächerverbindendes Lernen
2.2.10 Methodenwahl 55 % 43 % 0% 3% 3,64 3,50
2.2.11 Medienbildung 8% 28 % 5% 60 % * 1,83
2.2.12 Sprachbildung 45 % 45 % 8% 3% 3,51 3,33
Mittelwert
Individualisierung von Lernprozessen ++ + - --
2011/2012 2018/2019
2.2.13 Innere Differenzierung 15 % 43 % 15 % 28 % 2,95 2,45
2.2.14 Selbstständiges Lernen 8% 23 % 25 % 45 % 2,82 1,93
2.2.15 Kooperatives Lernen 8% 18 % 40 % 35 % 2,46 1,98
2.2.16 Problemorientiertes Lernen 5% 13 % 25 % 58 % 2,69 1,65
Die Symbole in der Bewertungsskala sind folgendermaßen definiert:
++ trifft zu
+ trifft eher zu
- trifft eher nicht zu
-- trifft nicht zu
6
Für die Berechnung des Mittelwerts sind der Bewertung „++“ der Wert 4, der Bewertung „+“ der Wert 3, der Bewertung „-“ der
Wert 2 und der Bewertung „- -“ der Wert 1 zugeordnet.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 11/461
2.5 Vergleichende Darstellung der prozentualen Verteilung der Bewertungen des Unterrichts
Unterrichtsbedingungen
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7
++ + - --
Unterrichtsprozess
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2011/2012
2018/2019
2.2.8 2.2.9 2.2.10 2.2.11 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16
++ + - --
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 12/461
2.6 Vergleichende Darstellung der Bewertungen des Unterrichts anhand des Mittelwerts 7
Schule - Berlin
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.9 2.2.10 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16
MW Berlin 12S06 MW 2011/2012 12S06 MW 2018/2019
Schule - Schulart
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7 2.2.9 2.2.10 2.2.12 2.2.13 2.2.14 2.2.15 2.2.16
MW Schulen mit sopäd. Förderschwerpunkt 12S06 MW 2011/2012 12S06 MW 2018/2019
7
Das Profilmerkmal 2.2.4 „Kooperation des pädagogischen Personals“ wurde bei der vorherigen Inspektion nicht bewertet.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 13/461
3. Daten zur Inspektion
3.1 Unterrichtsbesuche
Anzahl der besichtigten 20-minütigen Unterrichtssequenzen 40
Anfangssequenzen Mittelsequenzen Endsequenzen
19 8 13
Größe der gesehenen Lerngruppen
≤ 5 Schüler ≤ 10 Schüler ≤ 15 Schüler ≤ 20 Schüler ≤ 25 Schüler ≤ 30 Schüler > 30 Schüler
18 22 0 0 0 0 0
durchschnittliche Lerngruppenfrequenz 6
Verspätungen Anzahl der Schüler/innen Anzahl der Sequenzen
0 0
eingesetzte Medien8
neue bzw. digitale Medien Printmedien
Computer als Arbeits-
15 % 15 % Fachbuch/Lehrbuch
Präsentationsmittel
60 % interaktives Whiteboard 3% ergänzende Lektüre
Nachschlagewerke (z. B. Duden,
5% Dokumentenkamera 3%
Tabellen, etc.)
8% Notebook/Tablet/Smartphone sonstige Medien
analoge, visuelle Medien 48 % Heft/Hefter/Arbeitsheft
5% Tafel/Whiteboard 58 % Arbeitsblätter/Aufgabenblätter
Fachrequisiten (für die Hand der
- OHP 35 %
Schüler/innen)
Plakat, Flipchart, Pinnwand, Wandzei- Fachrequisiten (Demonstrations-
18 %
tung gegenstände, Modelle, Werkzeu-
10 %
ge u. ä. für die Hand der Lehr-
5% Audiomedien
kraft)
8
prozentuale Angabe bezogen auf die Anzahl der gesehenen Unterrichtssequenzen
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 14/461
wesentliche Elemente/Aktivitäten im Unterricht9
- Lehrkraftvortrag/Lehrkraftpräsentation 8% Stationenlernen/Lernbuffet
48 % Anleitung durch die Lehrkraft - Tagesplan/Wochenplan
23 % Unterrichtsgespräch - Lernwege/Kompetenzraster
18 % Fragend-entwickelndes Gespräch - Lerntagebuch, Portfolio
10 % Schülervortrag/Schülerpräsentation 13 % Entwerfen/Planen
- Brainstorming 3% Untersuchen/Analysieren
- Diskussion/Debatte/Gesprächskreis - Experimentieren
68 % Bearbeiten neuer Aufgaben 3% Konstruieren/Produzieren
Bewegungs-
45 % Üben/Wiederholen 10 %
/Entspannungsübungen
13 % Kontrollieren von (Haus-)Aufgaben 10 % Lernspiel/Planspiel/Rollenspiel
PC waren vorhanden in 93 %
Verteilung der Sozialformen in den gesehenen Unterrichtssequenzen
Sozialform Frontalunterricht Einzelarbeit Partnerarbeit Gruppenarbeit
prozentuale Verteilung10 58 % 60 % 13 % 20 %
Die Besuche waren über alle Jahrgangsstufen verteilt. Das Inspektionsteam sah im Rahmen der Unter-
richtsbeobachtungen 97 % der an den Inspektionstagen unterrichtenden Pädagoginnen und Pädagogen der
Schule.
9
prozentuale Angabe bezogen auf die Anzahl der gesehenen Unterrichtssequenzen
10
Die Summe kann über 100 % liegen, da in einer Unterrichtssequenz mehrere Sozialformen beobachtet werden können.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 15/461
3.2 Ablauf der Inspektion
Online-Befragungen vom 21.01.2019 bis 04.02.2019
Vorgespräch 12.02.2019
40 Unterrichtsbesuche 11.03.2019 und 13.03.2019
Präsentation der Schule durch die Schulleiterin 11.03.2019
Schulrundgang 12.02.2019
Interview mit sechs Schülerinnen und Schülern11
Interview mit elf Lehrerinnen und Lehrern
Interview mit der koordinierenden Erzieherin 11.03.2019
Interview mit sechs Erzieherinnen
Interview mit vier Erziehungsberechtigten
Interview mit der Schulleiterin
13.03.2019
Interview mit dem ersten Konrektor
Gespräche mit der Sekretärin, dem Schulhausmeister und der
11.03.2019 und 13.03.2019
Schulsozialarbeiterin
Präsentation des Berichts 08.08.2019
11
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Gruppeninterviews hatte das Inspektionsteam im Rahmen des Vorgesprächs ausge-
wählt. Auf eine angemessene Berücksichtigung der Gremienvertreterinnen und Gremienvertreter wurde geachtet.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 16/461
3.3 Personal/Zuständigkeit
Schulleitung
Schulleiterin Frau Eling
stellvertretender Schulleiter Herr Kiermeier
zweiter Konrektor Herr Richau
pädagogisches Personal
Lehrkräfte 38
Sozialpädagogin 1
Erzieherinnen und Erzieher 11
Betreuerinnen und Betreuer 25
Päd. Unterrichtshilfen 5
Unterrichtsversorgung
Prozentuale Ausstattung zum Inspektionszeitpunkt 97,4 %
weiteres Personal
Sekretärin 1
Schulhausmeister 1
Zuständigkeit
Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, vertreten durch den zuständigen Stadtrat
Schulbehörde
Herrn Dollase
Schulaufsicht Herr Wasmuth
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 17/461
4. Bewertungsbogen zum Qualitätsprofil
Normierungstabelle
Die Bewertung der einzelnen Merkmale innerhalb des Qualitätsprofils erfolgt über Indikatoren. Die folgende Tabelle zeigt die für die entsprechende Bewertung
eines Qualitätsmerkmals erforderliche Mindestzahl an Indikatoren, die mit „trifft zu“ oder „trifft eher zu“ bewertet sein müssen.
In den Klammern ist die Anzahl der Indikatoren angegeben, die mindestens mit „trifft zu“ bewertet sein müssen.
Anzahl der mit „trifft zu“ bzw. „trifft eher zu“ bewerteten Indikatoren
Bewertung
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17
A
(1) (1) (2) (2) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (7) (7) (8) (8) (8)
B 2 2 2* 3 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
C 1 1 2 2 2 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8
* Bei zwei positiven Bewertungen muss eine der beiden mindestens „++“ sein, bei mehr als zwei positiven Bewertungen gilt diese Zusatzbedingung für die Bewertung „B“ nicht
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 18/461
Qualitätsbereich 2: Unterricht, Lehr- und Lernprozesse
2.1 Schulinternes Curriculum / Unterrichtsentwicklung
Qualitätskriterien Wert
2.1.1 Schulinternes Curriculum
1. Das schulinterne Curriculum enthält fachbezogene, kompetenzorientierte Festlegungen für alle
12 +
Jahrgangsstufen/Bildungsgänge.
2. Für allgemeinbildende Schulen:
Im schulinternen Curriculum sind die Vereinbarungen zu den Teilen A und B des Rahmen-lehrplans -
schulspezifisch integriert.
3. Für allgemeinbildende Schulen:
Indikatoren
Für das Basiscurriculum Sprachbildung ist der Kompetenzerwerb jahrgangsspezifisch (horizontale
Verknüpfungen zwischen den Fächern/Lernbereichen) und jahrgangsübergreifend (vertikal aufstei-
gende Verknüpfungen) ausgewiesen. +
Für berufsbildende Schulen:
Der Kompetenzzuwachs in der Sprachbildung ist bildungsgangspezifisch ausgewiesen.
4. Für allgemeinbildende Schulen:
Für das Basiscurriculum Medienbildung ist der Kompetenzerwerb jahrgangsspezifisch und jahr- -
gangsübergreifend ausgewiesen.
5. Für übergreifende Themen ist der Kompetenzerwerb jahrgangsspezifisch und jahrgangsübergrei-
-
fend bzw. bildungsgangspezifisch ausgewiesen.
2.1.2 Unterrichtsentwicklung
1. Unterrichtsentwicklung ist fester Bestandteil der Besprechungen in den Fachkonferenzen, Jahr-
-
gangsstufenteams/Bildungsgangkonferenzen und/oder anderen Teams.
2. In den Fachkonferenzen, Jahrgangsstufenteams/Bildungsgangkonferenzen und/oder anderen
+
Teams werden konkrete Unterrichtsvorhaben abgestimmt.
Indikatoren
3. In den Fachkonferenzen, Jahrgangsstufenteams/Bildungsgangkonferenzen und/oder anderen
+
Teams werden Unterrichtsmethoden und der Einsatz von Lehr- und Lernmaterialen abgestimmt.
4. Die Maßnahmen zur Unterrichtsentwicklung werden in der Schule umgesetzt. +
5. Die Fachverantwortlichen informieren regelmäßig über die Inhalte der Regionalkonferenzen der
++
Fächer (spezielle Regionalkonferenzen für berufsbildende Schulen).
6. Für berufsbildende Schulen:
Es gibt Abstimmungen des Lehr- und Lernangebots mit anderen Schulen bzw. Betrieben und über- #
betrieblichen Ausbildungsstätten.
2.1.3 Anwendungsbezug der Lehr- und Lerngegenstände
1. Im Unterricht werden Themen projektorientiert behandelt. ++
Indikato-
ren
2. Fachübergreifende und/oder fächerverbindende Projekte sind in den Unterricht implementiert. +
3. Die Schule nutzt systematisch die besonderen Lernerfahrungen an außerschulischen Lernorten. ++
2.1.4 Leistungsbewertung
1. Das schulinterne Curriculum enthält Festlegungen zur Leistungsbewertung. +
2. Für die Fächer liegen konkrete und aktuelle Beschlüsse zur Leistungsbewertung vor. +
Indikatoren
3. Für die Schülerinnen/Schüler/Auszubildenden/Studierenden sind die Kriterien der Leistungsbewer-
+
tung in den Fächern transparent.
4. Die Lehrkräfte sorgen dafür, dass die Schülerinnen/Schüler/Auszubildenden/Studierenden kontinu-
+
ierlich über den Leistungsstand informiert sind.
5. Für allgemeinbildende Schulen:
+
Die Erziehungsberechtigten werden über die Bewertungsmaßstäbe informiert.
Bewertung A B C D
zusätzliche Normierungsbedingung:
A: in jedem Kriterium mindestens 1 Indikator +; 2.1.a und 2.1.b mindestens „C“
12
Die Indikatoren zur Inklusion sind durch eine Unterstreichung gekennzeichnet.
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 19/461
2.1.a Sprachbildung
Qualitätskriterien Wert
2.1.a.1 Durchgängige Sprachbildung
1. Eine Sprachbildungskoordination unterstützt aktiv die schulischen Gremien bzw. Arbeitsgruppen (z.
B. Sprachbildungskoordinator/in, Steuergruppe oder professionelle Lerngemeinschaft zur Sprachbil- ++
dung).
2. Die Schule verständigt sich über sprachbildende Maßnahmen bzw. Methoden zur Unterstützung der
Ziele im Unterricht (z. B. Spracherwerb, Training von Lese-/Schreibflüssigkeit, Vermittlung von Lese-
+
/Schreibstrategien, Bewertungsgrundlage für mdl./schriftl. Beiträge, Absprachen zu Operatoren, Er-
höhung des Sprachanteils durch kommunikative Lernarrangements).
3. Die Fachkonferenzen stimmen sich über ihren Beitrag zur durchgängigen Sprachbildung ab
-
(fachspezifische Konkretisierung im schulinternen Curriculum).
Indikatoren
4. Schülerinnen/Schüler/Auszubildende/Studierende mit sprachlichen Schwierigkeiten werden durch
Angebote zielgerichtet gefördert (z. B. Glossare, Texterschließungsstrategien, Tandemlesen, Lesepa- ++
ten, temporäre Lerngruppen wie auch Sprachlernklassen oder Brückenkurse).
5. Für allgemeinbildende Schulen:
Schülerinnen/Schüler/Auszubildende/Studierende mit guten Sprachkenntnissen werden durch ge- -
zielte Angebote gefordert (z. B. Debattierclub, Sprachcamps, temporäre Lerngruppen).
6. An der Schule sind zusätzliche Sprachbildungsangebote etabliert (z. B. Projekte, Wettbewerbe, The-
+
ater, Schülerzeitung, auch in Kooperation mit außerschulischen Partnern).
7. Mehrsprachigkeit wird im schulischen Alltag als Ressource genutzt. #
8. Für Schulen mit Sprachlernklassen:
#
Spezifische Fortbildungsangebote werden besucht und im Kollegium kommuniziert.
Bewertung A B C D
zusätzliche Normierungsbedingungen:
A: 2.2.12 (im Unterrichtsprofil) liegt über dem Mittelwert der Schulart
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 20/461
2.1.b Medienbildung
Qualitätskriterien Wert
2.1.b.1 Lernen mit digitalen Medien
1. Die Schule nutzt regelmäßig webbasierte Plattformen (Informationsaustausch, Bereitstellung von
++
Unterrichtsmaterialien, Rechercheaufträge, Unterrichtsgestaltung).
2. Die Schülerinnen/Schüler/Auszubildenden/Studierenden erhalten regelmäßig die Gelegenheit, zu
+
Lerninhalten Medien zu produzieren.
3. Die Schule ermöglicht den Schülerinnen/Schüler/Auszubildenden/Studierenden Praxiserfahrungen
im Medienbereich durch besondere Angebote (Arbeitsgemeinschaften, Schülerzeitung, Homepage, +
Indikatoren
Event-Teams, Angebote von Kooperationspartnern).
4. In den Gremien sind Maßnahmen zur Förderung der digitalen Bildung im Unterricht vereinbart (In-
++
ternetführerschein, Tabletklassen, Recherche, Präsentation, Software).
5. Für berufsbildende Schulen:
In den Gremien sind Maßnahmen zum Kompetenzerwerb der Auszubildenden/Studierenden für #
die digitale Arbeitswelt vereinbart.
6. Für ISS, Gymnasien, berufsbildende Schulen:
Die Schule bietet die Möglichkeit der freien Nutzung von Medien (Schüleraufenthaltsraum, Inter- +
netcafé, Chat-Point, Bibliothek).
2.1.b.2 Lernen über digitale Medien
1. Die Schule fördert den reflektierten Umgang der Schülerinnen/Schüler/Auszubildenden/ Studie-
renden mit Medien (Chancen und Risiken, Datenschutz, Recht am eigenen Bild, Persönlichkeits- +
Indikatoren
rechte in der Mediengesellschaft).
2. Alle beteiligten Gruppen haben sich auf Regeln des verantwortungsvollen Umgangs mit Medien
+
verständigt (Schulprogramm, Klassenregeln, Hausordnung).
3. außer berufsbildende Schulen:
Zwischen Schule und Erziehungsberechtigten findet ein Austausch in Erziehungsfragen zur Medi- -
ennutzung statt.
Bewertung A B C D
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 21/461
2.2 Unterrichtsgestaltung - Indikatoren zum Unterrichtsprofil
2.2.1 Lehr- und Lernzeit
1. Der Unterricht beginnt pünktlich bzw. endet nicht vorzeitig (bezogen auf Anfangs- und Endsequen-
94 %
Indikatoren
zen).
2. Der Anteil an Warte- und Leerlaufzeiten für die Schüler/innen ist gering. 88 %
3. Der Anteil der sachfremd verwendeten Lehr- und Lernzeit ist gering. 100 %
2.2.2 Lern- und Arbeitsbedingungen
1. Die Raumgestaltung (auch die Sitzordnung) ist alters- und bedarfsgerecht. 98 %
Indikatoren
2. Die Lehrkraft sorgt unter den gegebenen räumlichen Bedingungen für eine förderliche Lernumge-
100 %
bung (Ausgestaltung, Sauberkeit, Lüftung usw.).
3. Die Lehrkraft stellt Lehr- und Lernmaterialien in ausreichender Anzahl zur Verfügung. 98 %
2.2.3 Strukturierung und transparente Zielausrichtung
1. Die Unterrichtsschritte sind nachvollziehbar und klar strukturiert. 100 %
2. Die Lehrkraft gibt Hinweise zum Unterrichtsverlauf 63 %
Indikatoren
3. und zu den Unterrichtszielen. 18 %
4. Das Erreichen von Unterrichtszielen wird thematisiert. 15 %
5. Arbeitsanweisungen sind stimmig und eindeutig formuliert (wenig Verständnisnachfragen). 95 %
2.2.4 Kooperation des pädagogischen Personals
1. Es ist erkennbar, dass Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte und Erzieher/innen nach Absprache handeln. 81 %
Indika-
toren
2. Lehrkräfte bzw. Lehrkräfte und Erzieher/innen nutzen die gemeinsame Unterrichtszeit effizient. 78 %
2.2.5 Verhalten der Schülerinnen und Schüler im Unterricht
1. Sie gehen freundlich miteinander um. 100 %
Indikatoren
2. Sie stören nicht den Unterricht. 93 %
3. Niemand wird ausgegrenzt. 95 %
2.2.6 Pädagogisches Klima im Unterricht
1. Die Lehrkraft sorgt für eine angstfreie Lernatmosphäre. 100 %
2. Die Ansprache an die Lernenden ist respektvoll und wertschätzend. 100 %
Indikatoren
3. Die Lehrkraft geht fair mit allen Schülerinnen und Schülern um. 98 %
4. Der Führungsstil der Lehrkraft ist partizipativ. 10 %
5. Die Lehrkraft reagiert erzieherisch angemessen auf Regelverstöße bzw. es gibt keine. 98 %
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 22/461
2.2.7 Förderung der Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft
1. Die Lehrkraft fördert bei einzelnen Schülerinnen und Schülern die Auseinandersetzung mit dem
78 %
Lerngegenstand.
2. Das Selbstvertrauen der Schüler/innen wird gefördert (z. B. Anerkennung, Lob, Würdigung von
88 %
Indikatoren
Leistungen).
3. Die Leistungsanforderungen sind transparent. 98 %
4. Die Leistungsanforderungen sind erfüllbar. 95 %
5. Die Leistungsanforderungen sind herausfordernd. 98 %
2.2.8 Reflexion des Lernprozesses
1. Schüler/innen erhalten die Möglichkeit, eigene bzw. die Leistungen anderer einzuschätzen. 30 %
Indikatoren
2. Es wird Material zur Reflexion eingesetzt (z. B. Selbsteinschätzungsbogen/Lerntagebuch/
5%
Logbuch, Kompetenzraster).
3. Lern-/Reflexionsergebnisse bzw. Fehleranalysen werden für den weiteren Lernprozess verwendet. 18 %
4. Eine Feedbackkultur ist erkennbar (bezogen auf den Lerngegenstand, auf das Lehrkräftehandeln,
13 %
Feedbackregeln).
2.2.9 Fachimmanentes, fachübergreifendes und fächerverbindendes Lernen
1. Im Unterricht werden fachliche Inhalte vermittelt. 100 %
Indikatoren
2. Im Unterricht werden überfachliche Arbeits- und Lerntechniken (Methoden, Präsentationen) ver-
15 %
mittelt oder angewendet.
3. Es gibt Verknüpfungen mit Inhalten außerhalb des Faches (Lebensweltbezug, andere Fächer, aktu-
43 %
elle Ereignisse).
2.2.10 Methodenwahl
1. Die Lehrkraft gestaltet den Unterricht anregend und motivierend. 80 %
2. Die Schüler/innen arbeiten interessiert mit und sind zielgerichtet aktiv. 95 %
Indikatoren
3. Der Unterricht ist methodisch abwechslungsreich gestaltet. 55 %
4. Die gewählten Methoden unterstützen den Lernprozess 90 %
5. Die Lehr- und Lernmaterialien sind alters- und bedarfsgerecht (z. B. aktuell, didaktisch sinnvoll,
85 %
leicht zugänglich).
2.2.11 Medienbildung
1. Die Lehrkraft bindet digitale Medien zur Unterstützung des Lernprozesses ein. 48 %
Indikatoren
2. Die Schüler/innen haben die Möglichkeit, zur Informationsbeschaffung bzw. -verarbeitung zwi-
15 %
schen digitalen oder analogen Medien zu wählen.
3. Die Schüler/innen präsentieren ihre Arbeitsergebnisse mit digitalen Medien. 3%
4. Im Unterricht wird der Umgang mit digitalen Medien reflektiert. 0%
BERICHT ZUR INSPEKTION DER TOULOUSE-LAUTREC-SCHULE Seite 23/46Sie können auch lesen