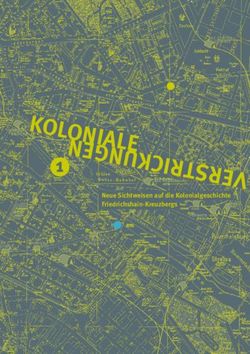BUNDESTREFFEN DER SCHWULEN, LESBISCH-SCHWULEN UND QUEEREN HOCHSCHULREFERATE UND -GRUPPEN OBERTHEMA WISE 2020/21: LSBTIQ* STUDIERENDE UND IHRE ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bericht: Bundestreffen der schwulen, lesbisch-schwulen und queeren Hochschulreferate und -gruppen Oberthema WiSe 2020/21: LSBTIQ* Studierende und ihre Rechte 26. – 29.11.2020 Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie und durch das Schutz- und Hygienekonzept konnten über 50 Studierende Ende November am Winterschlösschen teilnehmen. Sie vertraten knapp 30 Hochschulen und ihre schwulen, lesbisch-schwulen und queeren Hochschulreferate und Hochschulgruppen. Das Bundestreffen, das bereits seit vielen Jahren regelmäßig in der Akademie Waldschlösschen stattfindet, diente der Auseinandersetzung mit der spezifischen Situation von lesbischen, schwulen, bisexuellen, asexuellen, queeren, trans*, inter* und a-binären Studierenden und unterstützte das politische und soziale Engagement für sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung in der Studierendenschaft und hochschulpolitischen Gremien. Dabei standen im Vordergrund: (1) der Erfahrungsaustausch zu hochschulpolitischer, sozialer und kultureller Arbeit, (2) die Vernetzung von Kampagnen und Projekten zu Antidiskriminierungsarbeit, Coming-Out-Unterstützung und anderen hochschulrelevanten Themen, (3) der Austausch über aktuelle Forschung im Bereich der Queer und Gender Studies zur Förderung wissenschaftlicher Arbeit an den Hochschulen und (4) die Entwicklung gemeinsamer Positionen für die Hochschulpolitik und für die hochschulinterne Öffentlichkeitsarbeit sowie (5) die Vermittlung von Persönlichkeits-, Kommunikations- und Organisations-Kompetenz in der Gremien-, sozialen und kulturellen Arbeit.
Dokumentation der Workshops: VORTRAG: LSBTIQ* STUDIERENDE UND IHRE RECHTE..................................................................3 WORKSHOP-PHASE I....................................................................................................................3 WS: Gegenwind von Rechts................................................................................................................................... 3 WS: Wissen dekolonisieren ................................................................................................................................... 3 WS: Awarenessarbeit in queeren Safer Spaces und Partys (Phase I und II)............................................................ 4 WORKSHOP-PHASE II ...................................................................................................................4 WS: Difference and Encounter .............................................................................................................................. 4 WS: Verschwörungstheorien im persönlichen Umfeld .......................................................................................... 5 WS: Regenbogenfamilien ...................................................................................................................................... 6 WORKSHOP-PHASE III ..................................................................................................................6 WS: Geschlechterrollen in der Religion ................................................................................................................. 6 WS: Gesprächsrunde: Veranstaltungen zu HIV/Aids/STIs/STDs............................................................................. 7 WS: Queere Stadtteilprojekte ............................................................................................................................... 7 WS: Veranstaltungsplanung .................................................................................................................................. 7 WORKSHOP-PHASE IV .................................................................................................................8 WS: Demo-Orga .................................................................................................................................................... 8 WS: Critical Whiteness (Vertiefung, Phase IV und V) ............................................................................................. 9 WS: SCHLAU Workshops über sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität in Schulen .................................... 11 WS: Queere Aktionen in Coronazeiten ................................................................................................................ 11 WORKSHOP-PHASE V ................................................................................................................12 WS: Politische Forderungen im Wahljahr 2021.................................................................................................... 12 WS: Gendergerechte Sprache.............................................................................................................................. 13 WS: Mitarbeiter*innen-Akquise in Zeiten von Corona ........................................................................................ 13
Vortrag: LSBTIQ* Studierende und ihre Rechte
Den zentralen Vortrag im Rahmen des Bundestreffens hielt Prof. Dr. Ulrike Lembke (Humboldt-
Universität zu Berlin / Verfassungsrichterin des Landes Berlin) mit dem Titel: „LSBTIQ* Studierende und
ihre Rechte ". Rechtswissenschaften sind laut Lembke wesentlich für die Rechtsentwicklung, ihre
Bedeutsamkeit, z.B. durch die Herausgabe von Rechtskommentaren oder Rechtsgutachten, sei aber im
öffentlichen Diskurs zumeist deutlich weniger prominent. Wer also das Recht verändern wolle, müsse
auch die Rechtswissenschaften unbedingt mit einbeziehen
Ausgehend vom Urteil des Bundesverfassungsgericht im Jahr 2017, das die Option eines dritten
positiven Geschlechtseintrags oder die Abschaffung des Geschlechtseintrags im Personenstand
verlangte, zeichnete Lembke die nachfolgende Entwicklung von der Reform des Personenstandsrechts
bis hin zum Urteil des Bundesgerichtshofs aus dem Jahr 2020, das den Zugang zu einer Korrektur des
Personenstands einschränkte, nach. So hätte das BVerfG einen deutlich liberaleren Ansatz mit seinem
Urteil anklingen lassen, während der BGH die dritte Option auf medizinisch diagnostizierbare
Intersexuelle beschränkt hat, was ihrer Meinung nach auf einem mangelnden Verständnis der Tragweite
des BVerfG-Urteils beruht habe. Das revolutionäre Potential des BVerfG-Urteil sei auch in den
Rechtswissenschaften kleingeredet worden und es seien Rechtsgutachten notwendig, die dies sichtbar
machen.
In der anschließenden Diskussion stellten die Studierenden konkrete Fragen zu rechtlichen
Herausforderungen, die ihnen in ihrem Engagement für andere Studierende begegnen. Lembke empfahl
für ein strategisch kluges Vorgehen Umfragen durchzuführen und die Ergebnisse in die
hochschulpolitischen Ergebnisse einfließen zu lassen, um den Handlungsbedarf zu verdeutlichen.
Darüber hinaus sei es wichtig im Einvernehmen mit möglichst vielen hochschulpolitischen Akteur*innen
vorzugehen sowie mit Rechtsgutachten und der Praxis anderer Universitäten zu argumentieren und
gegebenenfalls auch ein eigenes Rechtsgutachten in Auftrag zu geben.
Workshop-Phase I
WS: Gegenwind von Rechts
In diesem Gesprächskreis beschäftigten sich die Teilnehmer*innen mit rechten Stimmen und
antiqueeren bzw. antifeministischen Gegenbewegungen an den Hochschulen und tauschten sich über
entsprechende Erfahrungen im hochschulpolitischen Kontext aus.
• Als häufig beobachtetes Vorgehen Rechter stellte sich heraus:
o Infragestellung von Finanzmitteln für queere Referate / Projekte
o Herabspielen der Notwendigkeit und Belustigung über queere Projekte an Hochschulen sowie
im Allgemeinen
o Hinauszögern von Anträgen und Diskussionen sowie Konzentration auf bürokratisch-formelle
Hürden
o z.T. antiqueere Hetze als Wahlwerbung von Hochschulgruppen
• Diskussion um effektiven Umgang:
o (Hochschul-)Öffentlichkeit mit einbeziehen
o bei konservativ geprägten studentischen Gremien wie bspw. Fachschaftsräten: Die Gremien
besetzen und Diskussionen anregen
o Wenn es hilft, Treffen mit Gleichstellungsbeauftragten
WS: Wissen dekolonisieren
Leitfrage dieses Workshops war, wie Student*innen im Rahmen studentischer Projekte Menschenrechte
und Gleichstellung in Lehre und Forschung aktiv fördern können.
• Input zu Dekolonisierung im Wissensbetrieb/an der Uni
o Relevanz = Zugang zu Wissen und Wissensproduktion: eigene Situation äußern, adäquat
beschreiben und möglicherweise verändern können
o Kolonialität: Machtungleichheit und Unterwerfung
o Wissen beruht in Teilen auf Bias, z.B. auf fehlerhaften Grundannahmen (“Es gibt nur Männer
und Frauen”)• Lösungsansätze:
o Studien/Hausarbeiten im Dialog verfassen mit „Beforschten“ (Feedback einholen, öffentlich
machen)
o auch in Ingenieur- und Naturwissenschaften Wissen hinterfragen, kritisieren
o interdisziplinär arbeiten als Möglichkeit
WS: Awarenessarbeit in queeren Safer Spaces und Partys (Phase I und II)
Der Austausch zu Awarenessarbeit in queeren Kontexten stand im Zentrum dieses Workshops. Neben
der Vorstellung der Arbeit des Safe Night e. V. – einem Verein aus Hamburg, der Aufklärungs- und
Awarenessarbeit zum Thema Grenzüberschreitungen im Party- und Nachtleben leistet – wurden
folgende Fragen diskutiert: Was ist Awareness? Welche Konzepte gibt es? Wie arbeitet ein
Awarenessteam? Welche Vorüberlegungen, Voraussetzungen und Infrastruktur braucht ein A-Team?
• Input zu Awarenessarbeit allgemein (Was ist Awarenessarbeit, welche Konzepte und Arbeitsweisen
gibt es?), Erfahrungsaustausch und Debatte zur Awareness-Situation auf dem Schlösschen
• Vorstellung der Arbeit und Arbeitsweisen eines Awarenessteams
• benötigte Infrastruktur, Ressourcen und Voraussetzungen für die Awarenessarbeit
• Wunsch der Gruppe: Das Bundestreffen soll in Zukunft ein externes Awarenessteam zumindest zu
bestimmten Zeiten engagieren/stellen
• Idee/Vorschlag: externes Awarenessteam wird geschult zur Awareness-Herausforderungen des
Schlösschens (spezifische Trigger z.B. bei Show)
• das externe Awarenessteams arbeitet in 6-8 Stundenschichten nachmittags und abends, wenn die
meisten Awareness-Fälle zu vermuten sind
• während der restlichen Zeit stellt das Orga-Team oder ein Referat das nicht Orga macht ein
Awarenessteam vom Referat
• die Mehrkosten des A-Teams könnten solidarisch auf die reichsten Referate umverteilt werden
(geschätzte Kosten für ca. 18-24 Stunden Awarenessarbeit eines Teams aus 3-6 Leuten: ca. 700-
1400 €)
Workshop-Phase II
WS: Difference and Encounter
In diesem Workshop wurde der Text „Living with Difference: Reflections on Geographies of Encounter“
von Gill Valentine (2008) vorgestellt und diskutiert. Zentrale Aspekte des Textes sind:
• Kontakthypothese wird hinterfragt
• Def. Kontakthypothese: Es entsteht eine pluralistische Gesellschaft automatisch dann, wenn
Menschen unterschiedlicher Merkmale (Herkunft, Kultur, sexuelle Identität, sozialer Hintergrund,
etc.) aufeinandertreffen.
• Problematisierung der Hypothese:
o Interdisziplinäre Herangehensweise für einen gesamtheitlichen Blick (Philosophie, Soziologie,
Psychologie, Urban Studies, Feminist Studies, etc.)
o Treffen sind geprägt von Höflichkeit, Höflichkeit spiegelt aber nicht die Werte von Menschen der
Mehrheitsgesellschaft wieder -> Gap between practices and values
o Toleranz ist ein Ausdruck der Macht, die ein Mensch hat, jemanden zu tolerieren aber die Wahl
hat, dies zu tun oder nicht und entspricht damit nicht dem Konzept der Akzeptanz
o Positive Begegnungen sind Begegnungen die einen Wertewandel hervorrufen können. Sie
können vor allem in Mikroöffentlichkeiten vorkommen.
o Mikroöffentlichkeiten sind organisierte und zielorientierte Gruppenveranstaltungen bei denen
Möglichkeiten des Wertewandels entstehen (Theater, Sportverein, politische Gruppen, Vereine,
Universitäten, tlw. auch Fernsehsendungen).
o Wertewandel ist personenabhängig: Die Biographie von Individuen beeinflusst die Kapazität
dafür, ob ein Wertewandel möglich ist.o Es gibt allerdings Individuen, die einen Sündenbock benötigen, weil sie es nicht gelernt haben,
konstruktiv mit unterschiedlichen Perspektiven umzugehen. Dies rechtfertigen sie mit eigenen
wahrgenommenen sozialen Ungleichheiten ihrerseits, die aber keine tatsächlichen sind.
o Emotionale Brücken können Möglichkeiten produzieren, diesen Menschen bei einem
Wertewandel zu unterstützen. Dabei würde die von ihnen wahrgenommene Benachteiligung als
Basis für einen Perspektivwechsel in die die Situation von „anderen“ Menschen genutzt werden,
denen eine tatsächliche Benachteiligung in der Gesellschaft widerfährt.
o Individuen einer Minderheitsgruppe sind „Minderheitenstress“ ausgesetzt, wodurch ihnen die
Aufgabe der Aufklärung nicht alleinig zumutbar ist.
o Es bestehen materielle Abhängigkeiten von den „Anderen“ gegenüber der
Mehrheitsgesellschaft.
o Fazit: Ob eine plurale Gesellschaft sichergestellt werden kann, ist in vielen Punkten fraglich und
von vielen komplexen Faktoren, die ineinander verschränkt sind, abhängig.
• Handlungsauftrag:
o Die Schere zwischen Werten und höflichen Handlungen muss angesprochen und adressiert
werden
o Ein Verständnis hin zu Akzeptanz und, was Vielfalt wirklich ist, muss gestaltet werden
o Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen müssen in Positionen stecken, in denen sie
materiell sicher sein können und unabhängig von der Gunst von Hierarchisch über Sie
stehenden Menschen.
WS: Verschwörungstheorien im persönlichen Umfeld
In diesem Workshop tauschten sich Teilnehmer*innen miteinander aus, die in ihrem persönlichen
Umfeld Menschen haben, die an Verschwörungstheorien glauben. Gemeinsam sammelten sie, welche
Verschwörungstheorien es in ihrem Umfeld gibt und überlegten gemeinsam, wie sie diesen begegnen
könnten. Der Workshop gliederte sich in drei Schwerpunkte:
• Auf welchen Grundlagen basieren Verschwörungstheorien?
o Simplifizierung eines Problems
o Persönlicher und Kollektiver Kontrollverlust
o Internalisierte Rassismen, Antisemitismen
o Projektion persönliche Ängste
o Verbreitung über Social-Media
- Schnell
- Effektiv
- Algorithmik
o Wissenschaft wird ignoriert
o Erstreckt sich über diverse soziale Milieus
o Die Rhetorik von Verschwörungstheoretiker*innen zielt darauf ab Gesprächspartner*innen mit
wissenschaftlichen Standpunkten so lange Fragen zu stellen, bis die wissenschaftliche Person
nicht mehr auf Fragen antworten kann, da ihr Wissen nicht ausreicht. So versucht die
Verschwörungstheoretiker*in Wissenschaftler*innen bloßzustellen, das Gefühl zu bekommen,
Recht zu haben, andere Menschen zu überzeugen, dass Wissenschaft keine plausiblen
Antworten bietet.
o Immunität gegen Widerlegungen aufgrund der fehlenden Faktenlage der Theorien
• Umgang mit Menschen, welche Verschwörungstheorien vertreten
o Mensch muss nicht mit allem umgehen: Bei Facebook oder Grindr blocken
o Mensch muss manchmal einen Umgang finden im Freundeskreis
- Geht es der Person gut?
- Hat die Person Sorgen, Depression, Jobverlust?
- Kann mensch helfen (anstatt zu diskutieren)?
o Die Situation bestimmt den Umgang (Persönlich, im Netz, Anonym bekannt)o Mensch kann versuchen durch das Emotionalisieren der Thematik, die Rhetorik von
Verschwörungstheoretiker*innen auf sich selbst anzuwenden und somit einen Bezug zum*r
Gesprächspartner*in herzustellen.
o Fokus nicht auf die Verschwörung legen
o Relation herstellen durch die Frage: „Wie viele Menschen müssen wohl involviert sein und nicht
darüber reden?“
o Nicht mit Fakten aufwarten, sondern mit Fragen stellen
o Wissenschaftlichen Fakten von Freund*innen glauben sie eher, da sie einen emotionalen Bezug
haben
• Wie gehen wir mit solchen Belastungen um?
o Streitthemen unter Substanz Einfluss (Alkohol, etc.) vermeiden
o Distanzieren oder aus dem Weg gehen
o Sich selbst die Frage stellen: „Besser gehen oder weiter befreundet sein?“
o Mit anderen Personen Erfahrungen teilen
o Schauen, ob mensch die Kraft hat, gerade darüber zu reden
o Humor hilft
WS: Regenbogenfamilien
In diesem Workshop sollte die Gelegenheit bieten, über den Weg eine (queere) Familie zu werden, zu
sprechen. Zentrale Fragen waren: Was ist in dem Themenbereich überhaupt möglich und wo liegen
(besonders rechtlich) in Deutschland die Grenzen? Der Workshop hat Grundwissen vermittelt und sich
auch mit aktivistischen Aktionen, Forderungen und mit den persönlichen Fragen der Teilnehmer*innen
beschäftigt.
Regenbogenfamilien – viel Planung für ein Wunschkind – welche Hürden und Möglichkeiten gibt es?
• Rechtlicher Weg /Voraussetzungen für Regenbogenfamilien
• persönlicher Erfahrungsbericht
• Wege einen Spender zu finden
• Daten und Fakten zu Regenbogenfamilien
• Bambergstudie 2007/2008
• Stiefkindadoption: Ablauf , Kosten, Rechtliche Grundlage,
• Begriffserklärung
• Kinderbücher für Regenbogenfamilien
• Sensibel das eigene Kind erziehen
Workshop-Phase III
WS: Geschlechterrollen in der Religion
Die Leitfrage dieses Workshops war, wie Religion Geschlechterbilder beeinflusst, welche Möglichkeiten
sie bietet und welchen Einfluss sie auf die persönliche Lebensgestaltung hat. Nach einem kurzen Input
zu den Positionen der Weltreligionen zu Gender, gab es eine Gruppendiskussion mit folgenden
Aspekten:
• eigene Erfahrungen im Umgang mit Religion wurden diskutiert
• Konzentration auf negative Aspekte der Weltreligionen
• unterschiedliche Struktureinheiten führen zu unterschiedlichen Lehrmeinungen und können daher
stark innerhalb einer Religion auseinandergehen
• privater Glaube steht der religiösen Lehrmeinung im alltäglichen Umgang gegenüber
• toxische Männlichkeit als starkes Rollenbild
• heteronormatives Geschlechterbild als Standard und Basis
• antiquierter Ehrbegriff, wodurch das Mensch-Sein verloren geht
• Abschottung bestimmter ReligionenWS: Gesprächsrunde: Veranstaltungen zu HIV/Aids/STIs/STDs
Leitfragen dieses Workshops waren: Wie veranstalten wir als Referat inklusive und
diskriminierungsarme Inputs/Vorträge/Podien/Diskussionen zu STIs, HIV und Prävention? Welche
Bedarfe haben LGBTIQ-Studis in Bezug auf sexuelle Aufklärung und STI-Prävention? Welche Formate
gibt es und wie inklusiv/diskriminierungsarm sind diese?
• Expertise einholen von außen: z.B. regionale Aidshilfen
• Format: lieber Workshop als Vortrag, Peer-to-Peer, HIV-Selbst-Tests (SAM) ausprobieren, Angebote
hier für alle Studierenden
• Bedarfe ermitteln: Was wird gebraucht auf dem Campus?
o z.B. Erklärvideos zu STI’s
o Themenwoche „Sexuelle Vielfalt“
• Basic-Aufklärungsworkshop bei ZOOM (anonymisiert)
o Lecktücher
o Kondome richtig aufziehen
o Basale Aufklärung über Safer Sex
o ChemSex und Safer-Use bei Drogennutzung
o SCHLAU-Gruppen einladen (kostenfrei): Diese decken viele sexuelle und geschlechtliche
Identitäten ab.
• Projekte wie „Mit Sicherheit verliebt“, „Love Rebels“ als Vorbild nutzen
• Bondage-Workshop (für alle)
• HPV-Aufklärung (wichtig auch für Cis-Männer), Krätze
• Interdisziplinäre Fortbildung für Medizin-Studierende
• auf externe Angebote stetig hinweisen
• Offen blieb, was Best Practice ist und wo für z.B. HIV-positive Studierende diskriminierende
Situationen entstehen könnten
WS: Queere Stadtteilprojekte
In diesem Workshop zu queeren Projekten in Stadtteilen wurden folgende Fragen diskutiert: Wie
aktiviert man die Stadtbevölkerung? Wie kooperiert man mit lokalen Unternehmen/ Behörden/Gruppen
(z.B. Schulprojekte, Improtheater auf öffentlichen Plätzen, Kooperation mit Bars, etc.)? Was sind
umsetzbare Stadtteilprojekte, denen man einen „queeren Touch“ geben könnte?
Die Teilnehmer*innen beschäftigten sich mit Projekten, die nicht auf die ganze Gesellschaft wirken,
sondern sich konkret auf eine kleine Stadtteil Gesellschaft auswirken sollen. Es ging um kleinere
Projekte, die regelmäßig für eine bestimmte Personengruppe in einem bestimmten klar abgegrenzten
Ort stattfinden sollen. Dafür haben sich die Teilnehmer*innen zunächst dem Konzept und der Struktur
einer Stadtteil-Gesellschaft genähert und festgestellt, dass jeder Stadtteil anders ist und man sich stets
an die örtlichen Bedingungen und Bedürfnisse anpassen muss. Insbesondere ging es um Ortsteile, in
denen ein hoher Migrationsanteil vorhanden ist und wie auch Migrant*innen gut in Projekte
eingebunden werden können. Anschließend wurde festgehalten, was mögliche Ziele solcher
individueller Projekte sind und wie wir sie finanzieren könnten.
WS: Veranstaltungsplanung
Der Workshop vermittelte das Know-how, um Veranstaltungen angemessen planen und vorbereiten zu
können. Zentrale Fragen waren: Wie plane ich eine Veranstaltung? Wie mache ich meine Veranstaltung
zu einem Erfolg? Wie schaffe ich einen Raum, der meinem Konzept gerecht wird und somit meiner
Zielgruppe gefällt?
Allgemeiner Ablauf der Organisation wurde erklärt. Beginnend bei der Erstellung des Konzeptes, der
Teilung der Aufgaben und der Nachbereitung wurden die wichtigsten Konzepte der Organisation
erläutert
• Anhand von Leitfragen konnten die TN ein Konzept für die VA erstellen
• Es gibt diverse Methoden der Arbeitsteilung der verschiedenen Arbeitsbereiche, welche individuell
gewählt wird
• Es ist wichtig, dass regelmäßige Treffen stattfinden• Das Konzept des Ablaufs „Planung, Plenum, Identifizierung von Lücken...“ wurde erläutert
o Zuständigkeiten werden bestimmt, diese planen ihren Bereich
o Die Ergebnisse werden regelmäßig zusammengetragen
o Es werden Lücken in der Planung identifiziert und auf die beteiligten Personen aufgeteilt.
Workshop-Phase IV
WS: Demo-Orga
Anhand von Erfahrungen in der Planung und Durchführung von Demonstrationen wurde getreu dem
Motto „Wer eine Queer* Party planen kann, kann auch eine Demo planen“ in diesem Workshop
vorgestellt und diskutiert, was bei der Planung und Durchführung einer Demonstration beachtet werden
müsse.
Generell ist Hüte-System empfehlenswert, also “Themen-Beauftragte” zu finden für folgende
Planungsbereiche:
• Technik: damit steht und fällt die Veranstaltung!
o Mobiler Lauti, Mietwagen mit Lautsprecher-System?
o Eigenes System anschaffen oder ausleihen (AStA, Gewerkschaften, Parteien)
o Spotify Premium hat GEMA bezahlt
o IMMER BACKUP HABEN, z.B. zweites Handy, Megaphon, idealerweise noch eine zweite Anlage
in der Hinterhand
o Daran denken, dass die Anlagen logistisch auch immer abgeholt und zurückgebracht werden
müssen
• Anmeldung
o Fristen beachten, erst nach der Anmeldung dürfen wir werben
o Früher da sein zur Besprechung mit der Polizei
o Am Anfang die Auflagen verlesen
o Falls Auflagen nicht eingehalten werden: nach 3. Aufforderung ist Versammlungsleitung nicht
mehr haftbar
o Am Ende offiziell auflösen
o ORDNER*INNEN-BINDEN entweder DIY oder bestellt!
• Bündnisarbeit:
o Polit-Gruppen, Gewerkschaften, Parteien, zivilgesellschaftliche Akteur*innen,...
o Wie „breit“ das Bündnis sein soll, entscheidet ihr selbst, es gibt pro und contra je nach Thema
o Betroffenen-orientiert organisieren – sie immer mit einbeziehen, falls es z.B. um Übergriffe geht
• Aufruf
o ggf. recherchieren zum Thema und weitere Aufrufe zum Vergleich lesen
o Per Mail an alle wichtigen Akteur*innen der Stadt schicken
• Werbung
o canva.com
o an ähnlichen Plakaten orientieren?
o Design passend zum Konzept / Vibe
o Bei langfristiger Planung: Sticker
o quadratisches Sharepic (png oder jpg) zum Teilen in Telegram-Gruppen etc.
o Facebook-Gruppen, Telegram-Gruppen… Leute dazu auffordern, es zu verbreiten
o Generell: metadaten bereinigen, z.B. https://metadata.systemli.org
• Umgang mit Presse und Öffentlichkeit
o Pressemitteilung an lokale Nachrichten schreiben
o Pressebeauftragte Person suchen
• Redebeiträge
o Betroffene immer möglichst am Anfang
o Begrüßungs- und Abschlussrede: Warum stehen wir hier? Schön, dass ihr hier steht. Am Schluss:
„ie geht es weiter?
o Gerne auch ein bisschen dafür recherchieren: Was gibt es schon zu dem Thema?o Immer nochmal doppelt und dreifach querlesen lassen!
o nicht zu lang und damit die Leute nicht einschlafen: Pausen, Wiederholungen, Witze,
Zuspitzungen, Call-and-Response-Parolen zum mitrufen
o Nicht zu schnell vorlesen!
o Vorher testen, wie nah ich ans Mikro muss
• Transpis
o kurz und knackig formulieren
o Bettlaken in weiß oder bunt, Acrylfarbe, breite Pinsel
o vor dem Bemalen Müllbeutel darunter kleben
o gerne Glitzer, Farbe, Grafiken
o mit Beamer / Bleistift wirds schöner
o ZEIT ZUM TROCKNEN EINPLANEN
• Kreative Ideen
o Handzettel mit Parolen oder selbst ausgedachte
o Handzettel zum Verteilen des Aufrufs oder anderen Infos für Passant*innen
o Glitzer fürs Gesicht, Regenbogenmasken
o Ggf. Dresscode vereinbaren
o Flamingos und andere Maskottchen / Erkennungszeichen
o örtliche Polit-Tunten, ROA / Trommelgruppe
o Linke und queere Chöre einladen
o Soli-Konzerte von lokalen queeren Künstler*innen => darauf achten, dass dann evtl. noch mehr
technische Anforderungen kommen
o Seifenblasen, Straßenkreide, Riesige Pride-Flagge
o Endpunkt: Picknick? KüFa-Gruppen? Kochgruppen? Sandwiches?
o Flyer und Sticker von euch mitbringen
o Kiss-In? Performance-Kunst?
• Strategie und Planung von Kampagnen:
o Institutionen ändern sich erst, wenn eine erhebliche Rufschädigung mit finanziellen Einbußen zu
erwarten ist
o Sichtbare Demos vorm Büro der Entscheidungsträger
o Im Vorfeld nochmal Gesprächsangebot machen und dann HART verhandeln - sucht euch für die
Gespräche Unterstützung, ideal wenn ihr am Tisch „in der Überzahl“ seid, Good-Cop-Bad-Cop-
Strategie
o „Presse-Botschafter*innen“ die ihre Geschichte in möglichst viele Kameras erzählen
• Self-Care! Auf Pausen und Verpflegung achten, Grenzen setzen
• ggf. Demo-Awareness?
• Umgang mit Störungen von rechts
o vorher mit Ordner*innen absprechen, wie damit umzugehen ist
o zur Seite nehmen, nicht mitten in der Demo diskutieren
o nicht provozieren lassen
o Schallplatten-Technik anwenden
o von der Veranstaltung ausschließen
o wenn sie ausgeschlossen wurden, muss die Polizei sie entfernen
o Je nach Stimmung gemeinsam skandieren: „du kannst nach Hause gehen“, „Tschü-hüß“, „Haut
ab“
WS: Critical Whiteness (Vertiefung, Phase IV und V)
Dieser Workshop diente der Vertiefung des gleichnamigen Workshops vom Vortag. Dieser
Vertiefungsworkshop ging über zwei Phasen und war in folgende Teile getrennt: Teil II: Wie können wir
konkret ins antirassistische Handeln kommen? Teil III: Wie können wir antirassistische Strukturen im
AStA stärken? Für die Zukunft wurde der Wunsch geäußert, externe Referent*innen mit
Rassismuserfahrung einzuladen und dafür zu bezahlen, diesen Workshop anzuleiten.Abfrage unter den Teilnehmer*innen zu Anfang: Weiß-dominierte HS (alle), weiß-dominierter AStA
(alle), weiß-dominiertes Referat (alle), weiß-dominierte Vorträge (durchwachsen), international aber
nicht Antira-Referat (hauptsächlich), wenig Wissen um Antira-Strukturen in der Stadt (durchwachsen)
• Ideen für Handlungsfelder
o Mehr BIPoC-Referierende einladen, Antira Publikationen zur Verfügung stellen, Lesekreis für
Antira Literatur
o Organisationen unterstützen, die zu Antirassismus arbeiten
o Antira-Arbeit strukturell im AStA verankern, Vorgehen bei rassistischen Vorfällen im AStA
absprechen, Reflektion dieser, Konsequenzen bei Vorfällen ( --> Täter*innenarbeit)
o Safer Space für BIPoC im Referat anbieten, Antira Awarenessarbeit (--> Betroffenenarbeit)
o Sprache (Englisch, akademische Sprache, diskriminierungsarme Formulierungen
o Sensibilisierung zu Privilegien
o Outcalling im Referat, AStA, Hochschule, Strukturen, Handlungen
o verbindliche Kooperationen
o Hilfe suchen und Hilfe anbieten
• Hürden
o Wie im AStA ansprechen? Sorge vor White-Gilt, Ablehnung etc.
o Widerstand aus dem eigenen Referat
o Einschränkungen durch Referatsausrichtung (fühlt sich die Zielgruppe angesprochen)
o Fehlendes Wissen um Ressourcen und Strukturen
o Knappe finanzielle Mittel vs. angemessene Entlohnung von Antira-Trainer*innen
o Grenzüberschreitung/White-Saviorism
o Angst davor, das Thema nicht verstanden zu haben
• Good-Practice-Berichte
o Zuschreibung, dass BPoC Person "zuständig" ist, ablegen
o Vortragende fragen, was sie sich für eine Veranstaltung wünschen, Themenvorschläge,
Nachfragen nach aktuellen Debatten aus Forschungsbereich/Community
o Weiße Menschen sollten über Rassismen aufklären, es darf aber nicht in Richtung von White-
Saviorism gehen (weiße Person erklärt Rassismus vermeiden)
o Nachfragen: Was soll thematisiert werden? Wer kommuniziert?
o Reflektion über Interessen und Konflikte der eigenen Studierendenschaft
o Stiftungen nach finanzieller Unterstützung anfragen
o In jeder Sitzung Probleme in den Strukturen ansprechen
o Zielgruppe nach genaueren Themenwünschen fragen (z.B. Diskriminierung auf Grindr)
• Strukturelles Arbeiten exemplarisch
o Beschreibung der Struktur: Referat/AG: alle weiß, HS hat aber einen hohen Anteil an
international Studierenden, die sich seltener strukturell einbringen, viele Hochschulseminare auf
Englisch
o Website, Werbematerialien etc. auf Deutsch, bei Veranstaltungen wird abgesprochen ob
Deutsch oder Englisch gesprochen wird, bei z.B. Spieleabenden (weniger moderierten
Veranstaltungen) wird in Kleingruppen oft ins Deutsche gewechselt, wenn keine international
studierende Person anwesend ist --> Barrierebildung für Dazustoßende
o kein Gegenwind gegen als englisch ausgeschriebene Veranstaltungen, aber teilweise
Unsicherheit --> daher Zurückwechseln ins Deutsche in Kleingruppen
o kleine Gruppe, Werbung via Social Media, WhatsApp-Gruppe für Teilnehmende, nicht nur
Studierende bei Veranstaltungen
o Studentische Gremien sehr weiß besetzt, Kommunikation im AStA auf Deutsch, bestreben ein
BIPoC/Antira Referat zu gründen
o Handlungsprotokoll bei rassistischen Vorfällen nicht vorhanden
o Meldestelle für rassistische Vorfälle nicht explizit vorhanden, prinzipiell Thema für das
Gleichstellungsreferat, auf HS-Ebene gibt es eine Antidiskriminierungsbeauftragte, Person ist
aber nicht wirklich ansprechbar• Konkrete Vorschläge basierend auf der beschriebenen Situation
o Einrichten einer Meldestelle/Beschwerdemöglichkeit, Informieren über geplante Antira-Referat
Einführung, Beschwerden vorher sammeln und an neues Referat weiterreichen, damit dort
direkt Themen abgesprochen werden können --> Arbeitskreis gründen
o Zusammenarbeit mit verbündeten Gremien/Referaten etc. (sowohl Studierendengremien als
auch HS-Gremien (Z.B. Diversity, Gleichstellung, Antidiskriminierung, ...)
o Ist-Zustand abfragen -> z.B. Umfrage online: Programm wertet Umfrage für einen aus, kostet
dann aber etwas
o bei Anträgen auf Satzung beziehen (Gremium und/oder HS) und in Gremien diskutieren lassen
• Finanzielle Mittel beschaffen
o Stiftungen
o Kooperationen z.B. mit Träger*innen, die an öffentliche Gelder kommen, anderen Referaten
und Hochschulen
o Hochschulintern nachforschen
o Dozierende aus der eigenen HS anfragen
• Offene Fragen:
o Antirassistische Literaturliste und Lesekreise anleiten?
o Sensibilisierung für eigene Privilegien
o Was ist eigentlich Rassismus?
o Wie schaffen wir Safer Spaces für BIPoC?
o Wie können wir gut mit antirassistischen Organisationen zusammenarbeiten?
o Welche Umgangsformen wollen wir für unsere Referate, aber auch fürs Schlösschen allgemein,
pflegen?
o Wie gehen wir mit rassistischen Vorfällen um (offen ansprechen, Zweier-Gespräch, Prozesse der
Wiedergutmachung)?
o Wie können wir Betroffene besser stärken - Stichwort antirassistische Awareness?
WS: SCHLAU Workshops über sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität in Schulen
In diesem Workshop wurde SCHLAU, ein deutschlandweit anzutreffendes Aufklärungsprojekt, das an
Schulen Aufklärungsworkshops zum Thema sexuelle Vielfalt und geschlechtliche Identität durchführt,
vorgestellt. Zentrale Elemente eines SCHLAU-Workhops: verschiedene erprobte Methoden werden
angewandt, die Teamer*innen erzählen über eigenes Coming Out und beantworten Fragen der SuS, die
Teamer*innen sind selbst queer.
WS: Queere Aktionen in Coronazeiten
In diesem Workshop wurden Ideen gesammelt, was in der aktuellen Lage an Aktionen möglich ist oder
auch schon war. Wie kann dem Konflikt zwischen Sichtbarkeit schaffen vs. Kontaktvermeidung und
Reduzierung begegnet werden? Die Teilnehmer*innen tauschten hierzu ihre Erfahrungen aus und
überlegten gemeinsam, wie an der eigenen Uni queere Sichtbarkeit umgesetzt trotz Kontaktvermeidung
hergestellt werden könnte.
Der Workshop gliederte sich in mehrere Themenschwerpunkte:
• Aktuellen Probleme und Fragen, die Corona bislang auf queerer Ebene mit sich brachte
o Wie kann ein Safe Space online hergestellt werden?
o Welche Plattformen gibt es und wie ist Anonymität möglich?
o Der Zusammenhalt von Gruppen ist schwierig.
o Die Umsetzung ist online sehr viel zeitaufwändiger.
o Welche Arten von Treffen gibt es an anderen Hochschulen und was funktioniert da gut?
o Es herrscht durch das Digitale eine gewisse Eintönigkeit.
o Ein Austausch ist schwer möglich.
o Die Neugewinnung von Personen für Gruppen ist schwer.
• Austausch über die Aktionen, die schon durchgeführt wurden
o Es wurden Masken mit Regenbogenflaggen besorgt und zum IDAHOBIT verteilt.
o Gewinnspiel mit Maskeno Es wurden Spaziergänge organisiert, die in Präsenz stattfanden. Dabei wurden paare gebildet,
die Corona konform waren.
o Es hat Online-Workshops gegeben, mit vorheriger Anmeldung
o Es wurde gemeinsam gekocht. Die Zutatenliste wurde an alle Teilnehmer*innen geschickt und
dann per Video gemeinsam gekocht und gegessen
o Es wurde eine Nettikette für die Nutzung von Online Veranstaltungen herausgegeben (Umgang
mit Screenshots, Pronomen, Video)
o Regelmäßigkeit zu schaffen tat gut
o Offene Online-Gesprächsrunden
o Virtuelle Spieleabende (Skribelio, Stadt/Land/Fluss, Cards Against Humanity, Namensfindung,
Werwolf)
o Online-Themen- und -Filmabende
o Online Kennenlernspiele (über Zoom mit kleinen Brake-out-Sessions, um sich besser kennen zu
lernen) → hohe Teilnahme
o Um Personen anzusprechen, wurden Flyer in den Wohnheimen verteilt
o Online-Frühstück
o Organisation von Online-Vorträgen
o Einrichtung eines Newsletters zu queeren Themen (per E-Mail)
• Runde: Sammlung von nützlichen Plattformen
o Zoom (eine Person sollte einen bezahlten Account haben, um Break-out-Sessions durchführen
zu können, Datenschutz allerdings fragwürdig)
o Microsoft Teams (Achtung: Anonymität ist hier nicht gewährt)
o Big Blue Button ( uni-gebunden)
o Open Source → senfcall
o Discord
• Fazit:
o Aktuell fast nur Online-Angebote
o Ein Safe-Space online ist nicht vollständig möglich
o Regelmäßigkeit herstellen wichtig
Workshop-Phase V
WS: Politische Forderungen im Wahljahr 2021
2021 finden neben den Bundestagswahlen auch mehrere Landtagswahlen statt. In diesem Workshop
sollte es um die Frage gehen, welche Forderungen Referate in die politische Debatte einbringen können.
• Sammlung von politischen Forderungen von LSBTIQ
o TSG-Novelle
o Queerer Rettungsschirm
o Queere Wissenschaft
o Ausbau Dritte Option: Namensänderung/Einschreibung
o Wohnprojekte/Besetzungen legalisieren
o Medizinische Unterstützung (PrEP weiterhin kostenlos anbieten, gutes Gesundheitssystem)
o Abtreibungsrecht (§219a und §218 StGB abschaffen)
o Queer-Mainstreaming in Schulen
• Prozedere
o Vernetzung: Informieren über Treffen
o Ausformulieren und Unterstützung einholen: Queernet, DGTI, LSVD, Bundesverband Trans*
o Forderungen: Reaktion einholen von Parteien und Regierungen
o Reaktionen: Demos, Kundgebungen, ...WS: Gendergerechte Sprache
In diesem Workshop wurden folgende Fragen besprochen: Wofür brauchen wir gendergerechte Sprache
und welche Gendermethoden es gibt.
• Warum gendern wir:
o Sichtbarmachung
o alle sollen sich angesprochen fühlen
o ein reines Maskulin vermeiden
o Barrieren sollen abgebaut werden
o Der Fokus liegt nicht auf dem Geschlecht, sondern auf der Handlung und dem Inhalt
o löst Manifestierungen
o nimmt Unsicherheit (besonders in Stellenausschreibungen)
• Welche Arten gibt es:
o * = Sternchen → zeigt in alle Richtungen, als Platzhalter
o : = Doppelpunkt → barriereärmer
o . Mediopunkt → barriereärmer
o _ = Unterstrich → trennt die Geschlechter, bezieht nicht alle ein
o I = Binnen-I → trennt die Geschlechter
o Geschlechtsvermeidung (Lehrkraft)
• Wie wird auf Hochschulebene gegendert:
o Stellenausschreibungen sprechen drei Geschlechter an
o Handhabung bei Abkürzungen (Prof.)
o Es gibt keinen einheitlichen Umgang mit Gendern innerhalb einer Uni
o Anrede-Möglichkeiten: Hallo, Guten Tag, Liebe*r
• Gendern in der Sprache:
o Auf Sitzungen
o auf offiziellen Rahmen
→ oft schwerer, als schriftlich
WS: Mitarbeiter*innen-Akquise in Zeiten von Corona
Dieser Workshop widmete sich der Frage, wie neue Menschen für die Referatsarbeit in Zeiten von
Corona akquiriert werden können.
• Bericht aus den einzelnen Referaten
• In allen Referaten gibt es mehr oder weniger das Problem, dass Referent*innen/Projektkräfte
das Referat in naher Zukunft verlassen (z.B. wegen ihres Studienabschlusses) und dass durch die
Corona-Pandemie nur wenige engagierte Menschen neu ins Referat kommen.
• Austausch zu Maßnahmen, die für die Referate gut funktioniert haben
• Veranstaltungen online bewerben, Social-Media-Reichweite ausbauen
• Veranstaltungen über queere (Uni-)Institutionen (z.B. Zentrum Gender Wissen, queere Institute)
bewerben
• Online-Veranstaltungsangebot niedrigschwelliger gestalten, engagierte Leute offen ansprechen
• Mail an alle Studierenden über Gesamtverteiler schicken
• (vor Corona): queere Partys/Cocktailabende veranstalten, mit queerfeministischem Input
verbinden
• Zielgruppe von Veranstaltungen (insbesondere Safer Spaces) klar definieren und direkt
ansprechen (Welche Personen denke ich mit?)Sie können auch lesen