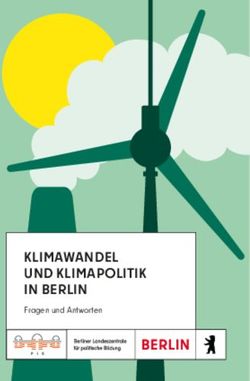Den Göttern gleich - Schlitten am Berliner Hof um 1700
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kulturgeschichte Preußens – Colloquien #9 Den Göttern gleich – Schlitten am Berliner Hof um 1700 Autor: Claudia Meckel Datum: 11.12.2020 DOI: 10.25360/01-2020-00014 Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative Commons Lizenz Namensnennung · Keine kommerzielle Nutzung · Keine Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/byncnd/4.0/ Zitierhinweis: in: Silke Kiesant (Hrsg.) unter Mitarbeit von Florian Dölle nach dem Konzept von Saskia Hüneke, Kaleidoskop. Seitenblicke auf die Bildhauerkunst in den preußischen Schlössern und den Gärten, in: Kulturgeschichte Preußens – Colloquien #9, 11/12/2020, DOI: 10.25360/01-2020-00014
Claudia Meckel
Den Göttern gleich – Schlitten am Berliner Hof um 1700
Abstract
Schlittenfahrten waren fester Bestandteil höfischen Lebens, ein die europäischen Höfe verbindendes
Element der Selbstdarstellung mit politischer Absicht. Ihre große Zeit fällt in das letzte Drittel des 17.
und beginnende 18. Jahrhundert, am Berliner Hof in das letzte Regierungsjahrzehnt des Großen
Kurfürsten und die Zeit Friedrichs III./I. Hofbildhauer wetteiferten in der Anfertigung prunkvoller
Schlitten, von denen heute europaweit nur noch wenige Exemplare erhalten sind. Die Berliner
Sammlung an Schlitten des späten Barock galt bis 1945 als qualitativ höchststehender Bestand. Was
zeichnet die Berliner Prunkschlitten um 1700 aus? Wer waren die Bildhauer, die sich diesem Teil der
Hofkunst widmeten? Woher bezogen sie Anregung und Inspiration? Am Beispiel der zwei in der SPSG
erhaltenen und von vier im Zuge des Zweiten Weltkrieges verlorenen, in historischen Fotos
dokumentierten Schlitten wird diesen Fragen in Gegenüberstellungen mit graphischen Vorlagen und
Zeugnissen der Innenraum-und Möbelkunst der preußischen Schlösser nachgegangen.
Einleitung
Es entspricht einer gängigen Auffassung, Schlitten dem Bereich der Angewandten Kunst zuzuordnen.
Die höfischen Schlitten aber waren bis weit in das 18. Jahrhundert hinein die Domäne der Bildhauer.
Hofbildhauer waren die Auftragnehmer. Sie legten den Entwurf vor, waren selbst die Ausführenden
oder verantwortlich für die Ausführung. 1 Beteiligt waren Stellmacher, Schlosser, Schmiede, Schnitzer,
Sattler, Posamentierer, Maler und Vergolder.
Exklusivität und Einzigartigkeit zeichnet die Berliner Prunkschlitten aus der Zeit um 1700 aus, die im
Folgenden, eingeordnet in den kulturhistorischen Kontext, in detaillierter Werkschau und mit einem
Fazit der Betrachtungen vorgestellt werden. 2
Einordung
Seit dem 16. Jahrhundert hat es nachweislich Schlitten am Berliner Hof gegeben. Am Schloss des
brandenburgischen Kurfürsten Joachim II. (reg. 1535-1571) befanden sich an der Front des
Spreeflügels zwei eng beieinanderstehende Türme. Der linke, dickere bot eine spiralig aufsteigende
Rampe, auf der man mit den Schlitten bis in die Gemächer hinauffahren konnte. Der Augsburger
Philipp Hainhofer hielt diese moderne Einrichtung zur Auffahrt in seinem Reisebericht 1617 für
bemerkenswert. 3 Achtzig Jahre später mussten die Türme dem Schlossbau Friedrichs III./I. (reg. 1688-
1713) zugunsten der barocken, repräsentativ einheitlichen Fassade weichen. 4 Schlittenfahrten waren
1
Zur Einordnung der Schlitten in die Gattung Skulptur siehe Heinrich Kreisel: Prunkwagen und Schlitten, Leipzig
1927, 137-167. – Fritz Fischer: Dem Volk zur Schau. Prunkschlitten des Barock. Die Schlittensammlung des
Württembergischen Landesmuseums Stuttgart, München 2002, 10f., 40.
2
Der Vortrag basiert auf den Forschungsergebnissen zum Bestands- und Verlustkatalog der Berliner
Marstallsammlung: Claudia Meckel: Kutschen, Schlitten, Sänften, Stiftung Preußische Schlösser und Gärten
Berlin-Brandenburg, Bestandskataloge der Kunstsammlungen, Angewandte Kunst, hrsg. vom Generaldirektor,
Berlin 2013.
3
Bericht Philipp Hainhofers über seinen Aufenthalt in Berlin in einem Brief an Herzog August d. J. von
Braunschweig vom 16./17.Oktober 1617, in: Der Bär, 1884, abgedruckt in: Eberhard Faden: Berlin im
Dreißigjährigen Krieg, Berlin 1927, 235-247, hier 240f.
4
Vergleiche Johann Stridbeck d. J.: Berliner Schloss, Innerer Schlosshof, Aquarell um 1690, Abb. in: URL:
https://www.stadtmuseum.de/objekte-und-geschichten/berlin-stadtrundgang-1690 . – Peter
102im 17. Jahrhundert kein intern höfisches Amüsement, sondern ein inszeniertes Ereignis, ein die Höfe
verbindendes Element der Selbstdarstellung. Die Straßen der Residenz, zur Nacht illuminiert, waren
der Schauplatz. Durch Zeitungsberichte, Darstellungen in Gemälden und Tapisserien erfuhren die
höfischen Schlittenfahrten Nachhaltigkeit. (Abb. 1)
Abb. 1 Jacques van der Borcht / Jeronimus de Clerck, “Nächtliche Schlittenfahrt“ aus der Wandteppichserie “Die
Höfischen Feste“, Brüssel, um 1700, Geschenk von König Ludwig XIV. von Frankreich an den brandenburgischen
Kurfürsten Friedrich III., SPSG, Schloss Oranienburg, ehem. Berliner Schloss, IX 1384, SPSG, Foto: SPSG /
Wolfgang Pfauder, ca. 2012
So berichteten Berliner Zeitungen im Januar 1681 von einer Schlittenfahrt des Kurprinzen Friedrich:
“[…] voran fuhren zwei Schlitten mit sechzehn Trompetern und zwei Heerpaukern, darauf folgte der
Stallmeister, dann der Kurprinz mit der Kurprinzessin, dann der französische Gesandte und […]
andere fürstliche Personen, Cavaliere und Damen in zwanzig wohl ausgezierten Schlitten. Die Fahrt
währte gegen vier Stunden, […]“. 5 Die Berichterstattung konzentrierte sich wie üblich auf die
Ordnung nach dem Zeremoniell, die ranghohen Teilnehmer und die Anzahl der Schlitten, nicht auf
deren Form und Gestalt. Auch zeitgenössische Beschreibungen der Rüstkammer, in der die Schlitten
außerhalb ihres Einsatzes aufbewahrt und – mit personeller Einschränkung – besichtigt werden
konnten, geben kaum Details der Gestaltung preis. Der Italiener Gregorio Leti erwähnte 1687 “eine
große Anzahl der Maschinen, welche man Schlitten nennet“. 6 Es war die Bewegung der
phantastischen Schlitten-Gebilde, ihr, wenn die Kufen im Schnee, die Zugpferde unter ihren Decken
verschwanden, scheinbar unsichtbares Fortkommen, das faszinierte. Schlitten glichen den Rollwagen,
die bei Triumphzügen wie von Geisterhand gesteuert am staunenden Publikum vorbeifuhren. Sie
Schenk: Modell Andreas Schlüters für das Berliner Schloss 1698, Kupferstich, aus: Pieter Schenk: Hecatompolis
[...], Amsterdam, 1702, Bl. 38 (Exemplar in: SPSG, Inv. Nr. GK II (1), Schloss Berlin, Mappe 139 d), Abb. in: URL:
https://www.alamy.com/stock-photo/schl%C3%BCter.html?page=3, ID: MY 25T3 (RM) .
5
Zitiert aus: Carl Eduard Vehse: Geschichte der deutschen Höfe seit der Reformation, Abth. 1: Preußen,
Geschichte des preußischen Hofs und Adels und der preußischen Diplomatie, Hamburg 1851, 262f.
6
Aus dem Bericht von Gregorio Leti: Ritratti, historici, politici, chronologici e genealogici della casa Serenissima
e elettorale die Brandeburgo, Amsterdam 1687, 333. Hier zitiert aus: Leopold von Ledebur: Gesammelte
Nachrichten von der ehemaligen Königlichen Preußischen Rüstkammer in Berlin, in: Allgemeines Archiv für
Geschichtskunde des Preußischen Staates, 11, 1833, 193-230, 194.
103suggerierten “göttliche Automobilität“. Denn “die Gottheiten aller Religionen erscheinen […] immer
automobil. Sie reiten und fahren nicht wie Menschen, sondern sie erscheinen.“ 7 Ein für Kurfürst
Johann Wilhelm von der Pfalz (reg. 1690-1716) in der Werkstatt des Bildhauers Gabriel Grupello
(1644-1730) gearbeiteter sogenannter Diana-Schlitten gibt hierfür ein in der Kombination von
Triumph-bzw. Carrouselwagen und Schlitten selten erhaltenes Beispiel. 8 Leicht im Schnee gleitend,
ohne dass sich das Räderwerk bewegt, erweckte dieser Schlitten den Eindruck schwebenden
Fortkommens.
Abb. 2 Jacques Callot, Einzug Heinrichs von Lothringen, Radierung, 1627, aus: Jules Lieure: Catalogue de
l’oeuvre gravée, Paris 1927, 581, Davison Art Center, Zugangsnummer 1971.10.1.7, URL: http://dac-
collection.wesleyan.edu/Obj3314
Jacques Callot (1592-1635), der an den Höfen von Cosimo II. de Medici und Herzog Karl IV. von
Lothringen tätig war, prägte mit seinen Entwürfen und Darstellungen von Festen den für das 17.
Jahrhundert und darüber hinaus gültigen Triumphwagentypus. Wie sich die originellen Festwagen,
zum Teil in Tiergestalt, für den Einzug Heinrichs von Lothringen 1627 fortbewegen, ist in der
Entwurfszeichnung nicht genau zu bestimmen. (Abb. 2) Callot erhielt auch Aufträge von Ludwig XIII.
von Frankreich und vom spanischen Hof. Sein druckgraphisches Werk fand weite Verbreitung. Noch
Jahrzehnte später gab es Inspirationen für das veritable Theater der Pracht Ludwigs XIV. in Versailles.
7
Jörg J. Berns: Die Herkunft des Automobils als Himmelstrionfo und Höllenmaschine, Berlin 1996, 8.
8
Gabriel Grupello: Diana-Schlitten für Kurfürst Johann Wilhelm von der Pfalz, Düsseldorf um 1710 (Basel,
Historisches Museum, Inv. Nr. 1922.360), Abb. siehe: URL:
http://www.hmb.ch/sammlung/object/diana-schlitten.html . – Grupello arbeitete auch für
Friedrich III./I., er schuf unter anderem dessen Marmorstandbild 1692 für das Potsdamer Stadtschloss (SPSG,
Inv. Nr. Skulpt.slg. 93, Schloss Oranienburg).
104Werkschau
Versailles hielt für jeden aufstrebenden Herrscher Vorbilder bereit. Schlitten aus der Zeit Ludwigs
XIV. (reg. 1643/1661-1715) sind jedoch weder aus Versailles noch von den Höfen in Wien, Den Haag,
Dresden und aus italienischen Sammlungen erhalten – allesamt Höfe, die um 1700 miteinander
konkurrierten und der Berliner Hofkunst zum Teil Modelle vorgaben.
Die Schlittensammlung des Berliner Hofes zählte bis 1945 noch zehn Exemplare aus den letzten
Jahren der kurfürstlichen Zeit und der Ära Friedrichs I. (Abb. 3)
Abb. 3 Drei Schlitten im Hohenzollernsaal des Hohenzollern-Museums, Berlin, Schloss Monbijou (seit 1945
Verlust), SPSG, Fotothek, Foto: SPSG, um 1878
Durch den Münchner Kunsthistoriker Heinrich Kreisel, der 1927 mit seinem Werk “Prunkwagen und
Schlitten“ als erster den Versuch unternahm, eine europäische Kunstgeschichte des Schlittens zu
geben, erfuhr die Berliner Sammlung ihre erste, folgende Würdigung: “Wohl der qualitativ
höchststehende Bestand an Schlitten des späten Barock hat sich in Berlin noch aus der Zeit König
Friedrichs I. erhalten“. Drei der Berliner Schlitten, die Kreisel in seinem umfangreichen Tafelwerk
abbildete (siehe Abb. 5, 14, 16) bezeichnete er als “Gipfelleistungen des Schlittenbaus überhaupt“. 9
Heute ist die Sammlung mit zwei erhaltenen Schlitten und vier in historischen Fotos dokumentierten
9
Kreisel: Prunkwagen (wie Anm. 1), 149.
105Nachkriegsverlusten vergleichsweise gut präsent, was eine Werkschau möglich macht. 10 Die beiden
erhaltenen, seit 2006 in der Remise von Schloss Paretz ausgestellten Schlitten vertreten
unterschiedliche Gattungen, zum einen den Figurenschlitten mit ornamentalem Dekor (siehe Abb. 5),
zum anderen den sogenannten Tierschlitten, bei dem der gesamte Korpus die Gestalt eines Tieres
einnimmt (siehe Abb. 20) – vergleiche die Entwürfe Callots. Materialanalysen haben bestätigt, dass,
wie in Anleitungen zum Schlittenbau vorgeschlagen, für das Kufengestell hartes Buchenholz
verwendet wurde, während der Kasten und sein geschnitzter Dekor aus Lindenholz gearbeitet ist. Es
handelt sich um sogenannte Rennschlitten, ein Typus, der sich seit dem 16. Jahrhundert an den
mitteleuropäischen Höfen durchgesetzt hat. Merkmale sind die hohen Kufenläufe und die rückseitig
am Kasten befestigte Pritsche für den Kavalier oder Lakaien. Letzterer hielt die Zügel und lenkte den
in der Regel von nur einem Pferd gezogenen Schlitten. (Abb. 4)
Abb. 4 Unbekannter Künstler, Das Moderne Schlitten-Carrousel, Kupferstich, aus: Valentin Trichter: Georg
Engelhard von Löhneysen/ Neu=eröffnete Hof-Kriegs= und Reit Schul [...], Nürnberg 1729, VI. Theil, 91, fig. 79,
URL: http://digitale.bibliothek.uni-halle.de/vd18/content/structure/5861692
Der Begriff Rennschlitten leitet sich von den vielerorts an den Höfen veranstalteten Ringrennen her.
Der Dresdner Hof war bekannt für seine unübertroffen prunkvollen Schlittenkarussells.
10
Die aus Archiven zusammengetragenen, im Vortrag gezeigten historischen Aufnahmen sind hier aus
urheberrechtlichen Gründen nur zum Teil abgebildet, vollständig veröffentlicht in: Meckel: Kutschen (wie Anm.
2).
106Abb. 5 Johann Michael Döbel, zugeschrieben, Rennschlitten-Putto, Berlin, um 1690, erneuert 1701, SPSG,
Schloss Paretz, Remise, XVII 2, SPSG, Foto: SPSG / Roland Handrick, 2000
Bei dem hier gezeigten Schlitten unserer Sammlung trägt die am Kasten vorn aufsitzende Putto-Figur
Schild und Wurfstab, eine Anspielung auf seine Bestimmung für das Karussell, das dem Insassen des
Schlittens, hier übertragen auf die Putto-Figur, einiges an körperlichem Einsatz abverlangte. (Abb. 5)
Inspiration und Anregung für den Schlittendekor aus dichtem Akanthuslaub, in welchem sich Putten
tummeln, dürften italienische Vorlagen gegeben haben. 11 (Abb. 6)
Abb. 6 Unbekannter italienischer Künstler, Karossenentwurf, 1670-1700, Radierung, SPSG, Ornamentstichslg. OS
4, SPSG, Foto: SPSG / Roland Handrick, 2000
11
Vergleiche auch Ornamentstiche von Blattfriesen mit Putten z. B. von dem Florentiner Stefano della Bella
(1610-1664), URL: https://www.meisterdrucke.de/k%C3%BCnstler/Stefano-della-Bella.html , hier
Tafel 14, oder Laubwerkranken von dem in Wien tätigen Johann Indau (1651-1690), URL:
https://www.graphikportal.org/document/gpo00194901 .
107An den hinteren Kastenseiten ist der Stern des Hosenbandordens zu sehen. (Abb. 7)
Abb. 7 Johann Michael Döbel, zugeschrieben, Rennschlitten-Putto, Seitenansicht des Kastens mit Stern des
Hosenbandordens, Berlin, um 1690, SPSG, Schloss Paretz, Remise, XVII 2, SPSG, Foto: SPSG / Roland Handrick,
2000
Die Frage, ob der Schlitten bereits für den Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm (reg. 1640-1688)
oder erst für seinen Sohn in den 1690er Jahren angefertigt wurde, ist nicht eindeutig zu
beantworten. Beide Herrscher waren Träger des begehrten, höchsten englischen Ritterordens.
108Friedrich III. konnte 1689 in die Ordensstelle seines Vaters einrücken, die feierliche Installierung fand
zehn Jahre später statt. Die Königskronen, welche die Putten vorn am Schlittenkasten tragen (siehe
Abb. 5), wurden erst 1701 beigegeben. Der Austausch bzw. die Beigabe von Hoheitszeichen nach der
Rangerhöhung eines Herrschers war eine durchaus übliche, auch bei Karossen angewendete Praxis.
Es spricht für die besondere Bedeutung dieses Schlittens, der noch im 19. Jahrhundert bei
Schlittenfahrten zum Einsatz kam. Die Putten-Figuren erhielten damals zeitgemäß einen schwarzen
Überzug. 12 Erst im Zuge der Restaurierung in den 1950er Jahren wurde die helle Fassung wieder
freigelegt.
Allein über einhundert zwischen 1690 und 1713 in Berlin tätige Bildhauer sind uns durch die
Recherchen Friedrich Nicolais namentlich bekannt. 13 Die Zahl scheint nicht zu hoch, wenn man
bedenkt, wie vielfältig ihr Aufgabengebiet war. Angesichts der Tatsache, dass uns für die Berliner
Schlitten keine konkreten Hinweise auf die Künstler vorliegen, sind
Werkzuschreibungen nur unter Nutzung des stilkritischen Instrumentariums zu erbringen.
In der vergleichenden Betrachtung des Schlittendekors mit Stuckdecken im Berliner,
Charlottenburger und Oranienburger Schloss lassen sich motivische und formale Analogien
feststellen. Friedrich Nicolai benennt für die Deckenstuckkaturen der Braunschweigischen Galerie im
Berliner Schloss Johann Michael Döbel (1635-1702) als ausführenden Bildhauer. 14 Burkhardt Göres
brachte den Rennschlitten-Putto erstmals mit diesem vor Andreas Schlüter wichtigsten Berliner
Bildhauer in Verbindung. 15 Seit 1641 war Döbel als Bildhauer in Königsberg tätig. Studienreisen
führten ihn nach Holland, Frankreich und Italien. 1667 wurde er von Kurfürst Friedrich Wilhelm zum
preußischen Landbaumeister berufen. Er wohnte zu der Zeit bereits in Berlin und agierte im
Wesentlichen von dort in der Hoffnung auf Aufträge für Bildhauerarbeiten. 1676 erhielt er die
Aufsicht über das Bauwesen in Berlin und Cölln. Bildhauerarbeiten unter anderem im alten Berliner
Dom, im Marstall und Residenzschloss sowie für die Lustschlösser Bornim und Caputh sind
überliefert. Außer Frage steht Döbels Beschäftigung mit der holländischen und italienischen Kunst.
Auch arbeitete er in Berlin gemeinsam mit dem Schweizer Baumeister und Stuckateur Giovanni
Simonetti (1652-1716). Die Berufung Döbels zum Hofbildhauer erfolgte, wie Saskia Hüneke
feststellte, erst durch Friedrich III. 1689. 16 Zu seinen wenigen nachgewiesenen Werken zählt der
Sarkophag für die 1683 verstorbene Kurprinzessin Elisabeth, der ersten Gemahlin des Kurprinzen
Friedrich, in der Berliner Dom-Gruft. Dieser zeigt ein Blattwerk in ähnlich krautigen Formen mit
eingerollten Blattspitzen wie am Schlittenkorpus. 17 Döbel zugeschrieben wurden auch die Decken des
Gläsernen Schlafgemachs Sophie Charlottes und des Porzellankabinetts in Oranienburg. An letzterer
Decke erscheint der Stern des Hosenbandordens neben dem Kreuzmonogramm Friedrichs III. an
exponierter Stelle in den Zwickelfeldern. (Abb. 8-9)
12
Vergleiche Abb. in: Kreisel: Prunkwagen (wie Anm. 1), Tafel 42 B.
13
Friedrich Nicolai: Nachrichten von Baumeistern, Bildhauern, Kupferstechern, Malern, Stukkaturern und
anderen Künstlern welche vom dreyzehnten Jahrhunderte bis jetzt in und um Berlin sich aufgehalten haben
und deren Kunstwerke zum Theil daselbst noch vorhanden, Berlin / Stettin 1786, 69-120.
14
Nicolai: Nachrichten (wie Anm. 12), 44. – Abb. u. a. in: Goerd Peschken / Hans-Werner Klünner: Das Berliner
Schloß, 2. Auflage, Frankfurt am Main / Berlin 1991, Abb. 188a bis 189b.
15
Burkhardt Göres: Berliner Prunkschlitten, Kutschen und Sänften des Barock, Ausstellung, Berlin, Staatliche
Museen zu Berlin, Berlin 1987, Kat. Nr. 2, 20.
16
Saskia Hüneke: Bildhauer am Hofe des Großen Kurfürsten, in: Ausst. Kat. Der Große Kurfürst. Sammler,
Bauherr und Mäzen, hrsg. v. der Generaldirektion der Staatlichen Schlösser und Gärten Potsdam-Sanssouci,
Ausstellung, Potsdam, Neues Palais, Potsdam 1988, 122, Anm. 6.
17
Rüdiger Hoth: Die Gruft der Hohenzollern im Dom zu Berlin, in: Grosse Baudenkmäler Heft 426, 2. Auflage,
München / Berlin 1995, Nr. 45, Abb. Seite 17, 19.
109Abb. 8 Johann Michael Döbel, zugeschrieben, Decke des Gläsernen Schlafgemachs von Sophie Charlotte, Berlin,
Schloss Charlottenburg, Raum 118, um 1695/1697, Wünsdorf, BLDAM, Messbildarchiv, Neg.-Nr. 21 h 16 /
1615.54
110Abb. 9 Johann Michael Döbel, zugeschrieben, Decke des Porzellan-Kabinetts, SPSG, Schloss Oranienburg,
Ausschnitt, um 1695/1697, SPSG, Foto: SPSG / Wolfgang Pfauder, 2000
Die enge Beziehung der Schmuckformen zur Innenraum- und Möbelkunst der brandenburgisch-
preußischen Schlösser vor 1700 ist ein wesentliches Merkmal dieses Schlittens. Offensichtlich sind
Analogien zu den Bildhauermöbeln wie etwa zur prunkvollen Sitzbank mit den Initialen Friedrichs III.
111unter dem Kurhut, den Zeichen des Hosenbandordens und den Adler-Figuren als Eckbekrönungen.
(Abb. 10)
Abb. 10 Unbekannter Künstler, Sitzbank mit den Initialen Friedrichs III., Berlin, um 1690, SPSG, Schloss
Charlottenburg, ehem. Berliner Schloss, IV 3330, SPSG, Foto: SPSG / Wolfgang Pfauder / Daniel Lindner, 2012
An Rennschlitten der Zeit um 1700 ist Laubwerk in der Dichte und Plastizität sonst nur in Entwürfen
bzw. Stichvorlagen überliefert. In der Regel bedeckt Akanthuslaub den Kasten und Kufenauslauf nur
partiell, wie beispielsweise an Schlitten des Herzogs Eberhard Ludwig von Württemberg (reg. 1693-
1733). 18 Die Beachtung, welche dem Berliner Rennschlitten-Putto geschenkt wurde, zeigt nicht
zuletzt seine Darstellung auf der Tapisserie von Pierre Mercier “Die Fahrt des Großen Kurfürsten über
das Kurische Haff“. (Abb. 11)
18
Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Inv. Nr. 14373f, URL: https://bawue.museum-
digital.de/index.php?t=objekt&oges=3071&cachesLoaded=true .
112Abb. 11 Pierre Mercier, Die Fahrt des Großen Kurfürsten im Schlitten über das Kurische Haff, aus der Folge
“Kriegstaten des Großen Kurfürsten“, Berlin, nach 1699, SPSG, Schloss Oranienburg, ehem. Berliner Schloss, IX
1374, SPSG, Foto: SPSG / Jörg P. Anders, 1970-1999
Wissend, dass diese Fahrt in einem schlichteren Reiseschlitten erfolgte, fiel in der Illustration der
Ruhmestat des Großen Kurfürsten die Wahl auf den Prunkschlitten.
Ein paar Seitenblicke auf die Schlitten, welche den Sammlungen der preußischen Schlösser in den
Nachkriegsmonaten 1945 verloren gingen, sollen Aussagen stützen und weitere bildhauerische
Leistungen der Gattung vorstellen.
Der Bildhauer des verlorenen Rennschlittens-Minerva/Fama lässt sich nicht namentlich ermitteln.
(Abb. 12)
113Abb. 12 Unbekannter Künstler, Rennschlitten-Minerva/Fama, Berlin, um 1701, Aufnahme um 1910, Berlin,
Neuer Marstall, Marstallmuseum, Sammlungsverlust, Wünsdorf, BLDAM, Messbildarchiv, Neg.-Nr. 93 qu 17 /
1614.9
Erkennbar ist seine Orientierung an italienischen Vorbildern. Ein Künstler von großem Einfluss war
der Italiener Ludovico Burnacini (1636-1707), der als Hofkünstler am kaiserlichen Hof in Wien
Schlitten entwarf und seine Zeichnungen in den Druck gab. Einer seiner Entwürfe zeigt einen
Schlittenkorpus, der aus nichts anderem als aus einer Ansammlung von Trophäen besteht. (Abb. 13)
Abb. 13 Johann Andreas Pfeffel / Christian Engelbrecht, Entwurf für einen Schlitten mit Trophäen von Ludovico
Burnacini, Kupferstich, Wien, um 1700, Berlin, SMBPK, Kunstbibliothek, Inv. Nr. OS 1408, 1, Bl. 88
114Der Bildhauer des Berliner Schlittens fügte den Trophäen noch ein in Berlin in der Bau- und
Denkmalplastik um 1700 häufig anzutreffendes Motiv von gefesselten Figuren hinzu. Zum
motivischen Vergleich können beispielsweise fünf Andreas Schlüter (1659/60-1714) zugeschriebene
Terrakotta-Modelle mit Darstellung Gefesselter vor Trophäen herangezogen werden. 19 Bestimmt für
die Einbindung in einen architektonischen Kontext, wie den Bau von Triumphtoren für Friedrich III./I.,
wird den Figuren hier wie den dicht am Schlittenkasten kauernden Gestalten nur wenig
Bewegungsspielraum gegeben. Auch das Bildprogramm des zeitgleich entstandenen Schlittens
thematisiert den Triumph. Es ist mit seinen allegorisch-symbolischen Bezügen ganz auf die
Verherrlichung des jungen preußischen Königtums ausgerichtet. Schützend umfasst Minerva, Symbol
der Wehrhaftigkeit, Personifikation der Weisheit und Behüterin der Künste und Wissenschaften, die
preußische Königskrone. Kunst und Wissenschaft bedürfen der Fürsorge des Herrschers und können
nur in Friedenszeiten gedeihen. Die voranschreitende Fama verkündet deshalb nicht nur Ruhm,
sondern sie beschwört den Frieden als erhoffte Segnung für die Regentschaft des Königs, dessen
Monogramm man zwischen den Kufenläufen erblickt. Die Botschaft wurde damit konkret. Die gleiche
Komposition begegnete auch im wichtigsten Saal, dem Rittersaal, des Berliner Schlosses über dem
mittleren der drei Bogenfenster.
Der Rennschlitten-Herkules der Berliner Sammlung beeindruckte in der Interpretation des Themas, 20
übertragen auf den Schlitten, durch die Dynamik und Plastizität der Skulptur. (Abb. 14)
Abb. 14 Andreas Schlüter / Georg Gottfried Weyhenmeyer (?), zugeschrieben, Rennschlitten-Herkules, um 1700,
Sammlungsverlust, Foto aus: Heinrich Kreisel: Prunkwagen und Schlitten, Leipzig 1927, Tafel 41 B (SPSG)
19
Berlin, SMBPK, Skulpturensammlung, Inv. Nr. 7811-7815, zuletzt in: Ausst. Kat., Andreas Schlüter und das
barocke Berlin, hrsg. von Hans-Ulrich Kessler, Staatliche Museen zu Berlin, Ausstellung, Berlin, Bodemuseum,
München 2014, Kat. IV/5a-e, 75-77, mit Abbildungen (Text Bernd Wolfgang Lindemann).
20
Hierzu: Klaus Irle: Herkules im Spiegel der Herrscher, in: Herkules, Tugendheld und Herrscherideal, Das
Herkules-Monument in Kassel-Wilhelmshöhe, hrsg. von den Staatlichen Museen Kassel, 61-77.
115Heinrich Kreisel stellte ihn in seinem 1927 verfassten Standardwerk zu den europäischen
Prunkwagen und Schlitten in die Nähe des 1694 zum Hofbildhauer berufenen Andreas Schlüter. 1695
war Schlüter wohl in Paris, wo er die von dem französischen Architekten, Bildhauer und Maler Pierre
Puget (1620-1694) geschaffene Figurengruppe des Milon von Kroton gesehen haben dürfte. (Abb. 15)
Abb. 15 Pierre Puget, Milon von Kroton, ein griechischer Ringkämpfer, 1672-1683, Paris, Musée du Louvre, URL:
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=92161
116Pugets Werk spiegelt die auch für Schlüter wichtige Auseinandersetzung mit den Arbeiten von
Michelangelo (1475-1564) und Gian Lorenzo Bernini (1598-1680). In den 1670er Jahren arbeitete
Puget in einer Schiffswerft in Toulon. Damals entstand die Figur des griechischen Ringkämpfers
Milon, die wie eine steinerne Gallionsfigur wirkt und vielleicht gerade deswegen Anregung für die
Schlittenskulptur bot. 21 Inspiration für die auf dem Löwenkopf sitzende muskulöse Herkules-Figur des
Schlittens gab sicherlich auch der antike “Torso von Belvedere“ (siehe den Beitrag mit Abb. von
Franziska Windt). 22 Die gestreckte Beinhaltung, ein Zitat von Puget, verlieh der Schlittenskulptur
zusätzliche Spannung und Ausdruckskraft. Typologisch am nächsten steht der Berliner Herkules-
Schlitten, für den eine Vergoldung und bunte Bemalung aktenkundig sind, einem heute zur großen
Sammlung des Württembergischen Landesmuseums gehörenden, vor 1635 entstandenen Kentauren-
Schlitten des Ulmer Patriziers Marx Philipp Besserer. 23 Dieser wurde dem Ulmer Bildhauer David
Heschler (1611-1667) zugeschrieben. Der unter Schlüter arbeitende Bildhauer Georg Gottfried
Weyhenmeyer (1666-1715) stammte aus Ulm. Möglicherweise war er an der Ausführung des Berliner
Schlittens beteiligt. Unsere Vorstellungen vom Stil Weyhenmeyers, der im 18. Jahrhundert ein hoch
angesehener Bildhauer war, sind heute nur sehr vage.
Neben Herkules war Apoll die zweite Schlüsselgestalt in der politischen Herrscherikonographie.
Apolls Sieg über die Pythonschlange und seine Gleichsetzung mit Sol, dem Lenker des
Sonnenwagens, gaben wichtigste Anknüpfungspunkte. Beim Rennschlitten-Apoll der einstigen
Berliner Sammlung jagt der jugendliche Gott dem Python in Drachengestalt hinterher, sein Pfeil hat
eben getroffen, was auf den Schlitten-Insassen übertragen auch diesem Sieg und Ruhm verheißt.
(Abb. 16)
Abb. 16 Andreas Schlüter, Rennschlitten-Apoll, Berlin um 1700, Sammlungsverlust, Foto aus: Heinrich Kreisel:
Prunkwagen und Schlitten, Leipzig 1927, Tafel 42 (SPSG)
21
In Inventarverzeichnissen und Festbeschreibungen des 16. bis frühen 18. Jahrhunderts werden Schlitten mit
Schiffen gleichgesetzt und als solche bezeichnet, Kreisel: Prunkwagen (wie Anm. 1), 134, 141).
22
Apollonius von Athen: Torso von Belvedere, 1. Jh. v. Chr., Rom, Vatikanische Museen, Sala delle Muse des
Museo Pio-Clementino, Inv. Nr. 1192, URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Torso_vom_Belvedere .
– Ferner zum Vergleich Giambologna (1529-1608): Herkules und der Kentaur, Italien 1600, Florenz, Loggia dei
Lanzi, URL: https://www.wga.hu/frames-e.html?/html/g/giovanni/bologna/hercules.html .
23
Stuttgart, Württembergisches Landesmuseum, Inv. Nr. 875, URL: https://bawue.museum-
digital.de/index.php?t=objekt&oges=27&cachesLoaded=true .
117Schlüters Autorenschaft steht bei diesem in seiner Präsenz und szenisch-phantasievollen Gestaltung
herausragenden Schlitten außer Frage. Das von ihm wenig später geschaffene Statuenpaar Daphne
und Apoll vom Dach der Villa Kameke erfuhr wegen ihres hinausgreifenden Agierens an dieser
Position besondere Beachtung. (Abb. 17)
Abb. 17 Andreas Schlüter, Gesimsfiguren Apoll und Daphne vom Dach des Mittelrisalits der Villa Kameke,
1711/1712, Berlin, SMBPK, Bode-Museum, Kamecke-Halle, URL:
https://kunstbeziehung.goldecker.de/mp.php?sd%5BpCode%5D=5a65caeae3050&sd%5BrCode%5D=BB_KH)
In Szene gesetzt erscheint auch die Apoll-Figur in der Südwestecke der Voute im Rittersaal des
Berliner Schlosses. (Abb. 18)
Abb. 18 Andreas Schlüter, Gesimsfiguren, rechts Apoll, an der Südwestecke des Rittersaals im Berliner Schloss,
um 1703, SPSG, Fotothek, Foto: SPSG, 1927-1945
118Den Göttergestalten gemeinsam ist die durch die Gegensätzlichkeit der Bewegungen spannungsvolle
und zugleich elegant graziöse Körpersprache. Der Wolkenbett-Thron ist identisch. Götter fahren
nicht, sondern sie treten in Erscheinung, was dieser Schlitten in besonderer Weise verheißt.
Eine originelle ebenfalls szenische Auffassung verkörpert auch der verlorene Tierschlitten in Gestalt
eines Hirsches, bei dem das elegant-kraftvolle Tier wie aus einem Gebüsch von dichtem
Akanthuslaub hervorzuspringen scheint. (Abb. 19)
Abb. 19 Unbekannter Künstler, Rennschlitten-Hirsch, Berlin, um 1690, Aufnahme um 1910, Berlin, Neuer
Marstall, Marstallmuseum, Sammlungsverlust, Wünsdorf, BLDAM, Messbildarchiv, Neg.-Nr. 93 qu 19 / 1614.11
Auftraggeber und Besitzer des Schlittens war Friedrich III./I., dessen Namenszug “FRIDERICUS
ELECTOR“ am Halsband erscheint. In der griechischen Mythologie verwandelt sich Göttin Diana
bisweilen selbst in eine Hirschkuh mit goldenem Geweih, das als Zeichen göttlicher Macht
verstanden wurde. Das Geweih am Schlitten war Inventarangaben zufolge vergoldet. Entsprechend
komplex und auf den Insassen bezogen ist die Ikonographie des wohl auch zur Jagd verwendeten
Schlittens zu deuten.
Auf die bedeutende Rolle des Pferdes in der aristokratischen Gesellschaft muss nicht besonders
hingewiesen werden. Diesen zweiten in der SPSG erhaltenen Schlitten in Gestalt eines braunen
Rosses soll Friedrich III. bei Maskeraden benutzt haben. (Abb. 20)
119Abb. 20 Unbekannter Künstler, Rennschlitten-Pferd, Berlin, um 1695/1700, SPSG, Schloss Paretz, Remise, XVII 3,
SPSG, Foto: SPSG / Roland Handrick, 2000
Rang und Status seines Besitzers werden auch hier im Dekor deutlich. So verweist das plastisch
dargestellte, vergoldete Geschirr mit Schellengeläut auf die soziale Stellung, denn Schlittenfahren mit
Geläut waren ein Privileg des Adels. Der Kurhut über dem brandenburgischen Adler am hinteren Teil
des Korpus weist auf eine Anfertigung des Schlittens vor der Krönung 1701 hin. (Abb. 21)
Abb. 21 Unbekannter Künstler, Rennschlitten-Pferd, Rückseite des Kastens mit dem vom Kurhut bekrönten
brandenburgischem Adler, Berlin, um 1695/1700, SPSG, Schloss Paretz, Remise, XVII 3, SPSG, Foto: SPSG /
Roland Handrick, 2000
120Auf den Kufenspitzen steht der preußische Adler. Im Rahmen fürstlich repräsentativer
Darstellungsmodi erhält das Bildprogramm somit eine konkrete politische Aussage. Friedrich III.
suchte mit allen Mitteln seinem Streben nach Rangerhöhung sichtbaren Ausdruck zu verleihen. Der
ausführende Bildhauer des Schlittens ist nicht bekannt. Er könnte zu den unter Anleitung Schlüters
arbeitenden Künstlern gehört haben, wofür die energiegeladenen, kraftvollen Tierfiguren sprechen. 24
Das gilt für die Figur des Adlers, dessen Gefieder sich dem Wind entgegenstellt. In der rechten Klaue
hielt dieser den Herrschaftsstab, so, als würde er seinem Stand die Balance geben. Das Pferd
galoppiert mit aufgeblähten Nüstern und wehender Mähne. Zum technischen Aufbau sei angemerkt,
dass der Pferdekörper mehrfach blockverleimt, vollrund beschnitzt und ausgehöhlt, innen mit
Eisenbändern verstärkt und die Gliedmaßen angesetzt wurden. Inzwischen weist der Schlitten einige
Blessuren auf. Seine und die Rettung des Döbelschen Schlittens (siehe Abb. 5) kommt einem Wunder
gleich, denn die hier vorgestellten Rennschlitten befanden sich im Mai 1945 noch unversehrt an
ihrem Auslagerungsort im Babelsberger Marstall. Die Verluste sind ungeklärt.
Fazit
Schlittenfahrten waren am Berliner Hof um 1700 ein häufiges Divertissement und immens wichtiges
Element der Selbstdarstellung. Beispielgebend war das veritable Theater der Pracht Ludwigs XIV. mit
seinen Großszenen, in denen Menschen, Tiere und Maschinen den Schauplatz füllten und heidnische
Götter mit ihrem mythologischen Fuhrpark erschienen. Bei der Gestaltung der Berliner Schlitten
kamen die traditionellen Topoi der Herrscherikonographie und die Emblematik zur Demonstration
von Ruhm und Macht des Potentaten zur Anwendung. Die Berliner Hofbildhauer Johann Michael
Döbel, Andreas Schlüter, möglicherweise Georg Gottfried Weyhenmeyer und andere, deren Namen
sich heute nicht mehr mit den Schlitten in Verbindung bringen lassen, haben für diese Gattung einen
eigenen Stil mit engen Beziehungen zur Raumkunst und originellen Interpretationen entwickelt. Die
Berliner Schlitten waren in das künstlerische Gesamtkonzept eingebettet. Wie für die Berliner
Hofkunst um 1700 insgesamt, bot Italien, auch in der Vermittlung über Wiener Hofkünstler, eine
wichtige Inspirationsquelle. Für die sechs Berliner Prunkschlitten aus der Zeit von 1685 bis 1705 gibt
es in den Sammlungen der großen europäischen Herrscherhäuser keinen Vergleich. Sie waren und
sind in den beiden in der SPSG erhaltenen Exemplaren exklusiv und einzigartig.
Autorin:
Claudia Meckel
Sammlungskustodin Metall, Kunsthandwerkliche Einzelgegenstände, Marstallsammlung, Sammlung
Dohna
Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg
Postfach 601462
14471 Potsdam
c.meckel@spsg.de
24
Vergleiche Andreas Schlüter, Sarkophag der Königin Sophie Charlotte im Berliner Dom, 1705, SPSG, Fotothek,
Foto: SPSG, 1927-1945, Abb. u a. in: Sophie Charlotte und ihr Schloß. Ein Musenhof des Barock in Brandenburg-
Preußen, hrsg. v. der Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg,
Ausstellung, Berlin, Schloss Charlottenburg, 1999, München 1999, 173.
121Sie können auch lesen