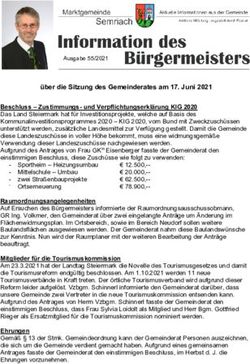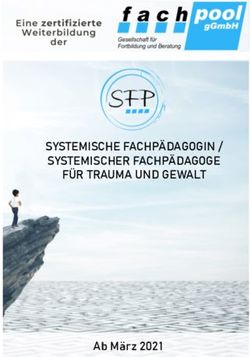Die Inflation hat viele Verlierer - Der Chefökonom - 6. August 2021 - Handelsblatt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Der Chefökonom – 6. August 2021 Die Inflation hat viele Verlierer Höhere Teuerungsraten haben für staatliche Schuldner auch Nachteile. Die Regierungen sollten vorbereitet sein. von Bert Rürup und Axel Schrinner Die Schuldner gelten gemeinhin als die großen Gewinner einer Inflation. Und der größte Schuldner ist nahezu überall auf der Welt der Staat. Die Geschichte ist voll mit Beispielen, in denen Herrscher oder Regierungen die Geldpresse anwarfen, um sich so - scheinbar bequem - ihrer Schuldenlasten zumindest teilweise zu entledigen. Auch gegenwärtig scheint der deutsche Staat der große Gewinner des spürbar steigenden Preisniveaus zu sein. Dank einer im Juli bei 3,8 Prozent liegenden Inflationsrate schrumpften jene gut 2,1 Billionen Euro, die das Statische Bundesamt im Sommer 2020 als Staatsschuld ausgewiesen hatte, binnen eines Jahres real um 77 Milliarden Euro. Rechnerisch löste sich damit der Gegenwert von fast zwei Jahren Energiesteueraufkommen scheinbar in Luft auf.
Doch in der Wirklichkeit ist die Rechnung für den Staat keineswegs so einfach, wie es den Anschein hat. Reale Größen sind für die Planung und Aufstellung des Haushalts und damit für die Tagespolitik unerheblich. Die im Maastricht-Vertrag verankerten Ziele für Schulden- und Defizitquote beruhen wie die Schuldenbremse auf nominalen Größen, also auf den tatsächlichen Ausgaben und Einnahmen des Staates innerhalb eines Jahres in Relation zum jeweiligen Bruttoinlandsprodukt. Hinzu kommt, dass angesichts von Null- oder gar Negativzinsen die öffentlichen Hände durch neu aufgenommene Schulden erst einmal nicht belastet werden, sondern sogar Zinseinnahmen verbuchen können. Bei der Umfinanzierung ersetzen Zinseinnahmen auf die neuen Schulden sogar Zinsausgaben auf die fällig gewordenen Altschulden. Gleichzeitig belastet der Preisanstieg den Staatshaushalt. Steigende Energiepreise verteuern die Heizkosten für öffentliche Gebäude, steigende Baustoffpreise die Kosten von Bauinvestitionen, und steigende Löhne erhöhen sowohl die Rechnungen für Handwerker und Dienstleister des Staates wie die Ausgaben für eigene Bedienstete. Zudem muss der Staat Sozialhilfe- und Grundsicherungsleistungen regelmäßig an den Preisanstieg anpassen. Kaum Beachtung wird dagegen den Problemen auf der Einnahmeseite geschenkt, also bei den Steuereinnahmen. So sind die großen, allein dem Bund zustehenden Verbrauchsteuern etwa auf Mineralöl, Strom, Tabak oder Alkohol durchweg Mengensteuern. Die Steuer beträgt einen bestimmten Cent-Betrag pro Liter, Kilowattstunde oder Zigarette. Das Steueraufkommen steigt daher nicht, wenn sich die Nettopreise dieser Waren verteuern. Deshalb degenerierten historische Mengensteuern etwa auf Salz, Zucker, Spielkarten oder Leuchtmittel allmählich zu Bagatellsteuern, die schließlich abgeschafft wurden. Ein zweites, mutmaßlich größeres Problem zeigt sich bei der Einkommensteuer. So muss der Staat regelmäßig den nominal festgelegten Grundfreibetrag erhöhen, damit - wie vom Bundesverfassungsgericht vorgegeben - das reale Existenzminimum steuerfrei bleibt. Weil ein steigender Grundfreibetrag alle Steuerzahler entlastet, ist dessen Anhebung für die öffentlichen Haushalte stets teuer. Bescheidene Tarifkorrekturen für 2022 Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung verpflichtet, die Steuerzahler regelmäßig von den Belastungen durch die "kalte Progression" freizustellen. Unter "kalter Progression" versteht man den Anstieg des durchschnittlichen Einkommensteuersatzes, der auf solche Einkommenserhöhungen zurückzuführen ist, die lediglich die Inflation ausgleichen. Dem kann durch eine geeignete Verschiebung des Steuertarifs begegnet werden. Nun ging die 2
Bundesregierung im Herbst des Jahres 2020, als der Bundestag diese Tarifverschiebung verabschiedete, von lediglich 1,17 Prozent Inflation in diesem Jahr aus. Dementsprechend fallen die Tarifkorrekturen für 2022 bescheiden aus. Mittlerweile erwarten Konjunkturexperten für dieses Jahr knapp drei Prozent Inflation im Jahresdurchschnitt. Die neue Regierung müsste also im Herbst die Entlastung für 2022 eigentlich um einen zweistelligen Milliardenbetrag nachbessern - oder diese Entlastung zumindest im Folgejahr 2023 nachholen. Der zu einem großen Teil von der Politik selbst ausgelöste Inflationsschub hat also das Zeug dazu, ein Milliardenloch in die mittelfristigen Finanzplanungen zu reißen. Besonders teuer wird es für den Staat dadurch, dass die Inflation nicht allein auf einer allgemein aufwärtsgerichteten Wirtschaftsentwicklung mit dann auch steigenden Einkommen beruht, sondern zum guten Teil staatlich administriert ist: durch den Wiederanstieg der Mehrwertsteuersätze und die sich in den kommenden Jahren fortsetzenden höheren CO2-Abgaben. In diesem Maße werden also keine ungerechtfertigten Mehreinnahmen bei der Einkommensteuer zurückgegeben, sondern ausschließlich diese Steuer gesenkt. Immer dann, wenn der Staat selbst die Inflation über höhere Verbrauchsteuern anheizt, die Einkommen aber nicht entsprechend steigen, geht ein Teil der dadurch verursachten Steuermehreinnahmen durch die Progressionskorrektur wieder verloren. Nun ist es erklärtes Ziel der meisten Industrieländer, der Erderwärmung durch höhere Preise für Energie aus fossilen Trägern zu begegnen. Selbst wenn den Bürgern die Einnahmen aus CO2- Steuern oder -Emissionshandel zurückgegeben werden, sind kräftige Preissteigerungen bei sehr vielen Produkten infolge steigender Herstellungs- und Transportkosten zu erwarten. Hinzu kommt, dass auf beiden Seiten des Pazifiks die Vorteile der weltwirtschaftlichen Arbeitsteilung, also der Globalisierung, zunehmend in Zweifel gezogen und protektionistische Maßnahmen ergriffen werden. Neue Handelshemmnisse würde nicht nur das Wachstum dämpfen, sondern auch zu höheren Preisen führen. Gerade auch vor dem Hintergrund des demografisch bedingt knapper werdenden Arbeitsangebots wird es nicht ausbleiben, dass auch die Löhne und Gehälter steigen. Käme dann eine Lohn-Preis- Spirale in Gang, würde auch die Europäische Zentralbank (EZB) nicht mehr umhinkönnen, etwas zu unternehmen. Denn dies dürfte nicht nur Deutschland, sondern den gesamten Euro-Raum betreffen. In der Folge ist mit geringeren Anleihekäufen oder sogar -verkäufen und letztlich wieder steigenden Zinsen zu rechnen. 3
In der Folge werden vor allem die hoch verschuldeten Euro-Staaten mehr Zinsen zahlen müssen. Die im Niedrigzinsumfeld ausgeweiteten mittleren Laufzeiten der Staatsanleihen werden dabei kurzfristig nicht viel helfen, weil die nationalen Notenbanken ihre Anleihekäufe vor allem kurzfristig über höhere Einlagen refinanziert haben und dann mit wesentlich geringeren Gewinnen oder gar Verlusten rechnen müssen. Die Staaten werden also rasch einen Rückgang der Gewinnausschüttungen ihrer Notenbanken spüren. Löhne in Asien steigen spürbar Die Ära einer sehr niedrigen Inflation könnte alsbald zu Ende gehen. Zum einen sind die Löhne in China und anderen asiatischen Ländern spürbar gestiegen. Weitere Preissenkungen sind daher nicht zu erwarten. Zudem ist - wie die Industrie gerade schmerzlich erlebt - Europa bei strategischen Vorprodukten wie Halbleitern von Lieferungen aus Fernost abhängig. Solche Abhängigkeiten schaffen Spielraum für dauerhafte Preiserhöhungen. Zum anderen wird die alternde Bevölkerung in Deutschland und Europa den Fachkräftemangel verstärken und damit zu steigenden Löhnen führen. Verschuldete Staaten profitieren also keineswegs nur von höheren Inflationsraten. Die Wirkungsmechanismen sind wesentlich komplexer. Die nächste Bundesregierung täte daher gut daran, ihre Finanzplanung daraufhin zu prüfen, wie widerstandsfähig diese gegenüber Teuerungsschüben ist. Dies gilt für die Ausgaben- wie für die Einnahmenseite. Sich nur darauf zu verlassen, dass die Notenbanken Inflationsgefahren im Keim ersticken, könnte sich als fahrlässig herausstellen. Denn gegen viele Formen von Preisniveauerhöhungen sind selbst die Notenbanken machtlos. 4
Sie können auch lesen