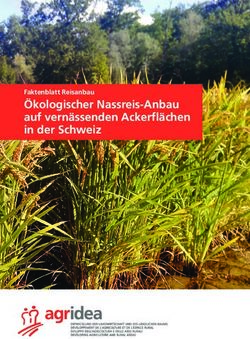Die Rechte und Pflichten der Käufer und Verkäufer bei eBay
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Die Rechte und Pflichten der Käufer und Verkäufer bei eBay
Inhaltsverzeichnis
I) Vertragsschluß............................................................................................................................. 3
1) Höchstgebotauktionen............................................................................................................. 3
2) Sofort-Kaufen Option..............................................................................................................3
3) Typische, vermeidbare Fehler................................................................................................. 3
4) Getäuscht................................................................................................................................. 4
5) Rücknahme des Angebots durch den Verkäufer..................................................................... 5
II) Leistungsstörungen..................................................................................................................... 6
1) Rücktritt oder Erfüllung.......................................................................................................... 6
2) Die Kaufsache wird vor dem Versand zerstört....................................................................... 6
3) Versand und Haftung.............................................................................................................. 7
4) Der Käufer zahlt nicht............................................................................................................. 7
5) Spaßbieter................................................................................................................................ 7
III) Widerruf bzw. Rückgabe der Ware........................................................................................... 9
1) Hinweispflicht......................................................................................................................... 9
2) Bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware................................................................. 9
3) Rechtsfolgen.......................................................................................................................... 10
IV) Gewährleistungsrecht.............................................................................................................. 11
1) Die einzelnen Gewährleistungsrechte................................................................................... 11
2) Ausschluß der Gewährleistungsrechte.................................................................................. 11
V) Das Bewertungsforum.............................................................................................................. 12
VI) Die Informationspflichten des gewerblichen Verkäufers....................................................... 13
VII) Abmahnungen........................................................................................................................ 14
VIII) Zum Autor............................................................................................................................ 15
2Vorwort
Die Praxis zeigt, dass sowohl private als auch gewerbliche Nutzer der Internetplattform eBay ihre
Rechte und Pflichten falsch einschätzen. Gewerbliche Anbieter setzen sich z.B. häufig dem Risiko
einer kostenpflichtigen Abmahnung aus, da ihre Angebotsseiten den gesetzlichen Anforderungen
nicht genügen. Im Gegensatz dazu haben private Käufer oftmals völlig falsche Vorstellungen
davon, wie sie sich im Falle einer Falsch- oder Schlechtlieferung zu verhalten haben. Dieser
Vortrag gibt Ihnen als Nutzer der Internetauktionsplattform eBay einen Überblick über ihre Rechte
und Pflichten, so dass Sie angemessen reagieren können, wenn Sie selbst oder Ihr Vertragspartner
einen Fehler gemacht haben.
I) Vertragsschluß
Es gibt grundsätzlich nur zwei Möglichkeiten, wie eine eBay-Auktion erfolgreich, d.h. durch einen
wirksamen Vertragsschluß beendet werden kann. Zum einen durch die Abgabe des höchsten Gebots
nach dem Ablauf der Auktionsdauer (Höchstgebotauktionen) oder durch die Benutzung der Sofort-
Kaufen Option. Der Verkäufer kann darüber hinaus diese beiden Elemente kombinieren oder im
Falle der Höchstgebotsauktion vorab festlegen, dass ein Kaufvertrag nur dann zustande kommt,
wenn das Höchstgebot einen von ihm vorher festgelegten Mindestbetrag erreicht hat.
1) Höchstgebotauktionen
Bei Höchstgebotauktionen kommt der Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer und dem Bieter mit
dem höchsten Gebot nach dem Ablauf der Auktionszeit zustande. Der Verkäufer ist dann
verpflichtet dem Käufer die Ware vereinbarungsgemäß zukommen zu lassen (§ 433 Abs.1 Satz1 des
Bürgerlichen Gesetzbuches, kurz BGB). Der Käufer ist im Gegenzug verpflichtet die Ware zu
bezahlen und abzunehmen (§ 433 Abs.1 Satz 2 BGB).
2) Sofort-Kaufen Option
Bei der Sofort-Kaufen Option kommt der Vertragsschluß durch das Anklicken des Sofort-Kaufen
Buttons und der darauf folgenden Bestätigung dieser Aktion durch den Käufer zustande. Die
rechtlichen Folgen sind dieselben wie nach dem Abschluss der Höchstgebotsauktionen.
3) Typische, vermeidbare Fehler
Die über diese gerade beschriebenen Verpflichtungen hinausgehenden Vertragspflichten ergeben
sich zumeist aus der Auktionsbeschreibung und eventuellen Absprachen bzw. Angaben der Parteien
vor oder nach dem Vertragsschluß. Deshalb hat der Verkäufer alle relevanten Daten, die die
Kaufsache selbst oder aber deren Versand bzw. deren Abholung betreffen, ausführlich in der
Auktionsbeschreibung darzulegen. Der Käufer sollte die Artikelbeschreibung sowie das
„Kleingedruckte“ ebenfalls ausführlich studieren, denn dann erlebt nach der Auktion keine böse
Überraschung.
Nachfolgend werden einige typische Streitfälle, die, wenn alle Beteiligten sich an die obigen
Ausführungen gehalten hätten, vermeidbar gewesen wären skizziert:
a) Der Verkäufer verkauft einen Handydummy (eine Handyattrappe). Er macht diesen
Umstand aber nicht bereits in der Artikelüberschrift, sondern versehentlich erst in der
Artikelbeschreibung kenntlich.
Der Verkäufer hat im vorliegenden Fall, meist ohne böse Absicht ein wesentliches Merkmal
3der zum Verkauf angebotenen Ware nur im Auktionstext und nicht bereits in der Überschrift
kenntlich gemacht. Es war jedoch für jeden Interessenten leicht erkennbar, dass es sich nur
um eine Attrappe handelt. Deshalb liegt ein wirksamer Kaufvertrag vor. Der Käufer hat
dann den vollen Kaufpreis zu entrichten, da der Irrtum seiner Sphäre zuzurechnen ist und
beim Durchlesen der Artikelbeschreibung nicht entstanden wäre.
b) Der Verkäufer macht auf der eigentlichen Angebotsseite keinerlei Angaben zu den
Versandkosten. Die Angebotsseite enthält jedoch einen gut sichtbaren und
unmissverständlichen Link (Verweis) auf die Seite, auf welcher der Verkäufer seine
Versandkostenstaffel und seine AGB (Allgemeine Geschäftsbedingungen) niedergelegt hat.
Ein Käufer erwirbt nun einen kleinen Gegenstand für einen Euro und muss laut der
Versandkostenstaffel des Verkäufers Versandkosten in Höhe von 10 Euro aufbringen.
Dieser Umstand war ihm jedoch nicht bewusst, da er sich die Versandkostenstaffel nicht
angesehen hat.
Der Käufer hat in diesem Fall die Versandkosten in voller Höhe zu bezahlen, auch wenn der
Verkäufer unter Umständen real für Verpackung und Versand nur die Hälfte des genannten
Betrages aufbringen muss. Denn er konnte in einer nach der Rechtsprechung ausreichenden
Art und Weise Kenntnis von der Versandkostenstaffel und den AGB nehmen (OLG Hamm,
Urteil vom 14.04.2005, Az. 4 U 2/05).
c) Der Verkäufer bestellt die in der Auktion angebotenen Waren erst nach dem Auktionsende
bei einem Großhändler. Daraus ergibt sich eine Lieferzeit von zwei oder mehr Wochen.
Diesen Umstand hat der Verkäufer ausreichend deutlich auf der Angebotsseite kenntlich
gemacht und er wäre dem Käufer beim vollständigen Durchlesen der Angebotsseite auch
nicht verborgen geblieben.
Hier hatte der Käufer vor dem Ende der Auktion die Möglichkeit Kenntnis von der langen
Lieferzeit zu erlangen. Diese ist ein Bestandteil des Auktionsangebots geworden, was zur
Folge hat, dass der Käufer sich nicht vom Vertrag lösen oder anderweitige Rechte geltend
machen kann, solange der Verkäufer die von ihm in der Auktionsbeschreibung angegebenen
Lieferzeiten einhält.
4) Getäuscht
Die obigen Beispiele zeigen nur einige von vielen typischen und vermeidbaren Streitpunkten
zwischen redlichen Vertragsparteien. Aber natürlich gibt es auch einige unredliche Verkäufer, die
bewusst wesentliche Merkmale/Fehler der zum Kauf angebotenen Ware in einer unübersichtlichen
Auktionsbeschreibung verstecken, um so den Preis in die Höhe zu treiben. In solchen Fällen wird
meist eine bewußte Täuschung zum Nachteil des Käufers vorliegen. Läßt sich diese
Täuschungsabsicht beweisen (ein objektiver Dritter müßte nach dem Durchlesen der
Auktionsbeschreibung zum selben Ergebnis wie der Käufer gelangen), so kann der Käufer den
Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten (§ 123 BGB) und sich dadurch vom Vertrag lösen.
Sollten ihm darüber hinausgehende und für den unredlichen Verkäufer erkennbare finanzielle
Nachteile entstanden sein, kann er diese vom Verkäufer ersetzt verlangen (§ 826 BGB).
Im Einzelfall kann die Abgrenzung zwischen bewußter Täuschung und unbewußter Nachlässigkeit
des Verkäufers schwierig sein. Deshalb sollte man in solchen Fällen, zumindest bei teureren Waren,
immer professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Aber auch in den Fällen der unbewußten Nachlässigkeit des Verkäufers kann sich der Käufer durch
Anfechtung vom Vertrag lösen, wenn es sich bei der unbewußten Aussparung in der
4Artikelbeschreibung um ein wesentliches Merkmal der Ware handelt und der Käufer bei Kenntnis
dieses Merkmals den Artikel nicht gekauft hätte (§ 119 Abs.2 BGB).
5) Rücknahme des Angebots durch den Verkäufer
Solange niemand auf das Angebot des Verkäufers geboten hat, stehen einer Rücknahme des
Angebots durch den Verkäufer keine Bedenken entgegen. Aber die Rücknahme des Gebots ist auch
nach der Abgabe eines Gebots möglich, wenn bestimmte Voraussetzungen vorliegen. eBay hat
diesbezüglich nicht zu beanstandende Regelungen aufgestellt (siehe
http://pages.ebay.de/help/sell/end_early.html). Danach kann der Verkäufer bis zum Anbruch der
letzten zwölf Stunden vor dem Auktionsende die Auktion abbrechen, wenn die Ware z.B.
beschädigt, zerstört oder dem Angebot eine falsche bzw. unvollständige Artikelbeschreibung
zugrunde liegt.
Sollte das Angebot des Verkäufers vor dessen vorzeitiger Beendigung bereits mit einem Gebot
belegt gewesen sein, kann der derzeit Höchstbietende daraus keine Rechte ableiten.
5II) Leistungsstörungen
Weitere häufige Streitpunkte sind das Ausbleiben der Lieferung der Ware bzw. das Ausbleiben der
fälligen Kaufpreiszahlung. In beiden Fällen sollten die Betroffenen erst mit dem Vertragspartner
Kontakt aufnehmen um so den Grund für die Verzögerung der Leistung in Erfahrung zu bringen.
Sollte der Vertragspartner nicht reagieren oder entgegen seiner neuerlichen Leistungsversprechen
nicht fristgerecht seiner Leistungspflicht (zahlen oder liefern) nachkommen, kann eine Mahnung
ausgesprochen werden. Diese Mahnung sollte neben einer angemessenen Frist (ca. 2 Wochen) die
Androhung enthalten, dass man zur Durchsetzung der eigenen Ansprüche den Rechtsweg
beschreiten wird.
1) Rücktritt oder Erfüllung
Wenn der Vertragspartner seinen Leistungspflichten nicht nachkommt und der Betroffene erfolglos
eine Mahnung ausgesprochen hat, kann der Betroffene entweder an seinem Leistungsbegehren
festhalten (weiterhin auf Lieferung bestehen) oder vom Vertrag zurücktreten (sein Geld
zurückverlangen). Zur Durchsetzung dieser Rechte kann er dann auf Kosten der Gegenseite
anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen.
Das Festhalten am Leistungsbegehren ist nur sinnvoll, wenn der Käufer die Hoffnung hat, dass der
Verkäufer den gekauften oder einen vergleichbaren Gegenstand liefern kann. In allen anderen
Fällen wird der Rücktritt, ggf. in Kombination mit Schadensersatzansprüchen, die bessere Wahl
sein.
2) Die Kaufsache wird vor dem Versand zerstört
Es kann vorkommen, dass die Kaufsache nach dem Vertragsschluß aber vor der Versendung durch
den Verkäufer zerstört wird. In diesem Fall wird der Verkäufer von seiner Leistungspflicht frei,
wenn es sich um ein Einzelstück handelt (dies ist bei gebrauchten Sachen regelmäßig der Fall). Der
Käufer muss dann den Kaufpreis nicht zahlen (§§ 275, 326 BGB). Handelte es sich um einen neuen,
massenhaft hergestellten Gegenstand kann der Käufer die Lieferung eines anderen Gegenstandes
dieser Produktionsreihe verlangen.
Häufig teilt der Verkäufer dem Käufer direkt nach der Auktion mit, dass die Ware zerstört wurde,
wenn der Kaufpreis sehr niedrig ist. Meistens versuchen enttäuschte Verkäufer so ihrer Pflicht zur
Abgabe der Ware zu entfliehen. Dies muss sich der Käufer jedoch nicht widerspruchslos gefallen
lassen. Läßt sich ein Marktpreis für den zerstörten Gegenstand ermitteln und lag der zu zahlende
Kaufpreis weit unter diesem Marktpreis, so kann der Käufer die Differenz als Schadensersatz
gegenüber dem Verkäufer geltend machen, wenn dieser für die Zerstörung des Kaufgegenstandes
verantwortlich war (§§ 275, 326, 325, 280 BGB).
Beispiel:
Der Käufer erwirbt bei eBay ein gebrauchtes Handy für 50 € dessen Marktpreis
nachweislich bei 150 € liegt. Der Verkäufer teilt dem Käufer nach der Auktion mit, dass das
Handy zerstört worden sei.
Der Käufer wird meist nicht beweisen können, dass das Handy nicht zerstört wurde. Der
Käufer kann jedoch vom Vertrag zurücktreten, d.h. er muss den Kaufpreis nicht zahlen und
zudem vom Verkäufer Schadensersatz in Höhe von 100 € fordern, wenn dieser für die
Zerstörung der Ware verantwortlich ist.
Natürlich werden die Verkäufer zur Vermeidung ihrer Haftung behaupten, dass die Ware von einem
6Dritten versehentlich zerstört wurde. In diesem Fall hätte der Käufer keinen Anspruch auf
Schadensersatz gegenüber dem Verkäufer. Er kann jedoch die Abtretung des
Schadensersatzanspruchs, der dem Verkäufer gegen den Drittem zusteht bzw. die Herausgabe des
aus diesem Anspruch erlangten vom Verkäufer verlangen (§§ 275, 326, 285 BGB).
Beispiel:
Der Käufer erwirbt bei eBay ein gebrauchtes Handy für 50 € dessen Marktpreis
nachweislich bei 150 € liegt. Der Verkäufer teilt dem Käufer nach der Auktion mit, dass das
Handy von einem Dritten zerstört worden sei.
In diesem Fall kann der Verkäufer von dem Dritten Schadensersatz für das zerstörte Handy
verlangen. Der Käufer kann sich diesen Anspruch abtreten lassen oder, wenn der Dritte dem
Verkäufer den Schaden bereits ersetzt hat, die Herausgabe des Erlangten, hier also 150 €
vom Verkäufer fordern.
3) Versand und Haftung
Wer für Probleme, die während des Versendens der Ware auftreten haftet, ist davon abhängig, ob es
sich um einen Verbrauchsgüterkauf (§ 474 BGB) oder um ein Geschäft unter Privatleuten bzw. Ge-
schäftsleuten handelt. Ein Verbrauchsgüterkauf liegt immer dann vor, wenn ein Verbraucher (§ 13
BGB) von einem Unternehmer (§ 14 BGB) eine bewegliche Sache kauft.
Bei einem Verbrauchsgüterkauf trägt der Unternehmer gemäß § 474 Abs. 1 BGB unabhängig von
der vom Käufer gewählten Versandart (versichert oder unversichert) das Transportrisiko.
In allen anderen Fällen kann das Transportrisiko auch dem Käufer aufgebürdet werden.
4) Der Käufer zahlt nicht
Wenn der Käufer rechtsgrundlos die Zahlung verweigert kann der Verkäufer den Rechtsweg zur
Durchsetzung seiner Forderung beschreiten. Der kostengünstigere Weg (der Kläger muss die
Prozesskosten vorschießen) ist zunächst die Beantragung eines gerichtlichen Mahnbescheids. Wenn
der Gegner dem Mahnbescheid nicht fristgerecht widerspricht erhält der Verkäufer zeitnah einen
Vollstreckungsbescheid, mit dem er dann gegen den Käufer die Zwangsvollstreckung betreiben
kann.
Widerspricht der Käufer dem gerichtlichen Mahnbescheid bleibt nur noch eine gerichtliche Klage.
In beiden Fällen hat der Käufer im Falle des Verlustes des Rechtsstreits die Prozesskosten, also die
Anwalts- und Gerichtskosten zu tragen.
5) Spaßbieter
Die Rechtsfragen um den Problemkreis Spaßbieter sind obergerichtlich noch nicht abschließend
geklärt worden. Deshalb gibt es zum Teil widersprüchliche Urteile zu diesem Thema:
Gemäß einer Entscheidung des Amtsgerichts Bremens (Az: 16 C 168/05) kann der Verkäufer von
„Spaßbietern“ eine Vertragsstrafe in Höhe von 30% des Kaufpreises fordern, wenn die
Auktionsbeschreibung des Verkäufers eine entsprechende Klausel enthielt. Andererseits obliegt
gemäß der Rechtsprechung des Oberlandesgerichts Köln (Az: 19 U 120/05) der Nachweis, dass die
Person, die als Käufer bei eBay registriert ist, auch wirklich für den Vertragsschluß verantwortlich
ist dem Verkäufer.
7Beispiel:
Über den Account des vermeidlichen Käufers wird vom Verkäufer ein Auto im Wert von
10.000 € erworben. Der Käufer behauptet später sein minderjähriger Sohn habe unbefugt
seinen Rechner benutzt, indem er sich unbefugt die Zugangsdaten des Vaters beschafft hat,
um dann eigenmächtig den Wagen in dessen Namen zu erwerben. Er selbst befand sich im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nachweislich im Ausland und hatte dort keinen Zugriff auf
das Internet.
In diesem Fall muss der Vater den Kaufpreis nicht zahlen, da kein Vertrag zwischen ihm
und dem Verkäufer zustande gekommen ist. Denn nach der Rechtsprechung des
Oberlandesgerichts Köln trägt der Verkäufer das Risiko, dass ein Dritter das Konto eines
registrierten eBay-Mitglieds für seine Zwecke missbraucht.
8III) Widerruf bzw. Rückgabe der Ware
Dem Verbraucher (§ 13 BGB) steht gegenüber dem Unternehmer (§ 14 BGB) bei einem
sogenannten Fernabsatzvertrag, also bei Online- und im Versandhandelsgeschäften, ein mindestens
zwei Wochen betragendes Widerrufsrecht zu (§§ 312d, 355 ff. BGB). Anstelle des Widerrufsrechts
kann der Verkäufer den Kunden auch ein Rückgaberecht einräumen (§ 356 BGB). Da es sich bei
eBay-Auktionen um Fernabsatzgeschäfte muss jeder gewerbliche Anbieter (Unternehmer) seine
potentiellen Privatkunden (Verbraucher) über das ihm zustehende Widerrufs- / Rückgaberecht
ausreichend informieren.
1) Hinweispflicht
Der gewerbliche eBay-Verkäufer hat den potentiellen Privatkunden bereits in der
Auktionsbeschreibung auf dessen Widerrufsrecht hinzuweisen (§ 312c BGB). Deshalb sollte bereits
die Auktionsbeschreibung eine vollständig abgefaßte Widerrufsbelehrung enthalten. Entsprechend
den von der Rechtsprechung zu dieser Problematik aufgestellten Grundsätzen reicht es jedoch aus,
wenn der gewerbliche Käufer auf seiner Angebotsseite einen unmissverständlichen und deutlich
sichtbaren Link einfügt, der den Kunden zu seiner andernorts hinterlegten Widerrufsbelehrung
führt.
Die Urteile des Kammergerichts Berlin (KG Berlin, Az. 5 W 156/06) und des Oberlandesgerichtes
Hamburg (OLG Hamburg, Az. 3 U 103/06) haben jedoch klargestellt, dass die Widerrufsfrist bei
gewerblichen eBay-Angeboten mindestens 4 Wochen beträgt, da eine auf einer Webseite
dargebotene Widerrufsbelehrung nicht den gesetzlichen Anforderungen genügt bzw. genügen kann.
Eine ordnungsgemäße Widerrufsbelehrung könne deshalb dem Verbraucher grundsätzlich erst nach
dem Ende der Auktion via E-Mail, mit der Rechnung oder in sonstiger Weise zugeleitet werden.
Ist die Widerrufsbelehrung fehlerhaft oder fehlt diese vollständig, wird die vierwöchige
Widerrufsfrist erst durch die Zuleitung einer ordnungsgemäßen Widerrufsbelehrung in Gang
gesetzt. Deshalb sollten gewerbliche eBay-Anbieter Ihren Kunden nach Auktionsschluss generell
via E-Mail oder mit dem Rechnungs- bzw. Warenversand eine ordnungsgemäße
Widerrufsbelehrung zukommen lassen.
Von der Verwendung der im Anhang zu § 14 BGB-InfoV bereit gestellten
Musterwiderrufsbelehrungen sollte jedoch abgesehen werden, weil diese fehlerhaft sind. Eine
fehlerhafte Widerrufsbelehrung ist jedoch nicht geeignet, die Widerrufsfrist in Gang zu setzen.
Außerdem setzt sich der Verkäufer damit der Gefahr aus, von Mitbewerbern wegen einer unlauteren
Wettbewerbshandlung in Anspruch genommen zu werden (mehr zu diesem Thema unter www.ra-
riefenstahl.de, „Die Widerrufsbelehrung, eine teure Stolperfalle für jeden Internethändler?“).
2) Bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware
Durch die sogenannte bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Ware erlischt das Widerrufsrecht
des Verbrauchers nicht (§ 357 Abs. 3 BGB). Unter bestimmungsgemäßer Ingebrauchnahme
versteht man die normale Benutzung des Gegenstandes. Beim Kauf einer Hose ist also nicht bereits
das Anprobieren, sondern erst das normale Tragen der Hose deren bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme.
Auch in diesen Fällen kann der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht gebrauch machen. Jedoch
hat er dem Verkäufer den Wertverlust, der durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
entstanden ist zu ersetzen, wenn der Verkäufer ihn vorher darauf hingewiesen hat. Dieser Hinweis
kann in die Widerrufsbelehrung integriert werden.
93) Rechtsfolgen
Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht gebrauch, so haben die Vertragsparteien die
empfangenen Leistungen zurück zu gewähren (§§ 357 Abs.1, 346 ff. BGB). D.h. der Käufer hat die
Ware, falls möglich zurück zu senden. Der Verkäufer hat dem Käufer den Kaufpreis zu erstatten.
Die Kosten der Rücksendungen hat grundsätzlich der Verkäufer zu tragen. Etwas anderes gilt nur,
wenn der Warenwert weniger als 40,00 € beträgt und der Verkäufer die Kostentragungspflicht für
die Rücksendung in seiner Widerrufsbelehrung, für eben diesen Fall, explizit auf den Käufer
abgewälzt hat (§ 357 Abs.2 BGB).
10IV) Gewährleistungsrecht
Der Verkäufer muss laut dem Gesetzeswortlaut die Kaufsache frei von Mängeln an den Käufer
übergeben (§ 433 Abs. 1 Satz 2 BGB). Dieser Grundsatz gilt uneingeschränkt bei neuen Sachen.
Bei gebrauchten Sachen bezieht sich dieser Grundsatz nur auf die Mängel, die dem Verkäufer im
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht bekannt waren und die deshalb nicht Bestandteil des
Kaufvertrages geworden sind. - In diesem Zusammenhang möchte ich nocheinmal darauf
hinweisen, dass der Verkäufer dem Käufer alle ihm bekannten Mängel vor dem Vertragsschluß
mitzuteilen hat. Andernfalls liegt eine arglistige Täuschung vor, die den Käufer zur Anfechtung des
Vertrages berechtigt (§ 123 BGB). Sollten ihm darüber hinausgehende und für den unredlichen
Verkäufer erkennbare finanzielle Nachteile entstanden sein, kann er diese vom Verkäufer ersetzt
verlangen (§ 826 BGB).
1) Die einzelnen Gewährleistungsrechte
Entsprechend dem Gesetzeswortlaut ist die Kaufsache mangelfrei, wenn sie im Zeitpunkt des
Gefahrübergangs die vereinbarte Beschaffenheit aufweist (§ 434 Abs.1 Satz 1 BGB). Wenn die
Parteien keine besonderen Vereinbarungen hinsichtlich der Beschaffenheit der Kaufsache getroffen
haben ist sie sachmangelfrei, wenn sie sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung
eignet oder wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit
aufweist, die bei Sachen der gleichen Art üblich ist und die der Käufer nach der Art der Sache
erwarten kann (§ 434 Abs.1 Satz 2 BGB).
Ist die Kaufsache mangelhaft, so kann der Käufer vom Verkäufer Nacherfüllung (Nachbesserung)
verlangen oder den Kaufpreis mindern oder vom Kaufvertrag zurücktreten und/oder ggf.
Schadensersatz oder den Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen (§ 437 BGB).
Der Käufer muss dem Verkäufer regelmäßig eine Chance zur Mängelbeseitigung einräumen. Erst
wenn diese fehlschlägt oder nicht möglich ist, kann er von den anderen oben genannten rechtlichen
Möglichkeiten gebrauch machen.
Die Kosten der Mängelbeseitigung trägt ausschließlich der Verkäufer. Gleiches gilt für den Fall des
berechtigten Rücktritts vom Kaufvertrag. In diesem Fall hat der Käufer dem Verkäufer die
Kaufsache zurück zu gewähren. Der Verkäufer hat dem Käufer neben dem Kaufpreis auch die
Kosten des Rücktransports zu erstatten. Sollten durch die mangelhafte Sache Schäden an
Gegenständen des Käufers verursacht worden sein, so hat der Verkäufer diese zu beseitigen bzw.
den Schaden in Geld zu ersetzen.
2) Ausschluß der Gewährleistungsrechte
Ein Ausschluß der Gewährleistungsrechte kommt zwischen Verbrauchern und gewerblichen
Verkäufern nicht in Betracht (§ 475 BGB); gleiches gilt für neue Sachen auch bei gewerblichen
Vertragspartnern (§ 309 Nr. 8 b BGB). Bei neuen Sachen verjähren die Gewährleistungsrechte nach
zwei Jahren, bei gebrauchten Sachen in einem Jahr (§ 475 Abs. 2 BGB).
Ein völliger Ausschluß der Gewährleistung ist nur zwischen Verbrauchern und bei gebrauchten
Gegenständen auch zwischen Gewerbetreibenden möglich. Bei Verbrauchern reicht es aus, wenn
der Verkäufer ganz allgemein auf den Ausschluß der Gewährleistung und seine
Verbrauchereigenschaft („Verkauf von Privat“) hinweist. - Ein solcher Fall liegt auch dann vor,
wenn ein Verkaufsagent für einen Verbraucher Waren bei EBay anbietet. Der Verkaufsagent muss
diesen Umstand jedoch in der Auktionsbeschreibung kenntlich machen.
11V) Das Bewertungsforum
Das Bewertungsforum soll den Mitgliedern helfen vertrauenswürdige Verkäufer zu erkennen. Aus
diesem Grund erzielen Verkäufer mit überwiegend positiven Bewertungen (mehr als 98 %)
regelmäßig einen höheren Preis für ihre Angebote als vergleichbare Anbieter mit einem
schlechteren Bewertungsprofil. Es besteht jedoch keine Verpflichtung eine Bewertung abzugeben.
Die Vertragsparteien sollten ihre Bewertungen erst nach dem Abschluss der Transaktion, bei
Schwierigkeiten mit der Vertragsdurchführung erst nach Rücksprache mit der Gegenseite abgeben.
Denn häufig werden unangemessen schlechte Bewertungen viel zu frühzeitig abgegeben und hätten
durch eine bessere Kommunikation der Vertragsparteien vermieden werden können.
Allerdings gibt es auch rechtliche Möglichkeiten objektiv falsche oder der Sachlage nach
ungerechte Bewertungen entfernen zu lassen. Die Rechtsprechung zu diesem Bereich ist nicht
immer einheitlich, aber beim Vorliegen der folgenden Kriterien sollte der Kläger eine gute Chance
haben, die ungerechtfertigt schlechte Bewertung durch ein entsprechendes Urteil löschen zu lassen:
● Wenn beleidigende Äußerungen vorliegen (in diesem Fall löscht eBay diesen Eintrag auch
ohne ein entsprechendes Urteil, wenn der Betroffene dies beantragt).
● In Fällen der ungerechtfertigten Bezichtigung einer strafbaren Handlung.
● Bei Äußerungen, die auf nachweislich unwahren Tatsachen beruhen.
12VI) Die Informationspflichten des gewerblichen Verkäufers
Die Angebotsseiten von gewerblichen eBay-Verkäufern haben bestimmte geschäftsbezogene
Pflichtangaben zu enthalten (z.B. gemäß § 312c BGB in Verbindung mit der BGB-
Informationsverordnung, kurz BGB-InfoVO). Fehlen diese Angaben oder sind sie unvollständig,
setzt sich der Händler der Gefahr einer kostenpflichtigen Abmahnung aus. Gewerbliche eBay-
Angebote sollten deshalb mindestens die folgenden Angaben enthalten:
● Informationen zur Identität des Unternehmens (verwechslungsfreie, ladungsfähige
Anschrift). Dazu zählen neben der Firmenanschrift inkl. Telefonnummer und E-Mail
Adresse auch eventuelle Handelsregistereintragungen, die Benennung des
Geschäftsinhabers, Geschäftsführers oder bei juristischen Personen einer sonstigen
vertretungsberechtigten Person sowie die Umsatzsteuer- bzw. die Umsatzsteuer-
Identnummer. Soweit das Angebot dies erfordert, sind auch berufsrechtliche Angaben zu
machen.
● Eine genaue Beschreibung der angebotenen Ware oder Dienstleistung. Bei gebrauchten
Waren hat der Verkäufer ungefragt alle ihm bekannten Mängel der Kaufsache anzugeben,
andernfalls kann der Käufer den Kaufvertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten (§ 123
BGB). Bei Dauerschuldverhältnissen (z.B. Handyverträgen) ist auch die
Mindestvertragslaufzeit anzugeben.
● Der Preis der Ware sowie eventuelle Nebenkosten (Versand-, Verpackungs- oder sonstige
Kosten) müssen der Auktionsbeschreibung eindeutig zu entnehmen sein. Dabei können
Einzelheiten hinsichtlich der Nebenkosten auf einer anderen Seite als der Angebotsseite
genannte werden, wenn die Angebotsseite einen deutlich sichtbaren und
unmissverständlichen Link auf diese Seite enthält. Aus Gründen der Fairness und der
Streitvermeidung ist es jedoch sinnvoll alle relevanten Daten bereits auf der Angebotsseite
bereit zu stellen.
● Eine vollständige Belehrung über das gesetzliche Widerrufsrecht bzw. ein alternativ zu
gewährendes Rückgaberecht. Hierzu kann das gesetzliche Muster, welches als Anlage
diesem Leitfaden beigefügt ist, verwendet werden. Auch die Widerrufsbelehrung kann auf
einer Drittseite beherbergt werden, wenn die Angebotsseite einen deutlich sichtbaren und
unmissverständlichen Link enthält.
● Gleiches gilt für vom Verkäufer zu verwendende Allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese
müssen zudem noch in einer wiedergabefähigen Form speicherbar sein (§ 312e BGB).
13VII) Abmahnungen
Fehlen die obigen Pflichtangaben, setzt sich der gewerbliche Verkäufer der Gefahr einer
Abmahnung durch Mitbewerber oder Verbraucherschutzverbände wegen eines
wettbewerbswidrigen Verhaltens aus. Diese Abmahnung enthält neben einer strafbewährten
Unterlassungserklärung meist auch eine anwaltliche Gebührenrechnung, deren Kosten der
Abgemahnte, im Falle einer berechtigten Abmahnung, zu tragen hat. Deshalb sollten gewerbliche
Verkäufer, die unsicher sind, ob ihr Internetauftritt den gesetzlichen Anforderungen entspricht oder
ob eine ausgesprochene Abmahnung rechtens ist, anwaltlichen Rat einholen.
Private Verkäufer können zwar nicht wegen einer wettbewerbsrechtlichen Verfehlung (§§ 1 ff. des
Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb, kurz UWG) belangt werden. Jedoch ist die
Abgrenzung zwischen einem privaten und einem gewerblichen Angebot, gerade bei den über die
Internetplattform eBay angebotenen Waren und Dienstleistungen schwierig zu beurteilen. So kann
ein eifriger Hobbyverkäufer, aufgrund einer Vielzahl von ihm angebotenen Waren ungewollt zum
gewerblichen Anbieter werden. Denn nicht der Wille des Verkäufers ist bei der Beantwortung der
Frage, ob es sich um einen gewerblichen oder privaten Anbieter handelt maßgeblich, sondern
dessen Auftreten bei eBay. Es gibt diesbezüglich weder eine abschließende gesetzliche Regelung
noch eine eindeutige Rechtsprechung. Die folgende Rechtsprechungsübersicht kann jedoch einige
nützliche Anhaltspunkte für eine richtige Einschätzung dieser Problematik liefern:
● Bei mehr als 250 Verkäufen in 31 Monaten und einer Registrierung als Powerseller liegt die
Unternehmereigenschaft vor (OLG Koblenz, Az: 5 U 1145/05).
● Wer Bekleidung als Neuware in verschiedenen Größen anbietet ist Unternehmer (LG
Hannover, Az: 18 O 115/05).
● Unternehmereigenschaft ist gegeben, wenn nachhaltig und im größeren Umfang neue und
gebrauchte Waren versteigert werden (LG Schweinfurt, Az: 110 O 32/03).
● Unternehmer ist, wer bei eBay innerhalb von fünf Monaten 39 Verkäufe vorweisen kann
(LG Berlin, Az: 103 U 149/01).
● Eine Tätigkeit als Unternehmer liegt bei 50 Auktionen, eigenen AGB und einem
Powersellerstatus vor (OLG Frankfurt, Az: 6 W 54/04).
● 68 Verkäufe innerhalb von 8 Monaten bewegen sich in einem Grenzbereich, in dem sowohl
ein privater, wie auch ein geschäftlicher Verkehr denkbar ist (OLG Frankfurt, Az: 6 U
149/04).
Aufgrund der vorgenannten Rechtsprechung kann beim Vorliegen der folgenden Merkmale die
Unternehmereigenschaft eines Anbieters bejaht werden:
● Es werden viele gleichartige Waren angeboten.
● Es werden auch Neuwaren angeboten.
● Es werden regelmäßig pro Monat mehr als 8 Waren zum Verkauf angeboten.
● Der Anbieter hat sich als Powerseller registrieren lassen.
● Der Anbieter verwendet eigene AGB.
Häufig verwenden Verkäufer den Markennamen eines namenhaften Herstellers in der Überschrift
oder in der Auktionsbeschreibung oder sie vergleichen ihre Ware mit der eines namenhaften
Herstellers, um so einen größeren Kundenkreis zu erreichen. In diesen Fällen setzen sich sowohl
gewerbliche als auch als auch private Anbieter dem Risiko einer berechtigten, kostenpflichtigen und
strafbewährten Abmahnung aus. Denn in diesen Fällen kann neben einem für gewerbliche Anbieter
relevanten Wettbewerbsverstoß auch ein für private Anbieter maßgeblicher Verstoß gegen das
Markenrecht vorliegen. Deshalb sollten alle Anbieter bei eBay von der Verwendung dieses
14Werbehilfsmittels absehen.
VIII) Zum Autor
Rechtsanwalt Kai Riefenstahl
Heinitzstr. 43
58097 Hagen
Tel.: 02331 / 98 10 812
Fax: 02331 / 98 10 810
www.ra-riefenstahl.de
info@ra-riefenstahl.de
15Sie können auch lesen