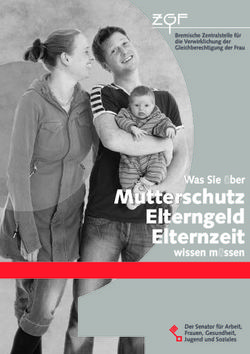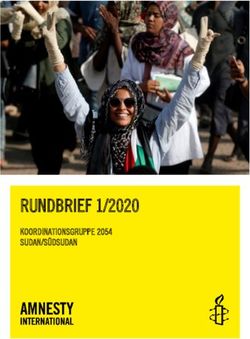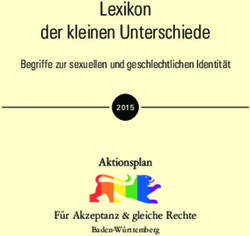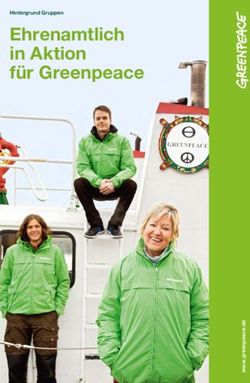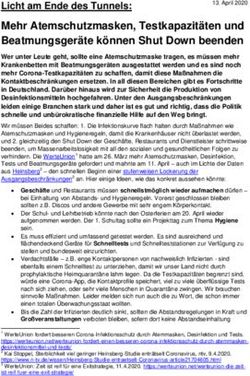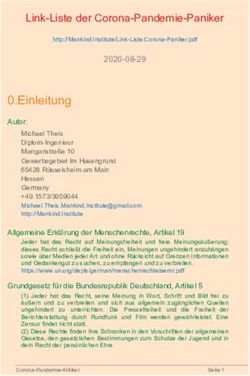Endometriose Universitäts-Endometriosezentrum Franken - Klinisch-wissenschaftliches Endometriosezentrum (Stufe III) - Universitätsklinikum ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Endometriose Universitäts-Endometriosezentrum Franken Klinisch-wissenschaftliches Endometriosezentrum (Stufe III)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort 4
Hintergrund
Begriffserklärung Endometriose 5–6
Risikofaktoren Endometriose 6–7
Häufigkeit des Auftretens einer Endometriose 7
Symptome 8–9
Was könnte außer Endometriose Ursache
meiner Beschwerden sein? 10 – 11
Untersuchungen
Anamnese 12
Vaginal-rektale Untersuchung 12
Sonografie 12
Zusatzuntersuchungen 13
Therapie
Medikamentöse Therapie 14
Monophasische Kombinationspräparate
(oral, vaginal, transdermal) 14 – 15
Gestagenpräparate 16 – 17
GnRH-Agonisten 17 – 18
Operative Therapie 18 – 19
Nachbehandlung und Rezidivprophylaxe 19 – 20
Endometriose und Kinderwunsch 20 – 21
Weitere Therapieansätze
Schmerztherapie 21 – 22
Ernährung 22 – 23
Sport 23
Ergänzende Therapieansätze 24
Rehabilitationsmaßnahmen 24 – 25
Interdisziplinäres Vorgehen
bei der Erkrankung Endometriose 25
Studien des Universitäts-
Endometriosezentrums Franken 26
Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V 27 – 29
Europäische Endometriose Liga 29 – 30
Stiftung Endometriose-Forschung 30
Für Ihre Fragen 31
Kontaktdaten 31
Schematische Darstellung des Unterleibs I 32
Schematische Darstellung des Unterleibs II 33
Anreise 34
3Vorwort
Trotz sehr hoher Betroffenenzahlen und etwa
30.000 Neuerkrankungen jährlich wird die Endo-
metriose in der Öffentlichkeit und auch von Fach-
leuten immer noch zu wenig beachtet. Akute und
chronische Schmerzen, Sterilität sowie psychi-
sche Begleiterscheinungen sind nur einige Symp-
tome, unter denen die Betroffenen leiden. Pati-
entinnen fühlen sich nicht selten mit der Diagnose
Endometriose, mit ihren Ängsten und Sorgen,
vor allem aber mit ihren Fragen alleingelassen.
Fundierte Informationen sind schwierig zu bekom-
men. Was gibt es wirklich an Therapieoptionen?
Was ist sinnvoll und was nicht? Gibt es alternative
Behandlungsansätze? Was gibt es für Beratungs-
angebote? Wo wird mir geholfen? An wen kann
ich mich mit meinen Fragen wenden?
Das Universitäts-Endometriosezentrum Franken
ist ein zertifizierter Ansprechpartner. Als Endo-
metriosezentrum der höchsten Ordnung (Stufe III)
können wir Ihnen ein umfassendes Beratungs-,
Behandlungs- und Nachbetreuungskonzept
anbieten. Mit dieser Broschüre möchten wir Sie
über die Erkrankung Endometriose, die Behand-
lungsmöglichkeiten und über weitere sinnvolle
Zusatzangebote informieren.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Broschüre ein
umfassendes Informationsmaterial zum Thema
Endometriose zur Verfügung stellen zu können.
Wir begrüßen Sie herzlich in unserem Zentrum!
Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann
Direktor der Frauenklinik
Dr. med. Stefanie Burghaus
Dr. med. Thomas Hildebrandt
Sprecher des Endometriosezentrums
4Hintergrund
Begriffserklärung Endometriose
Endometriose ist definiert als das Auftreten von
„Gebärmutterschleimhaut“ außerhalb der eigent-
lichen Gebärmutterhöhle. Zellen der Gebärmutter-
schleimhaut werden nicht nur mit der monatlichen
Periode nach außen transportiert, sondern gelangen
auch auf andere Weise an Stellen außerhalb der
Gebärmutter. Hier können sie anwachsen und sich
vermehren. Diese verschleppten Zellen von Gebär-
mutterschleimhaut kann man im Bauchraum, vor-
wiegend im kleinen Becken, finden. Aber auch
andere Lokalisationen wie Scheide, Gebärmutter-
muskel (Adenomyose), Eierstock, Darm oder Blase
sind möglich. Die Zellen wachsen als „fleckige“
Herde oder aber als knotige Strukturen. Nicht alle
Frauen mit Endometrioseherden haben Beschwer-
den. Patientinnen mit verschleppter Gebärmutter-
schleimhaut im Körper können auch ohne Be-
schwerden sein und die Erkrankung zeitlebens
nicht bemerken. Die Ausprägung korreliert nicht
mit den Beschwerden. Typisch sind Schmerzen vor
und während der Monatsblutung, Unterbauch-
Niere
Harnleiter
Wirbelsäule
Eierstock
Eileiter
Gebärmutter
Harnblase
Muttermund
Schambein
Enddarm
Klitoris
Scheide
Harnröhre
Anus
Kleine Schamlippen
Große Schamlippen
Abbildung 1: Mögliche Lokalisationen der Endometriose (●)
(siehe auch Seite 32)
5schmerzen, Probleme beim Stuhlgang, der Blasen-
entleerung und beim Geschlechtsverkehr und
ein unerfüllter Kinderwunsch (siehe Symptome).
Noch immer liegt der Grund für die Entstehung
einer Endometriose weitgehend im Unklaren.
Seit hundert Jahren gibt es Erklärungsmodelle
für die Entstehung einer Endometriose. Die drei
wichtigsten sind:
Transplantationstheorie (Sampson JA 1921)
sieht die rückwärtsgerichtete Menstruation über
die Eileiter in den Bauchraum verantwortlich für
die Entstehung von Endometriose im kleinen
Becken.
Metaplasie-Theorie (Meyer R 1919) geht davon
aus, dass Endometriosezellen aus Stammzellen
im Bauchfell entstehen. Dafür bedarf es be-
stimmter Reize, z. B. durch Östrogene (weibliche
Hormone).
Archimetrakonzept (Leyendecker G et al. 1998):
Endometriose entwickelt sich aus gelockerten
Anteilen der untersten Schicht der Gebärmutter.
Neuere Erklärungsmodelle diskutieren gene-
tische, immunologische und hormonelle Faktoren
für die Entstehung einer Endometrioseerkrankung.
Letztlich ist die Entstehung aktuell unklar, von
einem vielschichtigen Entstehungsmodell mit
genetischer Komponente ist auszugehen.
Risikofaktoren Endometriose
Viele Erkenntnisse zur Vorbeugung der Endome-
triose liegen nicht vor. Jedoch konnten in den ver-
gangenen Jahren einige Risikofaktoren für die
Entstehung einer Endometriose erkannt werden:
Frauen mit mehreren Kindern, lange Stillzeiten
und eine späte erste Regel nach dem 14. Lebens-
jahr verringern die Wahrscheinlichkeit, an einer
Endometriose zu erkranken. Kinderlose Frauen,
Frauen mit einer frühen ersten Regel und Frauen
mit gehäuften Zyklusblutungen und/oder Zusatz-
6blutungen haben ein erhöhtes Risiko, an einer
Endometriose zu erkranken. Endometriosepati-
entinnen sind häufig schlanker und haben einen
niedrigeren Body-Mass-Index als die durchschnitt-
liche Frau. Ob Ernährung einen Einfluss auf die
Entstehung einer Endometriose hat, ist nicht ein-
deutig zu klären. In einer Studie konnte gezeigt
werden, dass der vermehrte Konsum von grünem
Gemüse und frischen Früchten das Risiko senkt,
an Endometriose zu erkranken. Umgekehrt steigt
das Erkrankungsrisiko bei vermehrtem Konsum
von rotem Fleisch. Kein Zusammenhang konnte
zwischen der Erkrankung Endometriose und dem
Genuss von Milch, Käse, Fisch, Alkohol oder Kaffee
gesehen werden. Der Verzicht auf bzw. der über-
mäßige Konsum von gewisse/-n Lebensmittel/-n
ist so schwer zu untersuchen, dass letztlich drin-
gend weitere Studien zum Zusammenhang zwi-
schen der Ernährung und dem Auftreten der Er-
krankung Endometriose notwendig sind. Aktuell
scheint die Ernährung eher einen geringen Anteil
an der Entstehung einer Endometriose zu besitzen.
Häufigkeit des Auftretens
einer Endometriose
Endometriose ist die häufigste gutartige Erkran-
kung von Frauen im gebärfähigen Alter. 4 – 30 %
aller Frauen im reproduktionsfähigen Alter sind
betroffen. Schätzungen gehen davon aus, dass
der Anteil bei Frauen mit Problemen schwanger zu
werden mit bis zu 50 % nochmals deutlich höher
liegt. Das vermehrte Auftreten unter Erstlinien-
verwandten lässt auf eine erbliche Komponente
schließen. In Deutschland ist jedes Jahr von ca.
30.000 Neuerkrankungen auszugehen. Umso
erschreckender ist, dass trotz dieser enormen Er-
krankungszahl vom Auftreten erster Symptome bis
zur Diagnosestellung „Endometriose“ häufig bis
zu sieben Jahre vergehen. Unzählige Arztbesuche,
nicht zum Ziel führende und letztlich auch un-
nütze Untersuchungen und ein langer Leidens-
weg der Betroffenen sind die Folge.
7Symptome
Die Symptome der Endometriose sind vielfältig
und hängen nicht unbedingt mit dem Schwere-
grad der Erkrankung zusammen. Vielmehr
scheinen der Ort der Endometrioseherde und
weitere, nicht im Detail geklärte Mechanismen
die unterschiedlichen Beschwerdebilder zu
erklären. Neben Krankheitsverläufen ohne Be-
schwerden (die Endometriose wird nur zufällig
im Rahmen einer Bauchspiegelung gefunden)
kann die Endometriose mit unterschiedlicher,
teils ausgeprägter Schmerzsymptomatik einher-
gehen. Typisch, jedoch nicht zwingend, ist ein
Schmerz im Unterbauch vor Beginn der Periode,
der etwa zwei Tage vor der Regelblutung im
Bereich des Unterbauchs einsetzt und häufig
während der Regelblutung rückläufig ist. Insbe-
sondere bei ausgedehnter Endometriose kann
das Schmerz- und Beschwerdebild menstrua-
tionsunabhängig in unterschiedlicher Ausprägung
auftreten. Je nach Lokalisation der Endometriose
können Symptome wie Schmerzen beim Ge-
schlechtsverkehr, Schmerzen beim Wasser-
lassen oder Schmerzen beim Stuhlgang vorliegen.
Sind Darm und Blase betroffen, kann es insbe-
sondere vor Beginn der Regelblutung zu blutigem
Urin und Stuhlgang, zu Druckgefühl, Blähungen,
Unterbauchkrämpfen, Durchfall und/oder Ver-
stopfung kommen. Neben der Schmerzsympto-
matik stehen mögliche Schwierigkeiten, schwan-
ger zu werden bei Frauen mit Endometriose im
Vordergrund. Bei 30 – 50 % der Frauen mit
Sterilitätsproblemen konnte eine Endometriose
nachgewiesen werden. Als Ursache hierfür
kommen Verklebungen (Adhäsionen) im Unter-
bauch mit Verschluss der Eileiter bzw. Störungen
in der Eileiterbeweglichkeit in Betracht. An der
eventuell bestehenden Schwierigkeit, schwanger
zu werden, scheinen jedoch weitere Faktoren
beteiligt zu sein, da auch Frauen mit unauffälliger
Eileiterfunktion betroffen sind sowie Schwanger-
schaftsraten bei künstlicher Befruchtung
schlechter sind. Im Rahmen von aktuellen wis-
senschaftlichen Untersuchungen werden hier
derzeit u. a. Autoimmunmechanismen, vermin-
8derte Qualität der Eizellen, genetische Verände-
rungen sowie veränderte Gebärmutterschleim-
haut mit Hemmung einer normalen Eizelleinnis-
tung diskutiert. Das Krankheitsbild der Endome-
triose kann zu einer deutlichen Lebensqualitäts-
einschränkung aufgrund chronischer Schmerzen,
unerfülltem Kinderwunsch und daraus resul-
tierenden mehrfachen Operationen und medi-
kamentösen Behandlungen führen.
erhöhte Temperatur
häufige Infektionen
Sterilität
Magenbeschwerden
Kopfschmerz/Schwindel
Dyspareunie
Menometrorrhagien
Darmsymptome
Übelkeit
Unterbauchschmerzen
Dysmenorrhoe
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 %
Häufigkeit der jeweiligen Beschwerden in Prozent
Abbildung 2: Typische Endometriosesymptome bei
Endometriosepatientinnen unserer Klinik
9Was könnte außer Endo-
metriose Ursache meiner
Beschwerden sein?
Neben der Erkrankung Endometriose kommen
für das Hauptzeichen „Unterbauchschmerzen
bei Frauen“ eine Vielzahl von Erkrankungen in-
frage. Sollte eine Endometriose bei Ihnen durch
uns ausgeschlossen worden sein, gilt es, die
Ursache Ihrer Beschwerden zu erforschen. Hier
gibt es jedoch eine Vielzahl von Erkrankungen,
die für Ihre Beschwerden ursächlich sein können.
Diese können zurückgeführt werden auf den
Darm, die Blase, die Gebärmutter, auf Stoffwech-
selerkrankungen, die Nieren, die Leber und vieles
mehr. Umso wichtiger ist es, dass Sie uns alle
Ihre Beschwerden und Symptome schildern. Nur
so können wir der Ursache Ihres Leidens wirklich
auf die Spur kommen. Exemplarisch ein Auszug
der möglichen Ursachen bei chronischen/akuten
Unterbauchschmerzen:
1. Darmerkrankungen
Gastrointestinale Infekte
(Magen-Darm-Infekt)
Blinddarmentzündung
Divertikulose/Divertikulitis (Darmausstülpungen
mit eventueller Entzündung)
maligne (bösartige) Erkrankungen
Morbus Crohn (entzündliche Darmerkrankung)
Colitis ulcerosa (entzündliche Darmerkrankung)
Lebensmittelvergiftung
Lebensmittelunverträglichkeit
Stoffwechselerkrankung
Parasitenbefall
102. Gynäkologische Erkrankungen
Eileiterentzündungen
Geschlechtskrankheiten
Zysten und Tumoren der Eierstöcke
Myom (gutartiger Muskelknoten)
in der Gebärmutter
Eileiterschwangerschaft
Gebärmuttermuskel- und/oder -schleimhaut-
entzündung
prämenstruelles Syndrom
Tumoren von Scheide und Gebärmutter
3. Urologische Erkrankungen
Blasenentzündungen
Nierenbeckenentzündungen
Harnleiter- und Blasensteine
bösartige Erkrankungen der Harnwege
4. Sonstige Ursachen
Leistenbrüche
Darmverschluss
Perforation eines Hohlorgans
(z. B. Darm, Blase usw.)
Wirbelsäulenveränderungen
Sollte eine Endometriose oder ein gynäkolo-
gisches Leiden ausgeschlossen werden, so
werden Sie zur weiteren Abklärung zu anderen
Spezialisten innerhalb unseres Endometriose-
zentrums überwiesen.
11Untersuchungen
Anamnese
Die Anamnese (Erhebung der Krankheitsgeschich-
te) ist für uns wegweisend zur Diagnose. Nur durch
eine gezielte Befragung nach Ihrer Kranken- und
Familiengeschichte und Ihren jetzigen Beschwer-
den können wir die Ursache Ihrer Beschwerden
diagnostizieren. Dafür kann es auch erforderlich
sein, dass wir Ihnen für Sie eventuell unange-
nehme Fragen zu Stuhlgang, Wasserlassen und
Sexualität stellen. Ihre Antworten sind für uns
von zentraler Bedeutung, um der Ursache Ihres
Leidens auf den Grund zu gehen.
Vaginal-rektale Untersuchung
Hierbei werden zuerst mit einem zweigeteilten
Instrument (Spekulum) die Scheidenwände und
der Muttermund betrachtet. Nur so können Auf-
fälligkeiten, z. B. Endometrioseherde, in der Schei-
de erkannt werden. Es folgt die Untersuchung
über die Scheide und über den Enddarm (vaginal-
rektale Untersuchung). Auch hier gilt: Diese Unter-
suchung ist für Sie eventuell unangenehm und bei
Vorliegen einer Endometriose auch schmerzhaft.
Besonders aber durch die Tastuntersuchung des
Enddarms kann der Arzt die Endometrioseherde
an den Haltebändern der Gebärmuttertasten.
Sonografie
Es erfolgt eine Ultraschalluntersuchung der Ge-
bärmutter und der Eierstöcke durch die Scheide
und bei Bedarf eine Ultraschalluntersuchung bei-
der Nieren über den Bauch/die Flanke. Hier
können folgende Fragen geklärt werden:
Wie ist die Lage der Gebärmutter?
Gibt es Hinweise auf eine Entzündung?
Gibt es Auffälligkeiten an der Gebärmutter?
Gibt es Auffälligkeiten an den Eierstöcken?
Sind die Nieren gestaut, z. B. aufgrund
einer ausgeprägten Endometriose?
12Zusatzuntersuchungen
In seltenen Fällen sind weitere Zusatzuntersu-
chungen notwendig. Dies können z. B. eine Darm-
spiegelung, Blasenspiegelung oder Magnet-
resonanztomografie sein. Sollte sich in der
gynäkologischen Untersuchung der Verdacht
auf eine Endometrioseerkrankung nicht be-
stätigen, so können Zusatzuntersuchungen
notwendig sein, um der Ursache Ihrer Be-
schwerden auf den Grund zu gehen.
Niere
Harnleiter
Wirbelsäule
Eierstock
Eileiter
Gebärmutter
Harnblase
Muttermund
Schambein
Enddarm
Scheide Klitoris
Harnröhre
Anus
Kleine Große
Schamlippen Schamlippen
Abbildung 3: Querschnittsbild des Unterbauchs einer Frau/
Endometrioseherde (●) in verschiedenen Körperregionen mit
angedeuteter Schmerzausstrahlung (Kreise)
13Therapie
Medikamentöse Therapie
Eine medikamentöse Therapie der Endometriose
ohne vorherige operative Abklärung und histolo-
gische Sicherung sollte nur dann erfolgen, wenn
die Beschwerden mittels Hormontherapie
ohne Lebensqualitätseinschränkung thera-
pierbar sind,
die Diagnose bereits bei einer vorherigen
Operation gesichert wurde und die Patientin
einen weiteren operativen Eingriff ablehnt
oder eine erneute Operation nicht sinnvoll
erscheint,
schwere Begleiterkrankungen der Patientin
vorliegen, die mit einem hohen Operations-
risiko für die Patientin einhergehen,
die Patientin dies im Rahmen eines individu-
ellen Heilversuchs explizit wünscht.
Als Therapieoptionen stehen verschiedene Medi-
kamente zur Auswahl.
Monophasische Kombinationspräparate
(oral, vaginal, transdermal)
Durch orale Kontrazeptiva („Pille“) können Endo-
metriosebeschwerden deutlich gebessert wer-
den. Die Endometrioseherde verkleinern sich
dabei auch. Orale Kontrazeptiva lindern milde
Endometriosebeschwerden meist deutlich. Wenn
keine Kontraindikationen vorliegen, kann die
„Pille“ sowohl bei Verdacht auf Endometriose als
auch bei gesicherter Endometriose zur Rezidiv-
prophylaxe verwendet werden. Patientinnen
ohne Kinderwunsch profitieren vom positiven
Nebeneffekt der hohen kontrazeptiven Sicher-
heit. Die durchgehende Einnahme ohne soge-
nannte Pillenpause ist dabei sinnvoll. Es werden
drei Zyklen (Langzyklus) aneinandergefügt oder
die „Pille“ wird durchgehend eingenommen
(Langzeiteinnahme). Nach heutigem Kenntnis-
stand ist die Einnahme der „Pille“ sowohl im
14Langzyklus wie auch der Langzeiteinnahme
nicht mit einem erhöhten Risiko verbunden und
bei Endometriose die Therapie der Wahl. Aller-
dings handelt es sich um einen sogenannten
„off-label-use“, das heißt, die „Pille“ ist nicht
zur Behandlung der Endometriose zugelassen,
sondern lediglich zur hormonellen Verhütung.
Aktuell übernehmen die Krankenkassen deshalb
leider nur in sehr seltenen Fällen die Kosten der
„Pille“ bei Endometriose.
Die bekannten Risiken der hormonellen Verhü-
tung sind zu beachten: Das Thromboserisiko
unter Einnahme einer Kontrazeption ist zwei- bis
sechsfach erhöht; andere zusätzliche Risiko-
faktoren müssen unbedingt ausgeschlossen
werden. Bei thrombembolischen Ereignissen ist
die hormonelle Therapie unverzüglich zu beenden.
Bei jungen Patientinnen mit nicht abgeschlos-
sener Familienplanung kann eine Therapie fort-
geführt werden, solange keine Schwangerschaft
angestrebt ist. Vor geplanter Schwangerschaft
ist die Therapie abzusetzen. Bei Patientinnen
mit abgeschlossener Familienplanung ist eine
Therapie zur Rezidivprophylaxe bis zur Meno-
pause zu diskutieren. Die nicht orale kombinierte
Gabe (transdermal, vaginal per Kunststoffring)
einer Östrogen-/Progesteron-Kombination scheint
ebenfalls wirkungsvoll zu sein.
Eine Auswahl der Markennamen von oralen
Kombinationspräparaten (monophasisch):
Belara®, Maxim®, Microgynon®, MonoStep®,
Valette®, YAZ®, Yasmin®
Eine Auswahl der Markennamen für nicht
orale Kombinationspräparate:
NuvaRing® (Vaginalring), Circlet® (Vaginalring),
Evra® (Hormonpflaster)
Für viele dieser Präparate gibt es bereits Generika.
Das sind gleichwertige, inhaltlich identische, aber
kostengünstigere Präparate.
15Gestagenpräparate
Reine Gestagene (Gelbkörperhormone) sind zur
Behandlung der Endometriose ebenfalls sehr
effektiv. Sie kommen in verschiedenen Zube-
reitungsformen (oral, intramuskulär, subkutan,
intravaginal oder intrauterin) zur Anwendung.
Es existieren verschiedene Wirkstoffe.
Bei der Minipille handelt es sich um ein Gestagen-
präparat, das täglich eingenommen wird. Dieses
Verhütungsmittel ist von der Verhütungssicher-
heit minimal unzuverlässiger als die klassische
„Pille“. Allerdings ist die Minipille ebenfalls nicht
zur Behandlung der Endometriose zugelassen, es
handelt sich um einen „off-label-use“, der nicht
von den Krankenkassen übernommen wird.
In Deutschland ist seit Mai 2010 das erste für
Endometriose zugelassene Gestagenpräparat
(Visanne®) auf dem Markt. Es enthält 2 mg Dieno-
gest und wird täglich eingenommen. Bei Endome-
triose zeigt dieses Medikament eine gute Wirkung
hinsichtlich der Reduktion der Endometriosebe-
schwerden. Allerdings hat Dienogest 2 mg nicht
die Zulassung als Kontrazeptivum, obwohl eine
Studie mit kleiner Patientinnenzahl die Verhinde-
rung des Eisprungs durch das Medikament zeigen
konnte. Es muss, sofern ein Verhütungsschutz
gewünscht wird, zusätzlich noch mit einem nicht
hormonellen Verhütungsmittel gearbeitet werden.
Dieses und die Neigung zu Zwischen- und Schmier-
blutungen, die unter allen Gestagenen gehäuft
auftreten, sind zu beachten.
Als weitere Gestagenpräparate stehen u. a.
Desogestrel und Levonorgestrel zur Verfügung.
Eine Auswahl der Markennamen von oralen
Gestagenpräparate:
Cerazette®, 28 mini®, Jubrele®
Lokal angewandte Gestagene, z. B. eine
Levonorgestrel-freisetzende „Spirale“ (Mirena®),
zeigen aufgrund deutlich geringerer systemischer
16Gestagenkonzentrationen weniger Nebenwirkun-
gen. Die lokale Gestagenwirkung scheint insbe-
sondere auf unmittelbar benachbarte Endometrio-
seläsionen, wie die Adenomyose sowie die Endo-
metriose im Bereich der Bänder der Gebärmutter,
ausgesprochen effektiv zu sein.
Allerdings ist die Mirena® ebenfalls nicht zur Be-
handlung der Endometriose zugelassen, es
handelt sich um einen „off-label-use“, der nicht
von den Krankenkassen übernommen wird.
Aufgrund des Nebenwirkungsprofils eignen sich
Gestagenpräparate insbesondere für Patientinnen
mit erhöhtem Körpergewicht, Raucherinnen oder
Frauen mit einem sonstigen kardiovaskulärem
Risiko.
Eine Auswahl der Markennamen für
ausschließliche Gestagenpräparate:
Cerazette® (klassische Gestagenpille), Visanne®
(für Endometriose zugelassenes Präparat), Mirena®
(Hormonspirale), Implanon® (Hormonstäbchen)
Für einige dieser Präparate gibt es bereits
Generika. Das sind gleichwertige, inhaltlich
identische, aber kostengünstigere Präparate.
GnRH-Agonisten
GnRH-Analoga blockieren die zentrale Hormon-
steuerung. Durch die Gabe dieser Medikamente
wird die Patientin für eine gewisse Zeit in eine
Art „künstliche Wechseljahre“ versetzt. GnRH-
Analoga gehören zu den wirksamsten Substan-
zen zur Reduktion der endometriosebedingten
Beschwerden. Eingesetzt werden z. B.:
Leuprorelinacetat (z. B. EnantoneGyn®)
Goserelinacetat (z. B. Zoladex®)
Die Nebenwirkungen entsprechen mit Hitzewal-
lungen, Stimmungsschwankungen, Kopfschmer-
zen und einem Knochenmineralverlust den Be-
17schwerden von Frauen in den Wechseljahren und
führen teils zu einer massiven Beeinträchtigung
der Lebensqualität. Diese Beschwerden lassen
sich jedoch bei gleicher Effektivität in Bezug auf
die Endometriose durch eine sogenannte „Add-
back“-Therapie deutlich reduzieren. Hierbei neh-
men die Patientinnen zusätzlich zu den verab-
reichten GnRH-Analoga Hormone, z. B. ein mono-
phasisches Kontrazeptivum („Pille“), ein. Dadurch
lassen sich die teils gravierenden Nebenwir-
kungen auf ein Minimum reduzieren. Die Thera-
piedauer mittels GnRH-Analoga beträgt zumeist
sechs Monate. Die Medikamente werden aktuell
in der Endometriosetherapie sehr selten einge-
setzt und kommen nur gelegentlich bei sehr
ausgeprägten Beschwerden, zur Nachbehand-
lung nach einer „großen Endometrioseoperation“
und als Vorbehandlung vor einer geplanten
„künstlichen Befruchtung“ zum Einsatz.
Operative Therapie
Eventuell ist bei Ihnen eine Operation aufgrund
Ihrer Endometrioseerkrankung oder aber zur
Abklärung Ihrer Beschwerden notwendig.
Die schonendste Art der Operation beim Vorliegen
einer Endometriose ist die Bauchspiegelung.
Sie reduziert die Schmerzen und die Einschrän-
kungen der Patientin nach der Operation auf ein
Minimum. Hierdurch können der Krankenhaus-
aufenthalt und die Dauer bis zur vollständigen
Genesung verkürzt werden. Wann immer möglich,
sollte eine Endometriose mittels Bauchspiegelung
operiert werden.
Die Bauchspiegelung dient neben der Diagnose-
sicherung auch einer Schmerzreduktion durch
Entfernung oder Zerstörung von Endometriose-
herden sowie der Entfernung von Verwachsungen.
Bei Patientinnen mit unerfülltem Kinderwunsch
wird hierdurch auch eine erhöhte Rate an Schwan-
gerschaften erzielt. Eine Bauchspiegelung sollte
18zur Abklärung einer Endometriose bei folgenden
Indikationen durchgeführt werden:
unerfüllter Kinderwunsch
Schmerzen
Organveränderungen
Versagen der medikamentösen Therapie
Organveränderungen, die eine Operation nötig
machen können, sind große Endometriosezysten
(sogenannte Schokoladenzysten oder Endome-
triome) an den Eierstöcken, Endometriose in den
ableitenden Harnwegen, der Blase, der Scheide
und dem Darm. Die letzten vier genannten Loka-
lisationen werden auch als tief infiltrierende
Endometriose bezeichnet.
Bei einer Endometrioseoperation wird versucht,
alle sichtbaren Endometrioseherde zu entfernen.
Ja nach Lokalisation der Endometrioseherde kann
dies unter Umständen auch zu umfangreicheren
Operationen führen. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn aufgrund einer Blasen- oder Darmbeteiligung
die Operation auf diese Organe ausgeweitet wer-
den muss. Hier kann es nötig sein, einen kleinen
Teil des Darms oder der Blase mit zu entfernen.
Sollte bei Ihnen eine operative Entfernung der
Endometriose nötig sein, so erfolgt im Vorfeld ein
ausführliches Aufklärungsgespräch. Hier werden
Ihnen alle Risiken der geplanten Operation aus-
führlich erklärt und es besteht für Sie die Möglich-
keit, all Ihre Fragen zu stellen und Ihre Sorgen,
Ängste und Probleme anzusprechen.
Nachbehandlung und Rezidivprophylaxe
Nach einer eventuell erfolgten Operation erhalten
Sie im Anschluss selbstverständlich Gelegenheit,
mit dem Operateur über den Verlauf der Opera-
tion und die eventuell folgende Behandlung zu
sprechen. Hier erfahren Sie, wie die notwendigen
weiteren Behandlungsschritte und die Nach-
untersuchungen aussehen werden. 14 Tage nach
19Entlassung sollten Sie Ihre/-n niedergelassene/-n
Gynäkologin/-en zur ersten Nachuntersuchung
aufsuchen. Zu diesem Zeitpunkt liegen Ihrer/-m
Ärztin/Arzt bereits alle notwendigen Befunde von
Ihrem Aufenthalt bei uns vor. Sie/Er wird dann
mit Ihnen die weiteren Schritte besprechen.
Eine postoperative medikamentöse Behandlung
kann in folgenden Fällen erfolgen:
als Rezidivprophylaxe (Verhinderung des
Wiederauftretens)
zur Vorbehandlung vor sanierender Operation
als Möglichkeit, bei nicht komplett zu entfer-
nender Endometriose
Fast allen operierten Patientinnen bieten wir eine
Rezidivprophylaxe (Medikament, um das Wieder-
auftreten einer Endometriose zu verhindern) an.
Ausgenommen hiervon sind Patientinnen mit mil-
der, komplett entfernter Endometriose und aktu-
ellem Kinderwunsch sowie Patientinnen, bei
denen Kontraindikationen (Gegenanzeigen) gegen
die Einnahme von Hormonen bestehen. Es stehen
verschiedene Hormontherapieoptionen (siehe
„Medikamentöse Therapie“, S. 14) zur Wahl.
Endometriose und Kinderwunsch
Neben der Schmerzsymptomatik stehen mögliche
Schwierigkeiten, schwanger zu werden, bei Frauen
mit Endometriose im Vordergrund. Bei 30 – 50 %
der Frauen mit Sterilitätsproblemen konnte eine
Endometriose nachgewiesen werden. Als Ursache
hierfür kommen Verklebungen im Unterbauch mit
Verschluss der Eileiter bzw. Störungen in der Tu-
benbeweglichkeit in Betracht. Weitere Faktoren
scheinen jedoch an der Sterilitätsproblematik von
Endometriosepatientinnen beteiligt zu sein, da
auch Frauen mit unauffälliger Tubenfunktion be-
troffen sind und weil die Schwangerschaftsraten
bei künstlicher Befruchtung schlechter sind. Im
Rahmen von aktuellen wissenschaftlichen Unter-
suchungen werden hier derzeit u. a. Autoimmun-
20mechanismen, eine verminderte Qualität der Ei-
zellen, genetische Veränderungen sowie eine
veränderte Gebärmutterschleimhaut mit Hem-
mung einer normalen Eizelleinnistung diskutiert.
Ein Kinderwunsch ist etwas Intimes und Persön-
liches. Wenn er nicht in Erfüllung geht, bestehen
viele Fragen und Zweifel oder es können sich
sogar Ängste entwickeln. Deshalb steht die Be-
handlung von Paaren mit unerfülltem Kinder-
wunsch im Mittelpunkt der Arbeit des Schwer-
punkts Gynäkologische Endokrinologie und
Reproduktionsmedizin (Frauenklinik) in Zusam-
menarbeit mit dem Universitäts-Fortpflanzungs-
zentrum Franken (UFF). Bei Bedarf überweisen
wir sie gerne an unser Fortpflanzungszentrum.
Weitere Therapieansätze
Schmerztherapie
Die am häufigsten verwendeten Schmerzmittel
bei Endometriose sind nicht steroidale Antiphlo-
gistika (NSAR) wie Ibuprofen® oder Voltaren®. Ob-
wohl die Therapie milder Unterbauchschmerzen
mit nicht steroidalen Antiphlogistika zum Stan-
dard in der frauenärztlichen Praxis zählt, fehlt
der wissenschaftliche Nachweis auf Effektivität
bei vorhandener Endometriose. Aufgrund des
Nebenwirkungsprofils, der geringen Kosten sowie
dem Wunsch der Patientin und des Behandelnden,
die Schmerzen zu reduzieren, nimmt ein hoher
Anteil der Endometriosepatientinnen NSAR ein.
Eine medikamentöse Schmerztherapie kann un-
mittelbar vor oder nach der Operation, bei ausge-
prägter Endometriose auch dauerhaft notwendig
sein. Gerne beraten wir Sie über Anwendung, Risi-
ken und Nebenwirkungen der einzelnen Schmerz-
medikamente. Bei chronischen und/oder sehr
starken Schmerzen empfiehlt sich die Vorstellung
21im Schmerzzentrum des Uni-Klinikums Erlangen.
Wie in vielen Anästhesieeinrichtungen fast flächen-
deckend angeboten, finden Sie auch in unserem
Zentrum ein hoch spezialisiertes Team in der
Schmerzambulanz. Zur Überbrückung bis zur
Operation, aber auch bei chronischen, anders
nicht beherrschbaren Endometrioseschmerzen
ist eine Überweisung zum Schmerztherapeuten
sinnvoll. Das Universitäts-Endometriosezentrum
Franken arbeitet eng mit dem hervorragenden
Schmerzzentrum und seiner angeschlossenen
Tagesklinik zusammen. Bei Bedarf werden wir
Sie hierhin überweisen.
In der Schmerzambulanz werden Patienten mit
chronischen Schmerzen von Ärzten mit der Zu-
satzbezeichnung „Spezielle Schmerztherapie“
behandelt. Neben der medikamentösen Schmerz-
therapie werden Nervenblockaden, aber auch
nicht medikamentöse Therapieverfahren – wie
Akupunktur, TENS, Laser-Therapie und Biofeed-
back – durchgeführt. Bei stark chronifizierten Pati-
enten bzw. bei Patienten mit psychologischen
Belastungsfaktoren erfolgt eine enge Zusammen-
arbeit mit den Ärzten der Schmerztagesklinik.
Kontakt
Universitätsklinikum Erlangen
Schmerzzentrum
Krankenhausstr. 12, 91054 Erlangen
Tel.: 09131 85-32558
schmerzzentrum@uk-erlangen.de
www.schmerzzentrum.uk-erlangen.de
Ernährung
Ob Ernährung einen Einfluss auf die Entstehung
einer Endometriose hat, ist nicht eindeutig zu
klären. Einige Wissenschaftler haben sich mit
dem Einfluss bestimmter Lebensmittel auf die
Entwicklung der Endometriose beschäftigt.
Vermehrter Konsum von grünem Gemüse und fri-
schen Früchten senkt das Risiko, an Endometriose
zu erkranken. Umgekehrt steigt das Erkrankungs-
risiko bei vermehrtem Konsum von rotem Fleisch.
22Kein Zusammenhang konnte zwischen der Erkran-
kung Endometriose und dem Genuss von Milch,
Käse, Fisch, Alkohol oder Kaffee gesehen werden.
Die Autoren stellten fest, der Verzicht auf bzw. der
übermäßige Konsum von gewisse/-n Lebensmit-
tel/-n sei so schwer zu untersuchen, dass letztlich
dringend weitere Studien zum Zusammenhang
zwischen der Ernährung und dem Auftreten der Er-
krankung Endometriose notwendig sind. Insgesamt
raten wir Ihnen zu einer ausgewogenen Ernährung.
Folgende Übersicht soll Ihnen dabei helfen:
Greifen Sie zu
frisches Gemüse (Brokkoli, Spinat, Kartoffeln, Kohl, Tomaten)
frische Früchte (Beeren, Orangen, Grapefruit, Bananen)
weißes Fleisch (Hühnerfleisch, Putenfleisch, Fisch, Schalentiere)
Sojaprodukte (Sojamehl, Sojasprossen, Sojabohnen, Tofu)
Vollkornprodukte
Samen- und Körnerprodukte (Sesam, Leinsamen, Sonnen-
blumen, Kürbis, Nüsse)
magnesiumhaltige Nahrungsmittel (Reis, Mais, Haferflocken,
Weizenkeime)
kalt gepresste Öle (vor allem „extra vergine“)
Meiden Sie
zuckerhaltige Getränke (Energydrinks, Limonaden, Cola, Bier,
Weißwein)
rotes Fleisch (Rind, Schwein, Schaf, Wild)
bestimmte Milchprodukte wie Hartkäse
Salz
Süßigkeiten/Süßspeisen (Schokolade, Kakao, Zucker allgemein)
tierische Fette (Butter, Schmalz)
Abbildung 4: Ernährungsempfehlung Endometriose (mit
freundlicher Genehmigung von Prof. René Wenzl, Wien)
Sport
Regelmäßige sportliche Betätigung hat einen posi-
tiven Einfluss auf Ihr körperliches Wohlbefinden.
Zudem scheint ein positiver Effekt beim Vorliegen
einer Endometriose nachweisbar. Achten Sie auf
regelmäßige (dreimal wöchentlich) Bewegung von
mindestens 20 Minuten Schnelles Gehen kann
hier schon ausreichen. Eventuell besteht für Sie
auch die Möglichkeit, einer sportlichen Aktivität
im Verein oder im Rahmen einer Freizeitsport-
gruppe nachzugehen.
23Ergänzende Therapieansätze
Ergänzende Therapieansätze, die in Verbindung
und im Zusammenspiel mit der Schulmedizin
Erfolg versprechend sein können, sind:
Traditionelle Chinesische Medizin (TCM)
Akupunktur
Phytotherapie (Pflanzenheilkunde)
Osteopathie
Gerne beraten wir Sie individuell, welcher
ergänzende Therapieansatz für Sie infrage
kommen könnte. Sprechen Sie uns an!
Rehabilitationsmaßnahmen
Unter gewissen Umständen ist nach einer aus-
geprägten Endometrioseoperation die Durchfüh-
rung einer Rehabilitationsmaßnahme sinnvoll.
Diese kann aktiv den Heilungs- und Genesungs-
prozess fördern.
Für Anschlussheilbehandlungen (AHB) gelten
spezielle Voraussetzungen:
Die AHB erfolgt im Anschluss an eine
stationäre Behandlung im Akutkrankenhaus.
Sie muss innerhalb von 14 Tagen nach der
Krankenhausbehandlung angetreten werden.
Sie wird in speziell zugelassenen AHB-Kliniken
durchgeführt.
Für die AHB „Gynäkologische Krankheiten und
Zustand nach Operation“ gelten folgende Indi-
kationen:
Es waren in der Vergangenheit ausgeprägte
Operationen aufgrund der Endometriose
notwendig.
Die Erkrankung oder die Operation war
deutlich erschwert oder kompliziert
(z. B. Bauchfellentzündungen, Eiterherde
im Bauchraum und/oder Harninkontinenz).
Weitere Möglichkeiten, die eine AHB erforderlich
machen könnten, sind z. B.:
an Anzahl und Ausbreitung multiple
Endometrioseherde
24 ausgeprägter komplizierter Verwachsungs-
bauch (sogenannte Adhäsionen)
Wundheilungsstörungen
Eingriffe am Darm
Ob für Sie eine Rehabilitationsmaßnahme sinn-
voll ist und ob Sie vom Kostenträger übernommen
wird, klären wir gerne im Einzelgespräch mit Ihnen.
Unser Sozialdienst steht Ihnen hier gerne bera-
tend zur Verfügung.
Interdisziplinäres Vorgehen bei der
Erkrankung Endometriose
Die Erkrankung Endometriose ist vielschichtig
und kann sowohl mehrere Körperregionen
(Scheide, Gebärmutter, Blase oder Darm) als
auch weitere Aspekte (Psyche, Ernährung oder
Schmerzverhalten) betreffen. Deshalb ist hier
ein interdisziplinärer Therapieansatz notwendig.
Das Universitäts-Endometriosezentrum Franken
(Stufe III) bietet eine komplette interdisziplinäre
Versorgung bei der Erkrankung Endometriose an.
Patientinnen mit
Verdacht auf
Endometriose/
chronischen
Unterbauch-
schmerzen
Zusammenarbeit mit der Selbsthilfegruppe „Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V.“,
sowie mit allen Kooperationspartnern
Abbildung 5: Unser Konzept zur individuellen Diagnostik und Therapie
zusammen mit allen Kooperationspartnern
25Studien des Universitäts-
Endometriosezentrums Franken
Das Universitäts-Endometriosezentrum Franken
ist als eines der größten Endometriosezentren
an der Erforschung der Erkrankung Endometriose
beteiligt.
Wir führen in regelmäßigen Abständen Diagnostik-
und Therapiestudien zur Erprobung und Etablie-
rung neuer Methoden, neuer Medikamente und
neuer/anderer Behandlungen bei Endometriose
durch.
Der Schwerpunkt unseres wissenschaftlichen
Interesses liegt besonders auf der Ursachenerfor-
schung der Endometriose. Da ein genetischer
Anteil an der Entstehung dieser Erkrankung
unverkennbar ist, bemüht sich unsere Arbeits-
gruppe, diese eventuell vorhandenen genetischen
Voraussetzungen zu entschlüsseln.
Nur durch eine konsequente Forschungsarbeit
wird es in absehbarer Zeit bessere Erklärungs-
modelle für die Erkrankung Endometriose und
damit auch neuere Therapieoptionen geben.
Deshalb sind wir aktiv auf Ihre Mithilfe ange-
wiesen.
Für unsere Arbeit benötigen wir von Ihnen als
Endometriosepatientin lediglich eine Blutprobe
(10 ml). Darüber hinaus wären wir Ihnen dank-
bar, wenn Sie uns einen Fragebogen über Ihre
Familien- und Krankengeschichte ausfüllen
würden.
Bitte sprechen Sie unser Ärzteteam an!
26Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V.
Am 28. September 1996 haben sich erstmals in
Deutschland von Endometriose betroffene Frauen
zusammengetan und eine überregionale Selbst-
hilfeorganisation für Endometriose gegründet:
Der Gründung der Patientinnen- und Selbsthilfe-
organisation ging der 1. Ganzheitsmedizinische
Endometriose-Kongress im Herbst 1995 in
Augsburg voraus. Dort hatten erstmals deutsche
Endometriose-Betroffene Gelegenheit, Vorträge
zum aktuellen Forschungsstand und mögliche
Therapien zu hören. Für viele Frauen war aber
der Austausch von Erfahrungen mit anderen
Betroffenen fast das wichtigste Element des
Kongresses. Oft war die Äußerung zu hören:
„Ich hätte mir früher nie vorstellen können, dass
so viele Frauen diese Krankheit haben. Ich dachte
immer, ich würde ganz alleine damit dastehen.“
Leider ist es in Deutschland immer noch so, dass
große Informationsdefizite bei Patientinnen und
Ärztinnen/Ärzten über diese Erkrankung bestehen,
obwohl Endometriose eine der häufigsten Frauen-
krankheiten ist. Oft kommt es zu einer mehrjäh-
rigen Verzögerung der Diagnosestellung nach
dem Auftreten der ersten Symptome. Die Folgen
sind Verunsicherung und Leid bei den Patien-
tinnen und deren Angehörigen.
Die Ziele der Endometriose-Vereinigung
Deutschland e. V. sind:
mehr Kenntnis und Verständnis über bzw. für
Endometriose und ihre gesundheitlichen und
sozialen Folgen für die betroffenen Frauen
und deren Angehörige
Endometriose-Betroffenen die Möglichkeiten
bieten, sich untereinander auszutauschen, Kri-
tik, Ärger und Wut auszusprechen und Erfah-
rungen positiv nutzbar zu machen
27 eine schnellere Diagnosestellung und ange-
messenere, auf die jeweilige biografische
Situation der Patientin bezogene Behandlung
Studien und Forschung zu schonenderen Dia-
gnoseverfahren und Behandlungsmethoden
eine differenzierte Therapieplanung unter
Abwägung aller Möglichkeiten
Rehabilitation in Kliniken mit einem speziellen
Endometriose-Konzept
Berücksichtigung der Endometriose in der
Ausbildung der Ärzte, besonders in der Fach-
arztausbildung
Einflussnahme auf gesundheits- und sozial-
politische Entwicklungen
Kooperation mit allen, die Entscheidungen für
Endometriose-Erkrankte treffen, insbesondere
Krankenkassen, Ärzte, Rentenversicherungs-
träger, Behörden, Politiker, Verbände (z. B.
Ärzte, Therapeuten, Arbeitgeber)
Seit dem Jahr 2005 zertifiziert die Endometriose-
Vereinigung Deutschland e. V. gemeinsam mit der
Stiftung Endometrioseforschung und der Euro-
päischen Endometriose-Liga Endometriosezen-
tren. Die Antragsteller müssen sich im Vorfeld
einem kritischen Erhebungsbogen stellen, der
durch Mediziner und Betroffene begutachtet wird.
Mit diesen Bögen erklären die Antragsteller ihre
Zusammenarbeit innerhalb des Endometriose-
zentrums, z. B. mit Rehabilitationseinrichtungen,
mit IVF-Zentren, mit Schmerzambulanzen und mit
der Komplementärmedizin. Die Antragsteller
informieren über ihre Fortbildungsaktivitäten,
die Unterstützung der Selbsthilfe bzw. die Teil-
nahme an Studien. Die Endometriose-Vereinigung
Deutschland e. V. nimmt in allen Krankenhäusern
oder Praxen ein Audit vor, in dem vonseiten der
Patientinnen folgende Themen kritisch begut-
achtet werden:
Ablauf
Aufnahmeprozedere
Ordnung, Sauberkeit, Atmosphäre
Aufklärung, Abschlussgespräch
28 Wie arbeitet der Sozialdienst des
Krankenhauses?
Ausstattung des Krankenhauses/der Praxis,
der Krankenzimmer
Wahlessen, Getränke, Eingehen auf
Unverträglichkeiten etc.
Quelle: Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V.
Wir unterstützen die Arbeit der Endometriose-
Vereinigung Deutschland e. V. aktiv. Bei Interesse
bieten wir Ihnen an, Kontakt zur Endometriose-
Vereinigung Deutschland e. V. aufzunehmen.
Bitte beachten Sie auch die ausliegenden Infor-
mationsbroschüren.
Kontakt
Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V.
Bernhard-Göring-Str. 152
04277 Leipzig
Tel.: 0341 3065304
Fax: 0341 3065303
info@endometriose-vereinigung.de
www.endometriose-vereinigung.de
Europäische Endometriose Liga
Die Europäische Endometriose Liga (EEL) ist
ein eingetragener Verein, der im September
2005 von renommierten Medizinerinnen und
Medizinern gegründet wurde. Das Universitäts-
Endometriosezentrum Franken ist seit vielen
Jahren aktives Mitglied in der EEL.
Mit ihrer Arbeit will die EEL das Wissen über Endo-
metriose verbreiten und die Krankheit stärker
als bisher im Bewusstsein von Ärzteschaft und
Öffentlichkeit verankern.
Der Auftrag der EEL gilt für ganz Europa. Landes-
verbände sind bereits in mehreren Ländern Euro-
pas aktiv, weitere befinden sich in Gründung.
29Der Vorstand und der Beirat der EEL bestehen aus
Mitgliedern verschiedener europäischer Länder.
Zugang haben nur Medizinerinnen und Mediziner
mit klinischer Erfahrung im Bereich der Endome-
triose. Die assoziierte Stiftung Endometriose-For-
schung (SEF) unterstützt die Arbeit der EEL durch
die gemeinsame Durchführung von Tagungen, Se-
minaren, Fortbildungsveranstaltungen und Kon-
gressen zu den Themen Endometriose, Schmer-
zen und Unfruchtbarkeit.
Die Europäische Endometriose Liga bietet ein
vielfältiges Internetangebot an. Neben Infor-
mationen rund um das Thema Endometriose,
steht Ihnen ein Expertennetzwerk und ein Pati-
entinnenforum zur Verfügung.
www.endometriose-liga.eu
Stiftung Endometriose-Forschung
Die Stiftung will das Wissen um die Krankheit
Endometriose in Deutschland verbessern. Auch
hier ist das Universitäts-Endometriosezentrum
Franken seit vielen Jahren aktives Mitglied.
Auf der Internetseite der Stiftung Endometriose-
Forschung erhalten Sie ausführliche Informa-
tionen zu:
Grundlagen der Erkrankung
Behandlungsmöglichkeiten – operativ und
medikamentös
Rehabilitationsmöglichkeiten
Neuigkeiten aus der Forschung
Endometriose-Ambulanzen
Selbsthilfegruppen
Ablauf
www.endometriose-sef.de
30Für Ihre Fragen
Kontaktdaten
Spezialambulanz für Endometriose
Terminvereinbarung:
Montag, Dienstag sowie Donnerstag, 9.00 – 15.00 Uhr
Mittwoch und Freitag, 9.00 – 14.00 Uhr
Tel.: 09131 85-33524
Chefarztambulanz (Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann)
fk-endometriose@uk-erlangen.de
Terminvereinbarung:
Montag – Donnerstag, 7.30 – 17. 30 Uhr
Freitag, 7.30 – 13.00 Uhr
Tel.: 09131 85-33453
Oberärztliche Privatambulanz
Terminvereinbarung:
Montag – Donnerstag, 8.00 – 16.00 Uhr, Freitag, 8.00 – 13.00 Uhr
Tel.: 09131 85-44039
Präoperative Ambulanz
Tel.: 09131 85-33500, Fax: -34042
Informationen/Pforte
(24 Stunden besetzt, für Notfälle außerhalb der Sprechstunden)
Tel.: 09131 85-33553 und -33554
Fax: 09131 85-33552
31Schematische Darstellung
des Unterleibs I (Ansicht seitlich)
Niere
Harnleiter
Wirbelsäule
Eierstock
Eileiter
Gebärmutter
Muttermund Harnblase
Schambein
Enddarm
Klitoris
Scheide Harnröhre
Anus
Kleine Große
Schamlippen Schamlippen
32Eileiter
Folikel mit
heranreifendem Ei
Gebärmutterhöhle
Gebärmutterkörper
Gebärmutterschleimhaut
Gebärmutterhals
Muttermund
Eierstock Fimbrien
des Unterleibs II (Ansicht frontal)
Schematische Darstellung
33
ScheideAnreise
So finden Sie uns
Mit dem Auto
Folgen Sie von der A 73 Ausfahrt
Erlangen-Nord der Beschilderung
„Uni-Kliniken“. Im Klinikbereich
stehen nur begrenzt Kurzzeitpark-
plätze zur Verfügung. Bitte nutzen
Sie das Parkhaus Uni-Kliniken an
der Palmsanlage. Langzeitparkplätze
finden Sie auch auf dem Großpark-
platz westlich des Bahnhofs.
Mit dem Zug
Der Hauptbahnhof Erlangen
(ICE-Anschluss) liegt etwa 700 m
von der Frauenklinik entfernt.
Parkhaus Uni-Kliniken
FrauenklinikUniversitäts-Endometriosezentrum Franken
Klinisch-wissenschaftliches Endometriosezentrum (Stufe III)
Sprecher: Prof. Dr. med. Matthias W. Beckmann
Koordinatoren: Dr. med. Stefanie Burghaus
Dr. med. Thomas Hildebrandt
Universitätsstr. 21/23, 91054 Erlangen
www.endometriosezentrum.uk-erlangen.de
Tel.: 09131 85-33553
Fax: 09131 85-33456
Zertifiziert durch:
n Endometriose-Vereinigung Deutschland e. V.
FK 629-509471_Vers. 11/18
n Stiftung Endometriose-Forschung (SEF)
n European Endometriosis League (EEL)
Zur besseren Lesbarkeit verwenden wir bei der Bezeichnung von Personengruppen die
männliche Form; selbstverständlich sind dabei die weiblichen Mitglieder eingeschlossen.
Herstellung: Uni-Klinikum Erlangen/Kommunikation, 91012 ErlangenSie können auch lesen