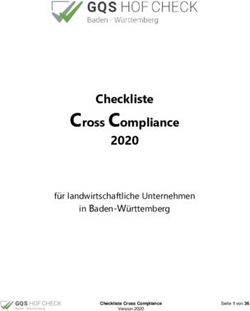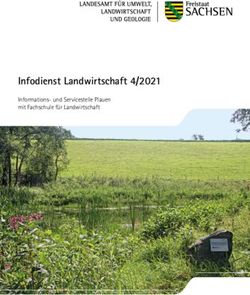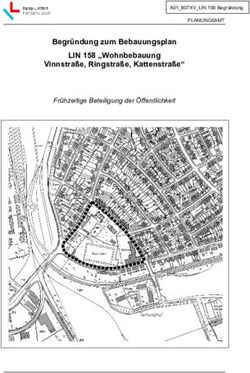Energiepark "Ehemaliges Munitionsdepot" Fauna-Bericht 2020 - Erstellt im Auftrag der - Stadt Schwalmstadt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
Fauna-Bericht 2020
Erstellt im Auftrag der
Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll eG
Kassel, 22.12.2020
Hafenstraße 28, 34125 Kassel
Tel: 0561 5798930, Fax: 0561 5798939
E-Mail: info@boef-kassel.deAuftraggeber: Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll eG
Mainzer Gasse 4
34613 Schwalmstadt
Auftragnehmer: BÖF
Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH
Hafenstraße 28
34125 Kassel
www.boef-kassel.de
Projektleitung: Anke Seibert-Schmidt
Bearbeitung: Julia Hartung
Svenja Wahl
Lynne Werner
Sabrina Brückmann
Michael WimbauerEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1 ANLASS............................................................................................................... 3 2 AVIFAUNA POTENZIALABSCHÄTZUNG ............................................................ 6 2.1 METHODIK ............................................................................................................. 6 2.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG .............................................................................. 6 3 FLEDERMÄUSE POTENZIALABSCHÄTZUNG ..................................................11 3.1 METHODIK ............................................................................................................11 3.2 ERGEBNISSE & BEWERTUNG .................................................................................11 4 REPTILIEN .........................................................................................................15 4.1 METHODIK ............................................................................................................15 4.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG .............................................................................17 5 TAGFALTER .......................................................................................................22 5.1 METHODIK ............................................................................................................22 5.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG .............................................................................23 6 LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS .....................................................28 BÖF I
Inhaltsverzeichnis Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
Tabellenverzeichnis
Tab. 3-1: Gesamtartenliste der potenziell vorkommenden Fledermaus-Arten im
Gebiet .................................................................................................................11
Tab. 4-1: Erfassungstage Reptilien ....................................................................................16
Tab. 4-2: Nachgewiesene Reptilien-Arten ..........................................................................17
Tab. 4-3: Nachweise Reptilien-Arten in den Untersuchungsflächen ...................................18
Tab. 5-1: Erfassungstage Tagfalter ....................................................................................22
Tab. 5-2: Nachgewiesene Tagfalter-Arten ..........................................................................23
Tab. 5-3: Nachweise Tagfalter-Arten in den Untersuchungsflächen ...................................24
Tab. 5-4: Weitere Rote Liste Tagfalter-Arten mit potenziellem Vorkommen in den
Untersuchungsflächen ........................................................................................25
Abbildungsverzeichnis
Abb. 1-1: Übersicht Lage Untersuchungsgebiet (Luftbild Quelle: google earth) ................... 3
Abb. 1-2: Lage der beiden Teilgeltungsbereiche.................................................................. 4
Abb. 1-3: Östlicher Teilgeltungsbereich (B) ......................................................................... 5
Abb. 1-4: Westlicher Teilgeltungsbereich (A) ....................................................................... 5
Abb. 3-1: Lineare Leitstruktur für Fledermäuse im Gebiet.....................................................12
Abb. 4-1: Beispielhafte Darstellung zum Einsatz künstlicher Verstecke bzw.
Reptilienbretter....................................................................................................16
Abb. 4-2: Zauneidechsenhabitat am Rand der östlichen Probefläche (B) mit
Reptilienbrett Nr. 6 ..............................................................................................19
Abb. 4-3: Bereiche des Zauneidechsenhabitats am Rand der östlichen Probefläche
(B) .......................................................................................................................19
Abb. 5-1: Mauerfuchs (Lassiommata megera) ....................................................................26
Abb. 5-2: Sichelschrecke in der westlichen Probefläche (A) ...............................................27
Anhang
Tab 1: Potentielles Artenspektrum Avifauna
Karten
Ergebniskarte Nr. 1 „Avifauna & Fledermäuse“………………………………….Maßstab: 1:2.000
Ergebniskarte Nr. 2 „Reptilien“……………………………………………………Maßstab: 1:2.000
Ergebniskarte Nr. 3 „Tagfalter“…………………………………..………..………Maßstab: 1:2.000
II BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Anlass 1 ANLASS Die Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll eG plant die Errichtung von zwei Photovoltaik-An- lagen auf dem Sondergebiet eines ehemaligen Munitionsdepots, welches umgeben von land- wirtschaftlich genutzten Flächen zwischen den Gemeinden Allendorf und Rörshain liegt. Abb. 1-1: Übersicht Lage Untersuchungsgebiet (Luftbild Quelle: google earth) Der Geltungsbereich besteht aus zwei Teilbereichen. Der westliche Teilgeltungsbereich (in den Karten mit „A“ betitelt), umfasst eine Teilfläche des Flurstücks 6/2, der östliche Teilgel- tungsbereich (in den Karten mit „B“ betitelt, s. Anhang), eine Teilfläche des Flurstücks 6/5. Beide Flurstücke liegen in der Flur 8 der Gemarkung Allendorf. Zusammen umfassen die bei- den Teilgeltungsbereiche eine Gesamtfläche von ca. 2,2 ha. Die Teilbereiche werden bis auf die Westgrenze des westlichen Teilgeltungsbereichs durch weitere Flächen des ehemaligen Munitionsdepots begrenzt. Entlang der westlichsten Grenze verläuft ein asphaltierter Wirt- schaftsweg. Die Anlage ist als unbewegliche Großflächenfreianlage geplant und die bauliche Nutzung ori- entiert sich dabei an den aktuellen technischen und baulichen Standards für Freiflächenpho- tovoltaikanlagen. Weiterhin ist eine aufgeständerte Bauweise der Module geplant, die in Rei- hen nach Süden bzw. Südwesten ausgerichtet. Durch die Photovoltaikanlage ist mit einer Flä- chenversiegelung von < 2 % mit einer Beschattung und Bebauung auf maximal 60 % der Flä- che zu rechnen. BÖF 3
Anlass Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
Für das beschriebene Vorhaben waren als Grundlagen für die Beurteilung der Umweltbelange
im Rahmen der Bauleitplanung faunistische Kartierungen mit einer artenschutzrechtlichen Be-
urteilung durchzuführen. Die artenschutzrechtliche Beurteilung erfolgt im Umweltbericht
Das Untersuchungsgebiet bietet potenziellen Lebensraum vor allem für die Arten der Gruppen
Avifauna, Fledermäuse, Reptilien und Tagfalter. Aufgrund der späten Beauftragung fanden die
Begehungen für die Reptilien, und Tagfalter erst ab 23. Juli statt. Für die beiden Artgruppen
Avifauna und Fledermäuse wurde eine Potenzialabschätzung ohne eine systematische Erfas-
sung durchgeführt. Das Vorgehen wurde im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde im
Rahmen eines Ortstermins am 26.06.2020 abgestimmt. Neben den beiden Geltungsbereichs-
flächen auch eine dritte benachbarte "Potenzialfläche" untersucht. Dort sollte geprüft werden,
ob, und wenn ja welche Aufwertungspotenziale gegeben sind, die sich für Artenschutz- oder
Ausgleichmaßnahmen anbieten. Im Ergebnis zeigte sich jedoch, dass diese Potenzialfläche
mehr oder minder optimale Habitatfunktionen bietet, und somit dort kein Aufwertungspotential
besteht. Der Vollständigkeit halber werden die Ergebnisse der Erhebungen auf dieser Fläche
ebenfalls im nachfolgenden Bericht erläutert.
Die Ergebnisse der Untersuchungen werden in diesem Bericht dargestellt und abschließend
artenschutzrechtlich beurteilt.
A
B
Abb. 1-2: Lage der beiden Teilgeltungsbereiche
4 BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Anlass Abb. 1-3: Östlicher Teilgeltungsbereich (B) Abb. 1-4: Westlicher Teilgeltungsbereich (A) BÖF 5
Avifauna Potenzialabschätzung Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
2 AVIFAUNA POTENZIALABSCHÄTZUNG
2.1 METHODIK
Eine Einschätzung der avifaunistischen Vorkommen erfolgte anhand einer Begehung und Be-
gutachtung der Flächen vor Ort. Innerhalb des Untersuchungsgebiets liegen sowohl die west-
liche und östliche Teilfläche des Geltungsbereichs als auch die „Potenzialfläche“.
Am 23.07.2020 fand eine Begehung des Untersuchungsgebietes statt, bei der sowohl die
Sichtbeobachtungen von Vogelarten vor Ort aufgenommen, als auch die unterschiedlichen
Habitate in ihrer Eignung für den Lebensraum typischer Arten bewertet wurden. Die Lebens-
räume werden in folgende Habitate unterteilt: Wald, Waldrand, Halboffenland, Offenland.
2.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG
Während der Begehung wurden 37 Vogelarten innerhalb des Untersuchungsgebiets (Gel-
tungsbereich zuzgl. 100 m Puffer, s. Karte 1, Anhang) beobachtet bzw. verhört. Von den er-
fassten Vogelarten haben:
- 1 Art (Bluthänfling) einen ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand („rote“ Art)
- 8 Arten (Feldsperling, Goldammer, Kleinspecht, Neuntöter, Stieglitz, Rotmilan, Sper-
ber, Wespenbussard) einen ungünstigen bis unzureichenden Erhaltungszustand
(„gelbe“ Arten)
- 18 Arten einen günstigen Erhaltungszustand („grüne“ Arten)
Innerhalb der Geltungsbereiche wurden von den genannten Arten die fünf Arten Bluthänfling,
Feldsperling, Goldammer, Neuntöter, Stieglitz innerhalb der B-Plan-Flächen kartiert.
Neben der großen Anzahl an „grünen“ Arten, die im Gebiet beobachtet wurden, bietet die Ha-
bitatausstattung des Gebiets potenziell weiteren Arten mit günstigem Erhaltungszustand einen
Lebensraum. Nachfolgend betrachtet werden allerdings nur die planungsrelevanten Arten,
d.h., die mit ungünstigem bis unzureichendem sowie ungünstigem bis schlechtem Erhaltungs-
zustand (HGON & VSW 2014). Sowohl die vor Ort erhobenen, als auch die potenziellen Arten
sind auch auf der Karte 1 „Potenzialabschätzung Avifauna & Fledermäuse“ dargestellt und
ihren jeweiligen Lebensräumen zugeordnet.
Halboffenland und Offenland
Beschreibung des Gebiets
Das Halboffenland innerhalb des Untersuchungsgebiets ist überwiegend durch extensiv ge-
nutztes Grünland mit partieller Ruderalvegetation und randständiger bzw. punktueller Gehölz-
struktur geprägt. Die westliche und östliche Teilfläche (zur Lage s. Karte 1) werden nachfol-
gend kurz beschrieben (für eine ausführlichere Beschreibung der Flächen s. Kap. 4.2).
6 BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Avifauna Potenzialabschätzung
Der westliche Teilgeltungsbereich A ist durch extensiv genutzte Mähwiesen charakterisiert,
auf denen partiell Weißdorn und (junge) Pappeln hochwachsen. Östlich wird die Fläche durch
eine Ruderalvegetation geprägt, mit einzelnen Gebäudestrukturen, in den westlichen Randbe-
reichen finden sich Übergangsstrukturen zu Heiden mit baumfreien Zwergstrauchheiden.
Der östliche Teilgeltungsbereich B ist überwiegend als blütenreiche, magere Flachland-Mäh-
wiese einzuordnen, die aufgrund der extensiven Bewirtschaftung sehr artenreich ist. In den
Randbereichen finden sich Ruderalvegetation und partiell abgelagerter Schutt.
Die südlich des westlichen Geltungsbereichs liegende Potenzialfläche ist als extensives Grün-
land mit magerer Vegetation einzustufen. Punktuell finden sich dichter gewachsene Gehölz-
strukturen und ruderale Flächen sowie aufgeschüttete Steinhaufen.
Artvorkommen
Während der Begehung konnten folgende Arten mit ungünstigem bis schlechtem und ungüns-
tigem bis unzureichendem Erhaltungszustand als potenzielle Brutvögel beobachtet werden:
- Bluthänfling
- Feldsperling
- Goldammer
- Neuntöter
- Stieglitz
Darüber hinaus wurde aufgrund der Habitateignung das potenzielle Vorkommen von folgen-
den Brutvögeln ermittelt, die in Hessen einen ungünstigen bis schlechten oder ungünstigen
bis unzureichenden Erhaltungszustand aufweisen:
- Klappergrasmücke
- Turteltaube
- Feldlerche
- Raubwürger (nur als Wintergast)
Alle genannten Arten mit Ausnahme der Feldlerche, die als einzige eine klassische Art des
Offenlandes und ein Bodenbrüter ist, brüten potenziell in den Gehölzstrukturen entlang der
Wiesenflächen. Die extensiven Grünflächen mit einem hohen Insekten- und Samenvorkom-
men bieten allen Arten ein sehr gutes Nahrungshabitat.
Der Bluthänfling ist die einzige potenzielle Brutvogelart im Halboffenland, die in Hessen einen
ungünstigen bis schlechten Erhaltungszustand aufweist. Die Art wird exemplarisch für die an-
deren typischen Arten der halboffenen und offenen Feldflur vorgestellt (Feldsperling, Goldam-
mer, Neuntöter, Stieglitz, Feldlerche), deren Bestände deutschlandweit von einem Rückgang
betroffen sind.
BÖF 7Avifauna Potenzialabschätzung Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
Dem Bluthänfling bieten die Geltungsbereiche einen sehr gut geeigneten Lebensraum. Die Art
besiedelt vor allem hecken- und grünlandreiche Kulturlandschaften und bevorzugt Ruderalflu-
ren mit einem hohen Anteil an samentragenden Kräutern (STÜBING et al. 2010).
Die Feldlerche war bis in die 90-er Jahre im Offenland noch weit verbreitet und häufig, inzwi-
schen ist sie auf Intensivgrünländern fast vollständig verschwunden und auf Äckern deutlich
zurückgegangen. Sie brütet mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den an die Geltungsbereiche
angrenzenden Ackerflächen. Auch Reviere innerhalb der offenen Flächen der Teilgeltungsbe-
reiche sind möglich, innerhalb des südöstlichen Abschnitts des Teilgeltungsbereichs A auf-
grund der nahe angrenzenden Gehölze jedoch unwahrscheinlich.
Wald und Waldrand
Bei dem Wald handelt es sich um einen jungen bis mittelalten Mischwald, der durch Kiefern
und unterschiedliche Laubbaumarten geprägt ist.
Artvorkommen
Während der Begehung konnten folgende Arten mit ungünstigem bis unzureichendem Erhal-
tungszustand als potenzielle Brutvögel beobachtet werden:
- Kleinspecht
- Rotmilan
- Wespenbussard
Alle drei Arten haben ihren Reviermittelpunkt vermutlich innerhalb oder angrenzend an das
Untersuchungsgebiet (s. Karte 1, Anhang). Vom Wespenbussard wurden drei Individuen krei-
send über dem Waldgebiet beobachtet, was das Vorkommen eines Horstes wahrscheinlich
macht. Für den Horststandort des Rotmilans gibt es keinen konkreten Hinweis.
Darüber hinaus ist aufgrund der Habitateignung von potenziellem Vorkommen folgender Brut-
vögel auszugehen, die in Hessen einen ungünstigen bis schlechten oder ungünstigen bis un-
zureichenden Erhaltungszustand aufweisen:
- Waldohreule
- Waldlaubsänger
- Schwarzmilan
- Weidenmeise
- Trauerschnäpper
- Baumfalke
Einige der Arten wählen ihren Horst- bzw. Nistplatz bevorzugt entlang von Walrändern (u.a.
Rot- und Schwarzmilan, Waldohreule). Als Nahrungsgäste kommen vermutlich auch weitere
Spechtarten wie der Schwarz- und der Grauspecht vor.
Es ist davon auszugehen, dass alle gelisteten Arten das angrenzende Grünland als Nahrungs-
habitat nutzen. Beute greifende Vögel (Rotmilan, Wespenbussard, Waldohreule, Baumfalke)
8 BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Avifauna Potenzialabschätzung überfliegen das Gebiet auf der Jagd nach Insekten sowie Kleinsäugern, Reptilien und Singvö- geln. Artenschutzrechtliche Hinweise Durch die Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlagen auf dem Sondergebiet eines ehemaligen Munitionsdepots findet eine Flächenversiegelung mit entsprechendem vollständigen Flächen- verlust nur auf rd. 2 % des Offenlandes innerhalb der zwei Geltungsbereiche statt. Hierunter fällt auch die Errichtung baulicher Nebenanlagen wie Container, die gemäß Festsetzungen des Bebauungsplans nur max. 100 m2 Fläche einnehmen dürfen. Neben der 2 % Versiegelung erfolgt eine Beschattung/ Überbauung von max. 60 % der Fläche. Die Photovoltaik-Anlagen werden mit einer Mindesthöhe von 0,8 m und mit einer Maximalhöhe von 3,5 m errichtet. Ge- hölze sind planmäßig nicht durch das Vorhaben betroffen. Durch das Vorhaben geht nur ein sehr geringer Teil des Offenlandes vollständig verloren, es ist jedoch davon auszugehen, dass sich der Charakter der gesamten Eingriffsfläche durch die Überbauung verändert. Darüber hinaus kann es während der Bautätigkeit zu einer Störung der angrenzenden Habitate (Offenland und Gehölzstrukturen) kommen. Anlagebedingt geht nur ein sehr geringer Flächenanteil an Grünland (2 %) vollständig verlo- ren, dennoch ist ein Revierverlust von Offenlandarten (Feldlerche) wahrscheinlich. Je nach Stellweise der einzelnen Module (Modulabstände) kann eine Scheuchwirkung bzw. Vergrä- mungswirkung der Anlage auf Bodenbrüter ausgehen (wie in einem brandenburgischen So- larpark beobachtet, NEULING 2009). Das vollständige Erlöschen eines lokalen Brutvorkom- mens (von Grauammern) nach der Errichtung eines Solarparks ist bisher in einem Fall doku- mentiert (s. LIEDER & LUMPE 2011). Kollisionen von Vögeln mit PV-Modulen sind bisher nicht bekannt (u.a. PÜSCHEL 2013, HER- DEN, GHARADJEDAGHI & RASSMUS 2006), daher ist anlagebedingt nicht von einem erhöhten Tötungsrisiko von Vögeln auszugehen. Durch die Einrichtung der Baustelle sowie die Bautätigkeit ist mit einer baubedingten Störung auf den Stellflächen für die PV-Module sowie angrenzenden Habitate zu rechnen. Während der Bauzeit kommt es zu Lärm- und Staubemissionen sowie zusätzlichen optischen Reizen. Um einen Verlust besetzter Fortpflanzungs- und Ruhestätten von bodenbrütenden Vögeln zu vermeiden, sollten die Bautätigkeit oder vorbereitende Bodenarbeiten nur außerhalb der Brut- zeit zwischen dem 01.10. und 28./29.02. stattfinden. Sollte dies nicht umsetzbar sein, müssen auf den Flächen, auf denen Arbeiten während der Brut- und Setzzeit stattfinden, rechtzeitig vor Beginn der Brutphase (vor dem 01.03.), Vergrämungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die voraussichtlich geringe Anzahl an betroffenen Feldlerchen-Brutpaaren kann aufgrund der Habitatstruktur des Gebiets in die angrenzenden Offenlandflächen ausweichen. BÖF 9
Avifauna Potenzialabschätzung Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Gehölze durch das Vorhaben nicht direkt betroffen, d.h. es gehen keine Nistplätze von gehölz- bewohnenden Vogelarten verloren. Sollten Gehölze entgegen der derzeitigen Planung ent- nommen werden müssen, so darf dies ausschließlich außerhalb der Brutzeit (zw. 01.10. und 28./29.02.) durchgeführt werden. Anlagebedingt ist mit einer Beeinträchtigung des Nahrungshabitats auf dem extensiven Grün- land auszugehen, da sich durch die Überbauung sowohl die Habitatqualität für Pflanzen als auch Insekten verringert und somit voraussichtlich zu einer Abnahme in Vielfalt und Anzahl dieser führen wird (vgl. auch Kap. 5). Es ist dennoch damit zu rechnen, dass der überwiegende Anteil der Vogelarten auch nach Bau und Inbetriebnahme der PV-Anlage das Gebiet zur Nah- rungssuche nutzen werden. Mehrere Studien zu Auswirkungen von PV-Anlagen legen nahe, dass verschiedene Vogelarten die Anlagen weiterhin regelmäßig aufsuchen und keine Irritati- ons- oder Meidewirkung von ihnen ausgeht (u.a. LIEDER & LUMPE 2011). Diese Annahme kann für Bodenbrüter wie die Feldlerche allerdings nicht getroffen werden (vgl. NEULING 2009). Aufgrund der geringen Anlagenhöhe ist nicht mit einer Scheuchwirkung durch einen soge- nannten Silhouetteneffekt für angrenzende Flächen zu rechnen (DEMUTH & MAACK 2019). Auch bei Nahrungsgästen, die im Offenland nach Beutetieren suchen (u.a. Mäusebussard, Rot- und Schwarzmilan) wurde bisher bei der Nahrungssuche über PV-Anlagen kein abwei- chendes Flugverhalten festgestellt. Greifvögel werden das Gebiet auch nach der Umnutzung zur Nahrungssuche nutzen. Die Module bieten hingegen unterschiedlichen Vogelarten Sing- und Ansitzwarten (u.a. Feldlerche und Turmfalke), Ruheplätze und potenzielle Nistmöglichkei- ten sowie im Winter in den überbauten Bereichen schneefreie Flächen, die die Nahrungssuche erleichtern. Die Qualität des Nahrungshabitats sollte durch den Erhalt extensiven, standortge- rechten Grünlands in den Randbereichen des Geltungsbereichs erhalten werden. Betriebsbedingt ist für die Brutvögel, die in den Offenlandflächen und Gehölzen im Umfeld der PV-Anlage brüten, nicht von einer Störung auszugehen. Während des Betriebs findet ne- ben einer regelmäßigen Wartung und ggf. Reparatur von einzelnen Modulen keine weitere Tätigkeit auf dem Gelände statt. Zudem wird die Anlage nicht beleuchtet, es ist daher auch nicht mit Beeinträchtigungen von nachtaktiven Vögeln (Eulen, Ziegenmelker) zu rechnen. 10 BÖF
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Fledermäuse Potenzialabschätzung
3 FLEDERMÄUSE POTENZIALABSCHÄTZUNG
3.1 METHODIK
Für die Fledermäuse erfolgt anhand der vorhandenen Habitatstrukturen und des Umfelds eine
Potenzialabschätzung, welche Arten dort vorkommen können und welche Strukturen diese
dort nutzen (Jagdhabitate, Leitstrukturen, Quartiere). Für das potenziell vorkommende Arten-
spektrum wird auf die Kartierung zum Windpark Rommershausen (S&W 2016 + 2019; im Auf-
trag der EAM Natur GmbH) in ca. 5 km Entfernung zur geplanten PV-Anlage verwiesen. Im
Fokus der Potenzialabschätzung liegen die beiden Wiesen, auf denen die PV-Anlagen geplant
sind, mit den direkt angrenzenden Strukturen (Gehölze, Waldrand).
3.2 ERGEBNISSE & BEWERTUNG
Im Gebiet sind aufgrund der grundsätzlichen Verbreitung der Arten und der Kartierungen in 5
km Entfernung (S&W 2016) 14 Fledermaus-Arten im Gebiet zu erwarten.
Von den 14 Arten sind alle Arten im Anhang IV der FFH-Richtlinie geführt, sowie Bechsteinfle-
dermaus und Großes Mausohr auch im Anhang II.
Tab. 3-1: Gesamtartenliste der potenziell vorkommenden Fledermaus-Arten im Gebiet
Deutscher Wiss.
FFH RL D RL He EHZ He
Artname Artname/Artgruppe
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus IV G 2 G
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii II, IV 2 2 U
Fransenfledermaus Myotis nattereri IV n 2 G
Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV n 3 G
Großes Mausohr Myotis myotis II, IV V 2 G
Große/Kleine Myotis brandtii IV V 2 U
Bartfledermaus* Myotis mystacinus IV V 2 G
Großer Abendsegler Nyctalus noctula IV V 3 S
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri IV D 2 U
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus IV D - U
Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii IV n 2 x
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus IV n 3 G
Braunes/Graues Plecotus auritus IV V 2 G
Langohr* Plecotus austriacus IV 2 2 U
* eine akustische Unterscheidung der jeweiligen Schwesterarten Bartfledermäuse bzw. Langohrfledermäuse ist nicht möglich
Der Erhaltungszustand der Arten gilt für Hessen: G = günstig, U = ungünstig bis unzureichend, s = ungünstig bis schlecht x =
unbekannt (FENA 2019).
FFH = Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, Anhänge II & IV (FFH-Richtlinie 1992).
Kategorien der Roten Listen: 0 - ausgestorben oder verschollen 1 - vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet,
G - Gefährdung anzunehmen, D - Daten defizitär, V - Vorwarnliste, n - derzeit nicht gefährdet.
Angaben für Hessen nach KOCK & KUGELSCHAFTER (1996), für Deutschland nach MEINIG et al. (2009).
Wochenstubenquartiere im Umfeld sind für Bechsteinfledermaus, Fransenfledermaus, Kleiner
Abendsegler (Höhlenbaumquartiere im Waldgebiet westlich Rommershausen), sowie Großes
Mausohr, Zwergfledermaus und Große / Kleine Bartfledermaus (Gebäudequartiere) bekannt
(S&W 2016).
BÖF 11Fledermäuse Potenzialabschätzung Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Einzel- und Zwischenquartiere sind auch in den Gehölz- und Waldbeständen angrenzend zu den geplanten PV-Anlagen möglich, da dafür schon sehr kleine Spalten/Höhlen oder Rin- denabplatzer ausreichen. Wochenstuben sind im direkten Umfeld aufgrund der fehlenden al- ten höhlenreichen Bestände nicht zu erwarten. Auch die umliegenden Gehölze sind eher jung und haben daher noch ein geringes Höhlen- und Spaltenpotenzial für größere Quartiere. Artbezogene Aussagen zum Flug- und Jagdverhalten sind aus BRINKMANN et al. 2012 (insbes. S.21-27) sowie BMVBS 2011 (insbes. S.44-47) abgeleitet. Insbesondere die linearen Strukturen (Waldrand und lineare Gehölze / Baumreihen) dienen den Arten mit einer hohen oder mittleren Strukturbindung (alle Arten außer Kleiner und Großer Abendsegler) als Leit- und Orientierungsstruktur. Außerdem haben die Gehölze und Waldrän- der auch als Jagdhabitat eine Bedeutung für die meisten Arten im Gebiet (z.B. Breitflügelfle- dermaus, Fransenfledermaus, Bartfledermäuse, Zwergfledermaus). Abb. 3-1: Lineare Leitstruktur für Fledermäuse im Gebiet Die extensiv genutzten Wiesen, auf der die PV-Anlagen errichtet werden soll, werden ebenfalls als Jagdhabitat genutzt (z.B. von Breitflügelfledermaus, Zwergfledermaus, Fransenfleder- maus, Großes Mausohr, Bartfledermäuse). Im Teilgeltungsbereich A führt eine beginnende Verbuschung dazu, dass die Eignung für die Fledermäuse derzeit zunimmt (Strukturvielfalt; Insektenvielfalt höher als auf monotoner Wiesenfläche). Die Nutzung der angrenzenden gro- ßen Offenland- /Ackerflächen ist insbesondere für die im freien Luftraum fliegenden und ja- genden Arten Kleiner und Großer Abendsegler abzuleiten, aber auch für Arten mit einer mitt- leren Strukturbindung, wie z.B. Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, Breitflügelfledermaus. Bechsteinfledermaus und Braunes Langohr nutzen als Jagdgebiete hauptsächlich Wälder, sind aber ebenso an gehölzreichen Siedlungsrändern / Offenlandschaften zu erwarten. 12 BÖF
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Fledermäuse Potenzialabschätzung Hinweise zu den Auswirkunge auf die Habitatqualität undArtenschutzrechtliche Hin- weise Die zukünftigen PV-Flächen können aufgrund der Habitatausstattung derzeit von nahezu allen potenziell vorkommenden Arten genutzt werden. In welcher Intensität dies jetzt und dann zum späteren Zeitpunkt mit PV-Anlagen für die einzelnen Arten erfolgt, lässt sich nur grob prognos- tizieren. Die Flächen haben derzeit gemeinsam mit den umliegenden Strukturen (Waldrand und Gehölze / Baumreihen) eine potenziell hohe Bedeutung insbesondere für die Arten mit hoher und mittlerer Strukturbindung sowie für die Arten, welche die extensiven Wiesenflächen mit einer geringen Flughöhe als Jagdhabitat nutzen. Fledermäuse sind auf das Vorhandensein einer ausreichenden Insektenvielfalt angewiesen, da diese ihre Nahrungsgrundlage bilden. Aufgrund der Strukturvielfalt im betrachteten Raum mit extensiven Wiesen, Gehölzen, Gebü- schen und der Waldrandlage ist von einer hohen Bedeutung für die Fledermäuse insgesamt auszugehen. Derzeit sind keine Eingriffe in die Gehölz- und Waldbestände geplant, sodass weder potenzi- elle Einzel- und Zwischenquartiere noch lineare Leitstrukturen durch das Vorhaben beeinträch- tigt oder zerschnitten werden. Durch das Aufstellen der PV-Module ist von einer anlagebedingten Beeinträchtigung der Jagdhabitate im Bereich der extensiven Wiesen auszugehen. Die Beeinträchtigung erfolgt zum einen dadurch, dass durch die PV-Module grundsätzlich weniger Wiesenfläche zur Jagd zur Verfügung steht bzw. ein Teil der Fläche „verbaut“ ist. Zum anderen wird durch die Beschat- tung ein Habitatwandel bewirkt, z.B. durch eine Veränderung des Mikroklimas, Temperaturun- terschiede, Feuchtigkeit im Boden. Die Pflanzenvielfalt wird im Bereich der PV-Module abneh- men und damit auch die Insektenvielfalt und dementsprechend auch die Insektenanzahl (s. auch Kap. 5 Tagfalter). Es ist für die Fledermäuse daher eine Reduzierung der Habitatqualität in Bezug auf das Jagdhabitat anzunehmen. Diese abgeleitete Reduzierung ist auf die hohe Habitateignung im Ausgangszustand zurückzuführen. Populationsbezogen können auf Basis der vorliegenden Kenntnisse keine erheblichen Beeinträchtigungen abgeleitet werden. In einem Vortrag hat K. Mammen (2019) auf eine Studie verwiesen, aus der hervorgeht, dass die Habitateigung für Fledermäuse im Bereich von PV-Anlagen deutlich geringer ist, wenn der Ausgangszustand eine mittlere bis hohe Habitateignung hatte. In den meisten Flächen wurden nach Installation der PV-Anlagen weniger Arten und auch weniger Aktivität festgestellt. In Halboffenlandflächen, also identisch zum betrachteten Untersuchungsraum, lag die Fleder- maus-Aktivität im Ursprungshabitat 2-5-mal höher, abhängig vom Ausgangszustand. Die vorgeschlagenen Maßnahmen für Reptilien und Tagfalter würden zum Erhalt einer Teilflä- che (Randbereich) des Geltungsbereiches führen und sind damit auch für die Fledermaus- Fauna positiv zu bewerten. Die externe Maßnahme der Grünlandextensivierung (s. Maßnahmen für Tagfalter, Kap. 5.2) würde ebenfalls zu einer Habitataufwertung bzgl. Jagd- /Nahrungsräumen für die potenziell im Raum vorkommenden Fledermaus-Arten führen. BÖF 13
Fledermäuse Potenzialabschätzung Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Es ist davon auszugehen, dass der Erhalt der randlichen Flächen des Geltungsbereiches als Maßnahmen für Reptilien und Tagfalter sowie die externe Grünlandextensivierung als Aus- gleich für die Habitatreduzierung durch die PV-Anlagen ausreichend sind. Das Quartierpotential und somit die Habitatqualität des Geltungsbereichs kann allerdings dar- über hinaus erhöht werden, indem die Trafostationen mit einer für Fledermäuse geeigneten Holzverkleidung versehen werden. Dadurch werden enge Spalträume geschaffen, die mehre- ren Fledermausarten ein Quartierpotential bieten (u.a. Zwergfledermaus, Rauhautfledermaus, kleine Myotis-Arten). Baubedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen abzuleiten, wenn die Arbeiten tags- über stattfinden. Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen abzuleiten, da keine Kollisionen mit den PV-Modulen zu erwarten sind. Licht- und Lärmbeeinträchtigungen sind betriebsbedingt ebenfalls nicht abzuleiten, da keine Beleuchtung der PV-Anlagen vorgesehen ist. 14 BÖF
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Reptilien 4 REPTILIEN Die meisten Reptilien besiedeln vom Menschen wenig genutzte oder extensiv genutzte Bio- tope mit Vegetation magerer Standorte wie zum Beispiel Trockenrasen, Waldlichtungen, Sand- und Geröllflächen und trockene Waldränder, aber auch intensiv genutzte Sekundärle- bensräume wie Bahndämme, Steinbrüche, Abbaugruben oder Weinberge werden oftmals in erstaunlicher Dichte besiedelt. Sie bevorzugen einen Wechsel aus offenen, lockerbodigen Ab- schnitten um sich zu sonnen und dichter bewachsenen Bereichen, zum Beispiel mit Totholz oder Altgras, in die sie sich flüchten können. Daher sind vor allem die Übergänge bzw. Säume zwischen Gehölzen und Offenland regelmäßig besiedelte Lebensräume. Genutzt werden auch anthropogene Strukturen wie Schotterflächen oder zur Lagerung aufgeschichtete Steinhaufen. Zwei der in Deutschland vorkommenden Arten, Ringelnatter und Würfelnatter, zeigen zudem eine deutliche Bindung an Gewässer, wobei diese Bindung bei der Würfelnatter sehr viel aus- geprägter ist. Die Ringelnatter besiedelt auch Komplexe aus Wiesen und Gehölzen in denen Gewässer nur eine geringe Rolle spielen. Bei den Untersuchungsflächen handelt es sich überwiegend um durch Grünland geprägte Be- reiche, Vegetation magerer Standorte und vielen Strukturen, die für Reptilien geeignete Habi- tatelemente darstellen. 4.1 METHODIK Reptilien stellen bei uns, aufgrund ihrer versteckten Lebensweise, eine Tiergruppe dar, deren Vertreter oft nur schwer nachzuweisen sind. Die besten Möglichkeiten bieten sich bei günsti- gen Witterungsbedingungen. Wenn sich die Tiere zur Thermoregulierung ihres Körpers direkt der Sonnenstrahlung aussetzen, können Eidechsen und Schlangen in geeigneten Lebens- raumstrukturen gezielt gesucht werden. Die Erfassung erfolgte dabei durch das langsame Ab- laufen der Grenzverläufe von Gehölzrändern und Offenland sowie anderer geeigneter Struk- turen in den Probeflächen. Mögliche Sonnenplätze wurden zusätzlich mit dem Fernglas kon- trolliert, auf diese Weise können Eidechsen entdeckt werden, bevor sie flüchten. Aber auch dann kann durch Sichtbeobachtung nur ein Bruchteil aller Individuen einer Popula- tion direkt nachgewiesen werden. Eine weitere Nachweismöglichkeit ist der Einsatz von Rep- tilienbrettern sogenannten künstlichen Verstecken. Bei den künstlichen Verstecken handelte es sich um ca. 1,00 m x 0,50 m große Dachpappen-Stücke, welche auch Reptilienbretter ge- nannt werden. Reptilien suchen die Bretter nicht gezielt auf, sondern stoßen beispielsweise bei der Nahrungssuche auf das „ideale“ Versteck. Da für einige Reptilienarten unter dem Brett günstige Bedingungen (Sichtschutz vor Prädatoren, günstige Möglichkeiten zur Thermoregu- lation, Nahrungsquellen etc.) herrschen, können sie dort im Verlauf der Kontrollen sehr viel besser nachgewiesen werden als bei freier Suche. Die Reptilienbretter sind insbesondere für den Nachweis von Schlangen und Blindschleichen geeignet, die sich darunter verstecken. An kühleren Tagen mit wenig Sonneneinstrahlung werden die Pappen auch als Sonnenplatz von Eidechsenarten genutzt. BÖF 15
Reptilien Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Abb. 4-1: Beispielhafte Darstellung zum Einsatz künstlicher Verstecke bzw. Reptilienbretter Insgesamt wurden 10 künstliche Verstecke am 23.07.2020 an für Reptilien geeigneten Stellen ausgebracht. Es wurde darauf geachtet, dass es sich bei den ausgewählten Standorten um teilweise besonnte Plätze handelte, sodass sich die Bretter bei Sonneneinstrahlung erwärmen konnten, aber nicht zu stark aufheizten. Die Lage der Reptilienbretter wurden dokumentiert und der Standort mittels GPS-Gerät eingemessen. In Karte 2 ist die Lage der künstlichen Ver- stecke dargestellt. An insgesamt 5 Terminen wurden die Bretter tagsüber, bei günstigen Wetterbedingungen, auf Reptilien kontrolliert (s. Tab. 4-1). An denselben Tagen inkl. des Termins zum Ausbringen der Reptilienbretter, fand auch das gezielte Absuchen von Strukturen, die sich als Versteck eig- nen, statt. Aufgrund des späten Erhebungsbeginns im Jahr konnten keine Begehungen im Zeitraum April bis Juni durchgeführt werden. Tab. 4-1: Erfassungstage Reptilien Nr. Datum Uhrzeit Wetterbedingungen 1 23.07.2020 09:45 Uhr – 14:45 Uhr 17,0°C - 24,0°C, klar, kein Niederschlag 2 05.08.2020 10:00 Uhr – 12:00 Uhr 18,0°C - 23,0°C, klar, kein Niederschlag 3 12.08.2020 10:30 Uhr – 12:30 Uhr 26,0°C, bewölkt, kein Niederschlag 4 24.08.2020 16:30 Uhr – 18:30 Uhr 21,0°C, bewölkt, kein Niederschlag 5 04.09.2020 12:00 Uhr – 14:00 Uhr 21,0°C, leicht bewölkt, kein Niederschlag 6 09.09.2020 16:30 Uhr – 17:00 Uhr 24,0°C, leicht bewölkt, kein Niederschlag 16 BÖF
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Reptilien 4.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG Insgesamt konnten drei Reptilien-Arten im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden (s. Tab. 4-2). Dabei handelte es sich im Bereich der westlichen Teilfläche des Geltungsbereichs (A) um mehrere Nachweise der Zauneidechse, im Bereich der östlichen Teilfläche des Geltungsbe- reichs (B) ebenfalls um mehrere Nachweise der Zauneidechse sowie der Ringelnatter und einer Waldeidechse. Im Bereich der Potenzialfläche konnten auch mehrere Individuen der Zauneidechse erfasst werden. Mit der Zauneidechse wurde eine besonders planungsrele- vante Reptilien-Art im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Bei Ringelnatter und Waldeidechse handelt es sich um allgemein planungsrelevante Arten. Tab. 4-2: Nachgewiesene Reptilien-Arten Wiss. Artname Dt. Artname RL He1 RL D2 FFH-Anh. BNatSchG Natrix natrix Ringelnatter V V - X Lacerta agilis Zauneidechse * V IV X Zootoca vivipara Waldeidechse * * - X 1Rote Liste Hessen (AGAR & FENA 2010); 2Rote Liste Deutschland (KÜHNEL et. al 2009); V = Vorwarnliste, * = ungefährdet; FFH-Anh. IV = streng zu schützende Arten von gemeinschaftlichem Interesse; BNatSchG = ge- schützt nach der Bundesartenschutzverordnung Die westliche Teilfläche (A) wird überwiegend von extensiv genutzten Mähwiesen bestimmt. Im westlichen Teil findet sich ein Wechsel zwischen hoch- und niedrigwüchsigen Vegetations- strukturen. Vereinzelt wächst dort Weißdorn und stellenweise zeigt sich ein starkes Auftreten von jungen Pappeln. In diesen Bereichen findet deshalb eine zunehmende Verbuschung statt. In den westlichen Randbereichen der Fläche finden sich außerdem Übergänge zu Heiden und Heidebereichen mit baumfreien Zwergstrauchheiden. Der östliche Teil besteht aus einer Ru- deralfläche. Außerdem befinden sich auf der Fläche Überreste der alten militärischen Nutzung u.a. ein alter Wachturm, weitere kleine Gebäude und verschiedene befestigte Flächen. Dazwi- schen konnten sich weitere kleine Heidebestände entwickeln. Bei der östlichen Teilfläche (B) handelt es sich überwiegend um eine homogene und blüten- reiche, magere Flachland-Mähwiese. Die Obergrasschicht des Glatthafers ist dabei sehr lückig ausgeprägt. Insgesamt handelt es sich bei der mageren Flachland-Mähwiese um eine arten- reiche, extensiv bewirtschaftete Mähwiese. In den Randbereichen dominieren ausdauernde Ruderalfluren trockenwarmer Standorte. Insbesondere in den Schuttwallbereichen gibt es Übergänge von kurzlebigen Pioniergesellschaften. Insgesamt sind diese Bereiche dicht und hoch bewachsen. Bei der Potenzialfläche handelt es sich um ein extensiv genutztes Biotop mit Vegetation ma- gerer Standorte. Reptilien finden hier viele offene, mit lockerem Boden ausgestattete Bereiche, in denen sie sich sonnen oder die Flächen zur Eiablage nutzen können. Zusätzlich gibt es auch dichter bewachsene Bereiche mit Gehölzen sowie Ruderalvegetation und viele Struktu- relemente, wie zum Beispiel Altgras oder aufgeschichtete Steinhaufen, die ebenfalls zur Aus- stattung eines optimalen Reptilienhabitats zählen. BÖF 17
Reptilien Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
Bei allen drei Untersuchungsflächen (westlicher Teilgeltungsbereich (A), östlicher Teilgel-
tungsbereich (B) und Potenzialfläche) handelt es sich um hochwertige Reptilienhabitate.
Tab. 4-3: Nachweise Reptilien-Arten in den Untersuchungsflächen
Reptilienbrett Erfassungstage (Datum)
Flächen
Nr. 23.07.2020 05.08.2020 12.08.2020 24.08.2020 04.09.2020 09.09.2020
2
Probefläche
3
westliche
5 1 ZE (j)
9
(A)
keine Nachweise
keine Nachweise
10 1 ZE
1
Probefläche
4 1 ZE (j)
östliche
6 1 RN (Haut) 2 RN (j)
7
(B)
8 1 RN (j)
westliche Probefläche (A) 1 ZE (j)
östliche Probefläche (B) 2 ZE, 1 WE 4 ZE (j)
Potenzialfläche 4 ZE
Abkürzungen: ZE = Zauneidechse, WE = Waldeidechse, RN = Ringelnatter; j = Jungtier aus 2020
Von der Ringelnatter konnten am 24.08.2020 mehrere Individuen in der östlichen Probefläche
(B) erfasst werden. Zum einen befanden sich 2 Tiere unter dem Reptilienbrett Nr. 6 und zum
anderen ein einzelnes Tier unter dem Reptilienbrett Nr. 8. Bei allen drei Individuen handelte
es sich um Jungtiere aus 2020, d.h. im Untersuchungsgebiet findet eine Reproduktion der Art
statt. Im Vorfeld konnte bereits am 05.08.2020 eine Ringelnatter-Haut im Bereich des Reptili-
enbretts Nr. 6 entdeckt werden. Für die westliche Probefläche (A) und die Potenzialfläche
konnten keine Nachweise der Ringelnatter erbracht werden.
Von der Zauneidechse konnten in allen drei Untersuchungsflächen, z.T. an verschiedenen
Terminen, mehrere Individuen nachgewiesen werden. Bei der ersten Begehung am
23.07.2020 konnten als Zufallsfund in der östlichen Probefläche (B) bereits zwei adulte Indivi-
duen gesichtet werden. Im Bereich der Potenzialfläche wurden an diesem Termin außerdem
noch vier adulte Individuen erfasst. Am darauffolgenden Termin am 05.08.2020 fand sich ein
weiteres adultes Tier im Bereich des Reptilienbretts Nr. 10 in der westlichen Probefläche (A).
Am 24.08.2020 wurde ebenfalls in dieser Fläche als Zufallsfund ein diesjähriges Jungtier ge-
sichtet. Demnach konnte auch für diese Art ein Reproduktionsnachweis erbracht werden.
Während der letzten Begehung wurden noch einmal zwei Jungtiere jeweils im Bereich der
Reptilienbretter Nr. 4 und 5 gefunden. Durch die Beobachtung entlang geeigneter Habitatstruk-
turen konnten in der westlichen Probefläche (B) weitere 4 Jungtiere des Jahres 2020 im Um-
feld des Reptilienbretts Nr. 1 festgestellt werden.
Für die Waldeidechse wurde ein Nachweis am 23.07.2020 erbracht, indem das Individuum
im Rahmen der Sichtbeobachtungen in der östlichen Probefläche (B) beobachtet werden
konnte. Weitere Tiere wurden nicht erfasst.
An den beiden Terminen 12.08.2020 und 04.09.2020 wurden keine Reptilien erfasst.
18 BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Reptilien
Abb. 4-2: Zauneidechsenhabitat am Rand des östlichen Teilgeltungsbereichs (B) mit Reptilien-
brett Nr. 6
Abb. 4-3: Bereiche des Zauneidechsenhabitats am Rand des östlichen Teilgeltungsbereichs (B)
BÖF 19Reptilien Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Insgesamt handelt es sich bei den drei untersuchten Flächen um hochwertige Reptilienhabi- tate, was durch das Vorkommen mehrerer Reptilien-Arten belegt ist. Diese Aussage gilt trotz des späten Beginns der Erhebungen. Die Ringelnatter konnte zwar lediglich in der östlichen Probefläche nachgewiesen werden, da es sich aber um mehrere Individuen handelte, und sogar Jungtiere des Jahres 2020 festge- stellt werden konnten, ist von einer Verbreitung im gesamten Bereich der drei Untersuchungs- flächen auszugehen. Alle drei Untersuchungsflächen weisen geeignete Strukturen auf, die ein Vorkommen der Ringelnatter ermöglichen, weshalb auch für die westliche Probefläche sowie für die Potenzialfläche von einer Besiedlung durch die Art auszugehen ist. Für die Zauneidechse konnten die meisten Nachweise erbracht werden, auch für diese Repti- lien-Art wurden mehrere Individuen und Jungtiere aus 2020 festgestellt. Alle drei Untersuchungsflächen weisen aufgrund ihrer Ausstattung eine sehr hohe Habitateig- nung für Zauneidechsen auf. Vor allem in den Randbereichen der Probeflächen und in der Potenzialfläche finden sich geeignete Strukturen wie Ruderalfluren, Bereiche mit Altgras, Ge- hölze und aufgeschichtete Steinhaufen. Die erbrachten Nachweise bestätigen eine Reproduk- tion und das Vorkommen der Art in gesamten Bereich der drei Untersuchungsflächen und vermutlich auch im weiteren Umfeld. Bei der Waldeidechse handelt es sich um einen Einzelfund. Es kann angenommen werden, dass die Art die Untersuchungsflächen sporadisch aufsucht, aber vorrangig in den angrenzen- den Waldbereichen vorkommt bzw. deren Randstrukturen als Habitat besiedelt. Artenschutzrechtliche Hinweise Die Zauneidechse ist im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführt und damit eine streng ge- schützte Art. Durch die geplante Errichtung von zwei Photovoltaik-Anlagen werden für die Zau- neidechse und weitere Reptilienarten wertvolle Habitate beansprucht. Das bedeutet zum einen den Verlust von Lebensraum und zum anderen besteht die Gefahr der Tötung von Individuen während der Bauarbeiten. Der Eingriff in die betreffenden Bereiche ist daher grundsätzlich auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Derzeit sind keine Eingriffe in die Gehölz- und Waldbestände geplant, sodass in diesen Berei- chen keine Beeinträchtigungen durch das Vorhaben für die vorkommenden Reptilienarten zu erwarten sind. Durch das Aufstellen der PV-Module ist von einer anlagebedingten Beeinträchtigung der Reptilien-Habitate im Bereich der extensiven Wiesen auszugehen. Zum einen gehen Flächen verloren und zum anderen führt die Beschattung zu einer Veränderung der Vegetationsstruk- turen. In den beschatteten Bereichen kommt es zu Veränderungen des Mikroklimas, Tempe- raturunterschieden und Änderungen im Feuchtegehalt des Bodens, weshalb die Pflanzenviel- 20 BÖF
Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Reptilien falt im Bereich der PV-Module abnehmen wird und somit auch die Anzahl und Vielfalt an In- sekten, die den Reptilien als Nahrungsgrundlage dienen. Es ist für die Reptilien daher eine Reduzierung der Habitatqualität anzunehmen. Um für die Reptilien im direkten Umfeld eine Habitataufwertung zu erreichen, sollte im nahen Umfeld bzw. in den verbleibenden Restflächen um die Photovoltaik-Anlagen Totholz- und/oder Steinhaufen angelegt werden. Mit der Neuanlage solcher Habitatelemente können die verblie- benen Bereiche aufgewertet und eine Wiederbesiedelung durch die nachgewiesenen Arten gefördert werden. Die nicht bebauten Randbereiche der Teilflächen sollten möglichst als extensiv genutzte Bio- tope mit Vegetation magerer Standorte erhalten bzw. aufgewertet und gepflegt werden. Güns- tig auf die Habitateignung für die Reptilien würde ich auswirken, wenn zwischen den Modul- reihen besonnte Streifen verblieben. Durch die notwendigen Bauarbeiten zur Aufstellung der PV-Module ist von einer baubeding- ten Beeinträchtigung der Reptilien-Habitate auszugehen. Um die Tötung von Individuen während der Errichtung der Photovoltaik-Anlagen zu vermeiden, sollten die Bauarbeiten möglichst während der Aktivitätsphase der Reptilien durchgeführt wer- den, wenn die Tiere aufgrund ihrer Mobilität den Baufahrzeugen ausweichen können (je nach Witterung ab etwa Mitte April, bei einer Tagestemperatur > 15 °C). Das Befahren der Fläche sowie die Eingriffe in den Boden durch das Aufstellen der Module sollten hierbei auf ein abso- lutes Minimum reduziert werden. Für die Anlage einer Baustraße ist es notwendig, die hierfür beanspruchte Fläche unmittelbar vor Beginn der Bautätigkeit nach Reptilien abzusuchen. Zu- dem sollte die gesamte Baumaßnahme durch eine ökologische Baubegleitung begleitet wer- den. Betriebsbedingt sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Reptilien abzuleiten, da durch den Betrieb der Photovoltaik-Anlagen keine Licht- und Lärmemissionen entstehen. BÖF 21
Tagfalter Energiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“
5 TAGFALTER
Unter dem Namen Tagfalter werden Schmetterlinge aus verschiedenen Familien, die haupt-
sächlich tagsüber fliegen, zusammengefasst. Die Tagfalter im engeren Sinne bilden aber nur
eine Gruppe von Familien, die tatsächlich alle nahe miteinander verwandt sind. Die Widder-
chen gehören zu den Nachtfaltern. Da sie jedoch tagsüber fliegen, werden sie bei den Erfas-
sungen der Tagfalter mitberücksichtigt.
5.1 METHODIK
Bei den Untersuchungsflächen handelt es sich überwiegend um durch Grünland geprägte
Standorte mit artenreicher Vegetation magerer Standorte, bei denen es sich nach einer ersten
Einschätzung um potenziell geeignete Lebensräume für Tagfalter handelte.
Die Erfassung der Tagfalter fand mittels Sichtbeobachtung in den drei Untersuchungsflächen
(Teilgeltungsbereich A und B, Potenzialfläche) statt. In Karte 3 ist die Lage des östlichen und
westlichen Teilgeltungsbereichs sowie der Potenzialfläche dargestellt. Es erfolgte bei der Er-
fassung dieser Artengruppe kein Kescherfang der Falter, sondern lediglich Sichtbeobachtun-
gen, die teilweise durch den Einsatz eines Fernglases unterstützt wurden. In den festgelegten
Untersuchungsflächen wurde das gesamte Artenspektrum aus der Gruppe der Tagfalter inkl.
der Widderchen erfasst.
Die Erfassung in den Untersuchungsflächen erfolgte an zwei Terminen im Sommer 2020
(s. Tab. 5-1). Die Begehungen fanden an überwiegend sonnigen, warmen und windarmen
Tagen (> 18°C) statt (vgl. HERMANN 1992). Aufgrund des späten Erhebungsbeginns im Jahr
wurden für die Artgruppe Tagfalter deutlich weniger Begehungen im Gelände durchgeführt,
als normalerweise erforderlich und die Erfassungen konnten erst ab der zweiten Hälfte der
Vegetationsperiode beginnen. Damit liegen keine gesicherten Daten zu früh im Jahr fliegenden
Arten vor. Das Vorgehen wurde im Vorfeld mit der Unteren Naturschutzbehörde abgestimmt.
Tab. 5-1: Erfassungstage Tagfalter
Nr. Datum Uhrzeit Wetterbedingungen
1 23.07.2020 09:30 Uhr – 14:00 Uhr 17,0°C - 24,0°C, klar, kein Niederschlag
2 11.08.2020 09:15 Uhr – 13:45 Uhr 24,0°C - 32,0°C, klar, kein Niederschlag
Methodische Schwierigkeiten:
Schmetterlinge weisen, wie viele andere Insektengruppen auch, von Jahr zu Jahr große Po-
pulationsschwankungen auf, sodass im Rahmen einer einjährigen Untersuchung das Arten-
spektrum der einzelnen Untersuchungsflächen in der Regel nicht vollständig erfasst werden
kann (vgl. u.a. EBERT & RENNWALD 1991).
22 BÖFEnergiepark „Ehemaliges Munitionsdepot“ Tagfalter
5.2 ERGEBNISSE UND BEWERTUNG
Bei der Erfassung der Tagfalter und Widderchen konnten für die drei Untersuchungsflächen
insgesamt 22 Arten nachgewiesen werden. Alle nachgewiesenen Tagfalter sind in Tab. 5-2
aufgeführt. Die jeweiligen Vorkommen in den Untersuchungsflächen sind der Tab. 5-3 und der
Karte 3 zu entnehmen. Unter den erfassten Arten befanden sich keine europarechtlich ge-
schützten Arten. Das erfasste Artenspektrum umfasst größtenteils weiter verbreitete, soge-
nannte „Allerweltsarten“. Die Falterfauna des Untersuchungsraumes kann mit 22 erfassten
Schmetterlingsarten an lediglich zwei Terminen, als relativ artenreich eingestuft werden. Er-
wartungsgemäß kommt ein hoher Anteil an Ubiquisten vor (vgl. W EIDEMANN 1995 oder ERNST
& STRECK 2003).
Unter den erfassten Arten befinden sich vier Arten, die nach den Roten Listen der Vorwarnliste
eingestuft werden. Es handelt sich dabei um Kaisermantel, Mauerfuchs, Senfweißling und Ge-
meines Blutströpfchen. Kaisermantel, Kleines Wiesenvögelchen, Hauhechel-Bläuling und Ge-
meines Blutströpfchen sind nach der BArtSchV besonders geschützt.
Tab. 5-2: Nachgewiesene Tagfalter-Arten
RL RL RL
Wiss. Artname Dt. Artname RP Kas- Deutsch- BArtSchV
sel Hessen land
Aglais io Tagpfauenauge + + -
Aglais urticae Kleiner Fuchs + + -
Aphantopus hyperantus Schornsteinfeger + + -
Araschnia levana Landkärtchen + + -
Argynnis paphia Kaisermantel V V - §
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen + + - §
Gonepteryx rhamni Zitronenfalter + + -
Issoria lathonia Kleiner Perlmutterfalter + + -
Lassiommata megera Mauerfuchs V V -
Leptidea sinapis/reali Senfweißling V V -
Maniola jurtina Großes Ochsenauge + + -
Melanargia galathea Schachbrettfalter + + -
Pararge aegeria Waldbrettspiel + + -
Pieris brassicae Großer Kohlweißling + + -
Pieris napi Rapsweißling + + -
Pieris rapae Kleiner Kohlweißling + + -
Polygonia c-album C-Falter + + -
Polyommatus icarus Hauhechel-Bläuling + + - §
Schwarzkolbiger
Thymelicus lineola + + -
Braun-Dickkopffalter
Braunkolbiger
Tymelicus sylvestris + + -
Braun-Dickkopffalter
Vanessa atalanta Admiral + + -
Zygaena filipendulae Gemeines Blutströpfchen V V - §
RL RP Kassel/RL Hessen: + = Im Bezugsraum ungefährdet, V = Vorwarnliste, zurückgehende Art nach LANGE &
BROCKMANN 2009, ZUB et al. (1996), Rote Liste Deutschland: Reinhardt & Bolz 2011, BArtSchV: § = besonders
geschützt
BÖF 23Sie können auch lesen