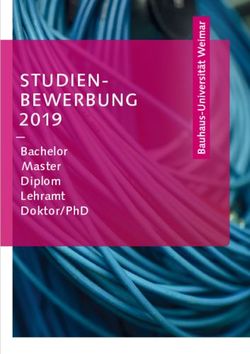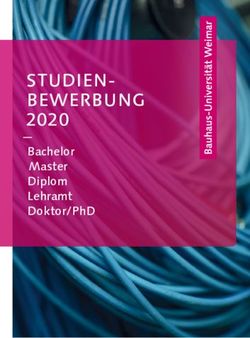Erziehungswissenschaft - 1- Fach (Reakk 2020) Bachelor - Beschreibung des Studiengangs - Datum: 2021-09-28 Auszug!
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Modulhandbuch
Beschreibung des Studiengangs
Erziehungswissenschaft - 1-
Fach (Reakk 2020)
Bachelor
Datum: 2021-09-28
Auszug!Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Erziehungswissenschaft
(Reakkr. 2020) - B1a: Einführung in die Erziehungswissenschaft 1
(Reakkr. 2020) - B2: Didaktik 3
(Reakkr. 2020) - B3a: Pädagogisches Handeln 5
(Reakkr. 2020) - B4a: Pädagogische Berufsfelder 7
(Reakkr. 2020) - B5: Forschungsmethoden I 9
(Reakkr. 2020) - A1: Forschungsmethoden II 11
(Reakkr. 2020) - A2: Historische und Vergleichende Bildungsforschung 13
(Reakkr. 2020) - A3: Beratung und pädagogisches Handeln in Organisationen 15
(Reakkr. 2020) - A4: Weiterbildung und Lebenslanges Lernen 17
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
(Reakkr. 2020) - B: Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse 19
(Reakkr. 2020) - A1a: Bedingungen des Lehrens und Lernens 21
(Reakkr. 2020) - A1b: Bedingungen des Lehrens und Lernens 23
(Reakkr. 2020) - A2a: Entwicklung und Erziehung 25
(Reakkr. 2020) - A2b: Entwicklung und Erziehung 27
(Reakkr. 2020) - A3a: Persönlichkeit und Leistung 29
(Reakkr. 2020) - A3b: Persönlichkeit und Leistung 31
(Reakkr. 2020) - B1: Grundlagen der Soziologie 33
(Reakkr. 2020) - A1: Erwerbsarbeit in der modernen Gesellschaft 35
(Reakkr. 2020) - A2: Arbeit und Organisation im Wandel 37
Abschlussmodul - Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz
(Reakkr. 2020) - ABA: Erziehungswissenschaftliche Forschungskompetenz 39
Praktika
(Reakkr. 2020) - Praktikum Erziehungswissenschaft 41
Profilbereich
(Reakkr. 2020) - BW: Einführung in die Bildungswissenschaften 43
(Reakkr. 2020) Profilmodul 1: Diversität 45
(Reakkr. 2020) Profilmodul 2: Digitalisierung 47
(Reakkr. 2020) Profilmodul 3: Bildung für nachhaltige Entwicklung 49
(Reakkr. 2020) Profilmodul 4: Gesellschaft und Arbeitswelt 50
(Reakkr. 2020) Profilmodul 5: Sprachen 52
(Reakkr. 2020) Profilmodul 6: DaF/DaZ 53Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1. Erziehungswissenschaft
1.1. (Reakkr. 2020) - B1a: Einführung in die Erziehungswissenschaft
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B1a: Einführung in die Erziehungswissenschaft GE-EWS-62
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft B1a
Workload: 360 h Präsenzzeit: 120 h Semester: 1
Leistungspunkte: 12 Selbststudium: 240 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 8
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Wissenschaftliches Arbeiten in der Erziehungswissenschaft (B1a) (S)
Wissenschaftliches Arbeiten in der Erziehungswissenschaft (B1a) (S)
Einführung in die Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (V)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
a) Vorlesung: Einführung in die Erziehungswissenschaft (WiSe)
Einführung in die Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (V)
b) Begleitseminar: Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe und Vertiefung (WiSe)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für höhere Fachsemester) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (B)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für Erstsemester-Studierende) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für höhere Fachsemester) (B)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (S)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für höhere Fachsemester) (B)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (S)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für Erstsemester-Studierende) (S)
c) Grundlagenseminar: wissenschaftliches Arbeiten (WiSe oder SoSe)
Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe (B1) (für Erstsemester-Studierende) (S)
Begleitseminar: Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft (B1/B1a/B1b) (B)
d) Vertiefungsseminar: Einführung in die Erziehungswissenschaft: Grundbegriffe und Vertiefung (SoSe)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (WiSe)
b) Begleitseminar (WiSe)
c) Grundlagenseminar wiss. Arbeiten (WiSe oder SoSe)
d) Vertiefungsseminar (SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA EZW (1. und 2. Fach): (1-2)
Lehrende:
Prof. Dr. Kerstin Jergus
apl. Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk
Dr. Peter Dietrich
Caroline Gröschner
Dr. Elija Horn
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Lara Gottfried
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- sind in der Lage, die Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft, Bildung, Erziehung und Sozialisation zu definieren.
Seite 1 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
- können Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationstheorien unterscheiden und in ihren historischen Kontexten verorten.
- können gesellschaftliche, politische und institutionelle Rahmenbedingungen von Bildung, Erziehung und Sozialisation
mit Hilfe einschlägiger Theorien beschreiben.
- sind in der Lage, Herausforderungen und Umgangsweisen mit sozialer und kultureller Heterogenität zu benennen und
zu diskutieren.
- können die empirischen Voraussetzungen und historisch-kulturellen Bedingungen von Bildung, Erziehung und
Sozialisation erläutern.
- erwerben ein Verständnis der Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens und können dieses Wissen auf ihre eigenen
Studienarbeiten übertragen.
Inhalte:
- Einführung in die Grundbegriffe der Erziehungswissenschaft und deren Grundrichtungen
- Geschichte der Erziehungswissenschaft
- Aktuelle Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft
- Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten in der Erziehungswissenschaft
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: angeleitete Hausarbeit (ca. 10 Seiten) oder mündliche Prüfung (30-45 min) oder Klausur (90 min) als Modulprüfung
(PL = 3 CP), im SoSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Kerstin Jergus
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Koller, H.-C. (2008). Grundbegriffe, Theorien und Methoden der Erziehungswissenschaft. Stuttgart: Kohlhammer.
- Dörpinghaus, A., & Uphoff, I. K. (2015). Grundbegriffe der Pädagogik (4. Aufl.). Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft.
- Schäfer, A. (2005). Einführung in die Erziehungsphilosophie. Weinheim, Basel: Beltz.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 2 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.2. (Reakkr. 2020) - B2: Didaktik
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B2: Didaktik GE-EWS-64
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft B2
Workload: 180 h Präsenzzeit: 60 h Semester: 2
Leistungspunkte: 6 Selbststudium: 120 h Anzahl Semester: 1
Pflichtform: Pflicht SWS: 4
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
a) Vorlesung: Allgemeine Didaktik (SoSe)
b) Seminar: Didaktische Modelle und Konzepte (SoSe)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (SoSe)
b) Seminar (SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA EZW (1. und 2. Fach): (1-2) / 2-F-BA BW: (2)
Lehrende:
Prof. Dr. Stefanie Hartz
Prof. Dr. Katja Koch
apl. Prof. Dr. Dietlinde Vanier
apl. Prof. Dr. Gabriele Graube
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Virginia Penrose
Dr. Barbara Zschiesche
Dr. Lara Gottfried
Iris Höltje
Andreas Richter
N.N. (Dozent Schulentwicklungsforschung)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- beschreiben didaktische Denktraditionen und Modelle, können diese voneinander abgrenzen und deren Relevanz für
aktuelle Lehr-Lern-Kontexte und für Schul- und Organisationsentwicklungsprozesse bestimmen.
- erläutern, welche Vorgaben, Voraussetzungen und Gestaltungsaspekte bei der Planung, Durchführung und Reflexion
von Lehr-Lern-Interaktionen auch in heterogenen Lerngruppen zu beachten sind.
- können Methoden der Förderung selbstbestimmten, eigenverantwortlichen, kooperativen und medialen Lernens und
Arbeitens beschreiben und ihre Möglichkeiten und Grenzen in schulischen und außerschulischen Lehr-Lern-Settings
diskutieren.
- analysieren didaktisches Handeln in institutionellen Zusammenhängen anhand von Fallbeispielen.
Inhalte:
- Entstehung und Ausdifferenzierung von Didaktik als Wissenschaft
- Kontexte didaktischen Denkens und Begriffsbildung im historischen und aktuellen Diskurs (u.a. Digitalisierung)
- Reflexion didaktischer Modelle im Hinblick auf Schul- und Organisationsenticklung
- Planung, Durchführung und Reflexion von Lehr-Lern-Interaktionen unter den Bedingungen von Heterogenität
- Didaktische Modelle und Erklärungsansätze zur Wirksamkeit von Lehr-Lern-Settings in schulischen und
außerschulischen Kontexten
- Studien zur Deutung von Lehr-Lern-Interaktion
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
(a) PL: Klausur (1 Std.) im 2-Fächer-BA Bildungswissenschaften als Modulprüfung (PL = 2 CP), im SoSe.
(b) SL: Klausur (1 Std.) im 1-Fach-BA EZW und 2-Fächer-BA Erst- oder Zweitfach EZW als Modulprüfung (SL = 2 CP), im
SoSe.
Turnus (Beginn):
jährlich Sommersemester
Modulverantwortliche(r):
N.N. (Dozent Schulentwicklungsforschung)
Seite 3 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Kron, Friedrich W. (2014). Grundwissen Didaktik ( 6. überarb. Aufl.). München: Reinhardt/UTB.
- Terhart, Ewald (2009). Didaktik. Eine Einführung. Stuttgart: Reclam.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 4 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.3. (Reakkr. 2020) - B3a: Pädagogisches Handeln
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B3a: Pädagogisches Handeln GE-EWS-65
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft B3a
Workload: 270 h Präsenzzeit: 60 h Semester: 1
Leistungspunkte: 9 Selbststudium: 210 h Anzahl Semester: 1
Pflichtform: Pflicht SWS: 4
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Einführung in das pädagogische Handeln (B3) (V)
Professionelles Handeln im Kontext digitalisierungsbezogener Schulentwicklungsprozesse erforschen (B3/B3a/B3b)
(B)
Didaktische Herausforderungen mit digitalen Medien (B3/B3a/B3b) (S)
Pädagogisches Handeln in einer digitalisierten Welt (B3/B3a/B3b) (S)
Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung & Digitalität (B3/B3a/B3b) (S)
Blended Learning (B3/B3a/B3b) (S)
Erziehungswissenschaftliche Reflexion digitaler Spiel- und Lernräume (2 SWS-Seminar) (B3/B3a/B3b) (B)
Erziehungswissenschaftliche Reflexion digitaler Spiel- und Lernräume (B3/B3a/B3b) (S)
Dinge und pädagogisches Handeln (B3/B3a/B3b) (S)
Kinder und Jugendliche begleiten (B3/B3a/B3b) (S)
a) Vorlesung: Einführung in das pädagogische Handeln (WiSe)
Lernen-Lehren-Medien (B3) (V)
b) Seminar: Vertiefung von Grundformen pädagogischen Handelns (WiSe)
Lernen mit und Lernen über digitale Medien (B3) (S)
Heterogenität in der Hochschule (B3) (B)
Pädagogisches Handeln zwischen Medienbildung vs. Mediendidaktik - Perspektiven auf Konstruktionstätigkeit in der
Erfinderwerkstatt (B3) (S)
Medienkompetenz (B3) (S)
Lehren und Lernen im digitalen Zeitalter (B3) (B)
Erziehungswissenschaftliche Reflexion digitaler Spiel- und Lernräume (B3) (S)
Pädagogik in digitalen Spielen (B3) (S)
Didaktische Herausforderungen mit digitalen Medien (B3) (B)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (WiSe)
b) Seminar (WiSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (1) / 2-F-BA Zweitfach EZW: (3)
Lehrende:
Prof. Dr. Katja Koch
Prof. Dr. Stefanie Hartz
apl. Prof. Dr. Dietlinde Vanier
apl. Prof. Dr. Gabriele Graube
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Lara Gottfried
Prof. Dr. Kerstin Jergus
apl. Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk
Dr. Peter Dietrich
Caroline Gröschner
Dr. Oliver Hormann
Dr. Barbara Zschiesche
Dr. Virginia Penrose
Tina von Dapper-Saalfels
Iris Höltje
Andreas Richter
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- benennen und bestimmen den Begriff Pädagogisches Handeln und können diesen im Hinblick auf aktuelle
Herausforderungen der Pädagogik (wie Heterogenität, Digitalisierung, etc.) theoretisch reflektieren.
- benennen und beschreiben aktuelle Theorieentwicklung und Forschung zu den Grundformen pädagogischen Handelns,
insbesondere Vermitteln/Unterrichten/Lehren, Beraten, Entwickeln/Evaluieren, Diagnostizieren/Bewerten, Erziehen.
Seite 5 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
- verstehen einschlägige Begriffe und Theorien, indem sie sie fachsprachlich und kontextuell sicher erläutern können.
- vertiefen einzelne Grundformen pädagogischen Handelns und wenden diese an, indem sie den Einsatz von Medien
bzw. Fragen der Heterogenität vor dem Hintergrund aktueller Forschungsbefunde und Theoriekonzepte diskutieren
können.
- vollziehen einen Perspektivwechsel von der Lernendenrolle zur Rolle als pädagogisch Handelnde, indem sie das eigene
Bild von sich als pädagogisch Handelnde systematisch reflektieren.
Inhalte:
- Aktuelle Theorieentwicklung und Forschung zu pädagogischem Handeln
- Aktuelle Theorieentwicklung und Forschung zu den Grundformen pädagogischen Handelns:
Vermitteln/Unterrichten/Lehren, Beraten, Entwickeln/Evaluieren, Diagnostizieren/Bewerten, Erziehen
- Grundformen pädagogischen Handelns vor dem Hintergrund aktueller Herausforderungen der Pädagogik wie
beispielsweise Einsatz von Medien oder Umgang mit Heterogenität
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: selbstständige Hausarbeit (12-13 Seiten) oder
angeleitetes, selbstständiges Projekt mit Präsentation oder Projektbericht (5-10 min oder ca. 10 Seiten) als Modulprüfung
(PL = 5 CP), im WiSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen:
für 1-Fach-Bachelor EZW und 2-Fächer-Bachelor Erstfach EZW: keine;
für 2-Fächer-Bachelor Zweitfach EZW: erfolgreicher Abschluss B1a oder B2
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Katja Koch
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Helsper, W., & Combe, A. (Hrsg.) (1996). Pädagogische Professionalität. Frankfurt/M.: Suhrkamp.
- Giesecke, H. (2015). Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns (12. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Koller, H.-C., Casale, N., & Ricken, N. (Hrsg.) (2014). Heterogenität. Zur Konjunktur eines pädagogischen Konzepts.
Paderborn: Schöningh.
- Krüger, H.-H., & Helsper W. (Hrsg.) (2010). Einführung in Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft
(9. Aufl.). Basel: Verlag Barbara Budrich.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 6 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.4. (Reakkr. 2020) - B4a: Pädagogische Berufsfelder
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B4a: Pädagogische Berufsfelder GE-EWS-67
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft B4a
Workload: 270 h Präsenzzeit: 60 h Semester: 1
Leistungspunkte: 9 Selbststudium: 210 h Anzahl Semester: 1
Pflichtform: Pflicht SWS: 4
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Berufsfelder außerschulischer Bildung (B4a) (S)
Pädagogische Berufsfelder - Schwerpunkt: Erwachsene (B4a) (S)
Kulturpädagogische Berufsfelder (B4a) (S)
a) Vorlesung: Einführung in das pädagogische Berufsfeld (WiSe)
Einführung in die pädagogischen Berufsfelder (B4) (V)
b) Seminar: Vertiefung einzelner Berufsfelder (WiSe)
Überzeugungen und Werthaltungen von Lehrenden als Teil der professionellen Kompetenz (B4) (EZW) (B)
Mobile Learning - Lerne und Lehre, wann und wo du willst? (B3) (S)
Blended Learning (B3/B3a/B3b) (S)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (WiSe)
b) Seminar (WiSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (1) / 2-F-BA Zweitfach EZW: (5)
Lehrende:
Prof. Dr. Stefanie Hartz
apl. Prof. Dr. Dietlinde Vanier
apl. Prof. Dr. Gabriele Graube
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Lara Gottfried
Prof. Dr. Kerstin Jergus
apl. Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk
Dr. Peter Dietrich
Caroline Gröschner
Dr. Oliver Hormann
Dr. Barbara Zschiesche
Dr. Virginia Penrose
Tina von Dapper-Saalfels
Iris Höltje
Andreas Richter
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- benennen wesentliche pädagogische Berufsfelder und beschreiben ihre Gemeinsamkeiten, Unterschiede und
Besonderheiten u.a. im Hinblick auf ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen.
- erkunden ausgewählte Berufsfelder forschend, indem sie eines systematisch beschreiben.
- verstehen es, die gewonnenen Analyseergebnisse darzustellen, zu präsentieren sowie theorie- und berufsfeldbezogen
zu reflektieren.
Inhalte:
- Pädagogische Berufsfelder und ihre gesellschaftlichen Rahmenbedingungen
- Aktuelle Forschungsdiskurse
- Gemeinsamkeiten, Unterschiede und Besonderheiten pädagogischer Berufsfelder
- Forschendes Lernen in pädagogischen Berufsfeldern
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Seite 7 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: selbstständige Hausarbeit (12-13 Seiten) oder
angeleitetes, selbstständiges Projekt mit Projektbericht (ca. 10 Seiten) als Modulprüfung (PL = 5 CP), im WiSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen:
für 1-Fach-Bachelor EZW und 2-Fächer-Bachelor Erstfach EZW: keine;
für 2-Fächer-Bachelor Zweitfach EZW: erfolgreicher Abschluss B1a oder B2
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Stefanie Hartz
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Krüger, H.-H., & Rauschenbach, T. (Hrsg.) (2012). Einführung in die Arbeitsfelder des Bildungs- und Sozialwesens (5.,
grundlegend erweiterte und aktualisierte Aufl.). Opladen, Toronto: Verlag Barbara Budrich/UTB.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 8 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.5. (Reakkr. 2020) - B5: Forschungsmethoden I
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B5: Forschungsmethoden I GE-EWS-69
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft B5
Workload: 270 h Präsenzzeit: 90 h Semester: 1
Leistungspunkte: 9 Selbststudium: 180 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 6
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Grundlagen der qualitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
Einführung in die Logik und die Methoden der empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (V)
Grundlagen der qualitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
a) Vorlesung/Seminar: Einführung in die empirische Sozial- und Bildungsforschung (WiSe)
Einführung in die Logik und die Methoden der empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
b) Grundlagenseminar: Grundlagen der qualitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (WiSe)
Einführung in die Logik und die Methoden der empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
Einführung in die Logik und die Methoden der empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
Einführung in die Logik und die Methoden der empirischen Sozial- und Bildungsforschung (B5) (S)
c) Vertiefungsseminar: Grundlagen der qualitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (SoSe)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung/Seminar (WiSe)
b) Grundlagenseminar (WiSe)
c) Vertiefungsseminar (SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (1-2) / 2-F-BA Zweitfach EZW (5-6)
Lehrende:
Prof. Dr. Stefanie Hartz
Prof. Dr. Kerstin Jergus
apl. Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk
Dr. Oliver Hormann
Caroline Gröschner
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
N.N. (Dozent Unterrichtsforschung)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- erwerben grundlegende Kenntnisse zu qualitativen und quantitativen erziehungswissenschaftlichen
Forschungsmethoden.
- benennen Typen empirischer Forschung in ihrer Bandbreite (qualitativ und quantitativ, hypothesentestend und
hypothesengenerierend, angewandt und grundlagenorientiert) und bestimmen sie in ihrer Spezifik.
- setzen sich vertiefend mit Grundlagen qualitativer empirischer Forschung auseinander.
- kennen unterschiedliche Instrumente der Datenerhebung qualitativ empirischer Forschung und können interpretative
Verfahren erläutern.
- können qualitative Forschungsdesigns hinsichtlich ihrer Leistungen und Grenzen zur Erforschung sozialer Wirklichkeit
einschätzen.
- entwickeln in Projektteams ein eigenständiges qualitatives Forschungsdesign.
Im Rahmen dessen
- erarbeiten sie eine wissenschaftliche Fragestellung.
- sind sie in der Lage, unterschiedliche Verfahren der qualitativen Datenerhebung anzuwenden.
- können sie Analyseschritte bestimmen und Verfahren der Interpretation begründen.
- konzipieren sie Sequenzen eines Forschungsprozesses weitgehend eigenständig.
- schulen sie ihre Diskursfähigkeit durch die Zusammenarbeit in Projektteams und die reflexive Auseinandersetzung mit
den Anforderungen qualitativer Forschungspraxis.
- sind sie in der Lage, ihre Forschung nach Gütekriterien wissenschaftlicher Forschung kritisch zu beurteilen.
Inhalte:
Einführung in die empirischen Forschungsmethoden:
- Methodologische Grundlagen empirischer Sozialforschung
- Grundkonzepte und Zugängen empirischer erziehungswissenschaftlicher Forschung
- Leistungen und Grenzen verschiedener Verfahren der Datenerhebung und Auswertung
Vertiefende Kenntnis qualitativer Methoden:
- Qualitative Erhebungsinstrumente
Seite 9 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
- Qualitative Auswertungsverfahren
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: angeleitetes Projekt mit Präsentation (10-15 min) als Modulprüfung (PL = 3 CP), im SoSe.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen:
für 1-Fach-Bachelor EZW und 2-Fächer-Bachelor Erstfach EZW: keine;
für 2-Fächer-Bachelor Zweitfach EZW: erfolgreicher Abschluss B1a oder B2
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Stefanie Hartz
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Friebertshäuser, B., Langer, A., & Prengel, A. (Hrsg.) (2010). Handbuch qualitative Forschungsmethoden in der
Erziehungswissenschaft (3., vollst. überarb. Aufl.). Weinheim, München: Juventa.
- Przyborski, A., & Wohlrab-Sahr, M. (2014). Qualitative Sozialforschung. Ein Arbeitsbuch (4., erw. Aufl.). München:
Oldenbourg.
- Kromrey, H., Roose, J., & Strübing, J. (2016). Empirische Sozialforschung. Modelle und
Methoden der standardisierten Datenerhebung und Datenauswertung (13. vollst. überarb. Aufl.). Wiesbaden: UTB.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 10 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.6. (Reakkr. 2020) - A1: Forschungsmethoden II
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - A1: Forschungsmethoden II GE-EWS-70
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft A1
Workload: 270 h Präsenzzeit: 60 h Semester: 3
Leistungspunkte: 9 Selbststudium: 210 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 4
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S)
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik I (A1) (S)
a) Grundlagenseminar: Grundlagen der quantitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (WiSe)
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik II (A1) (S)
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik II (A1) (S)
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik II (A1) (S)
Deskriptive und schließende Statistik: Statistik II (A1) (S)
b) Vertiefungsseminar: Vertiefung der quantitativen empirischen Sozial- und Bildungsforschung (SoSe)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Grundlagenseminar (WiSe)
b) Vertiefungsseminar (SoSe)
c) Übung (fakultativ) (SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW (3-4)
Lehrende:
Dr. Oliver Hormann
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
N.N. (Dozent Unterrichtsforschung)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- können Kriterien des quantitativen Forschungsprozesses benennen und Forschungsergebnisse erläutern.
- sind in der Lage unterschiedliche Instrumente der Datenerhebung quantitativ empirischer Forschung zu vergleichen und
hinsichtlich ihrer Leistungen (und Grenzen) zur Erforschung sozialer Wirklichkeit zu bewerten.
- können im Rahmen eines Projekts eigene empirische quantitative Studien konzipieren, durchführen und kritisch
reflektieren.
In diesem Kontext
- sind sie in der Lage, den Forschungsstand und theoretischen Hintergrund aufzuarbeiten sowie grundlegende
Kenntnisse empirischer Bildungsforschung zu reproduzieren.
- verstehen sie es, eine wissenschaftliche Fragestellung sowie wissenschaftliche Hypothesen zu formulieren.
- begründen sie Forschungsdesigns mit Bezug zum Forschungsproblem inhaltlich und methodisch nachvollziehbar.
- können sie geeignete statistische Auswertungsverfahren selbstständig im Kontext ihres wissenschaftlichen Projektes
auswählen und anwenden.
Inhalte:
Statistik I:
- Vertiefung von Konzeptspezifikation, Operationalisierung und Messung
- Einführung statistischer Grundbegriffe
- Vorstellung verschiedener statistischer Verfahren
- Auswertungsmethoden für ein- und mehrdimensionale Daten
- Ergebnisaufbereitung und Darstellung
Statistik II:
- Auswahl, Durchführung und Interpretation statistischer Tests
- Statistikpaket SPSS
- Grundlagen, Datenaufbereitung und -verwaltung
- Explorative Datenanalysen
Interferenzstatistische Verfahren
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Seite 11 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodaltitäten:
PL: angeleitetes Projekt mit Präsentation (10-15 min) als Modulprüfung (PL = 3 CP), im SoSe.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss B5
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Ulrike Pilarczyk
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Eid, M., Gollwitzer, M., & Schmitt, M. (2017). Statistik und Forschungsmethoden (5., korr. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz.
- Field, A. (2013). Discovering Statistics using IBM SPSS Statistics. Los Angeles: SAGE.
- Urban, D., & Mayerl, J. (2018). Angewandte Regressionsanalyse: Theorie, Technik und Praxis (5. überarb. Aufl.).
Wiesbaden: Springer VS.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 12 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.7. (Reakkr. 2020) - A2: Historische und Vergleichende Bildungsforschung
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - A2: Historische und Vergleichende Bildungsforschung GE-EWS-59
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft A2
Workload: 360 h Präsenzzeit: 90 h Semester: 3
Leistungspunkte: 12 Selbststudium: 270 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 6
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Historische und vergleichende Bildungsforschung (A2) (V)
Schulbuchforschung (A2) (B)
Reformpädagogik (A2) (S)
a) Vorlesung: Historische und Vergleichende Bildungsforschung (WiSe)
Historische und vergleichende Bildungsforschung (A2) (V)
b) Seminar: Themen und Perspektiven der Historischen und Vergleichenden Bildungsforschung (WiSe und SoSe)
Demokratisierung des Bildungssystems: Weimarer Republik und Re-education-Phase nach 1945 (A2) (S)
Kinderrechte und Kinderschutz in internationaler Perspektive (A2) (B)
Helden nach Plan? Erziehungswissenschaftliche Analysen zu Kinderbüchern in der DDR (A2) (B)
Lebensreform als Erziehungsreform (A2) (B)
c) Seminar: Themen und Perspektiven der Historischen und Vergleichenden Bildungsforschung (WiSe und SoSe)
Lebensreform als Erziehungsreform (A2) (B)
Helden nach Plan? Erziehungswissenschaftliche Analysen zu Kinderbüchern in der DDR (A2) (B)
Kinderrechte und Kinderschutz in internationaler Perspektive (A2) (B)
Demokratisierung des Bildungssystems: Weimarer Republik und Re-education-Phase nach 1945 (A2) (S)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (WiSe)
b) Seminar (WiSe und SoSe)
c) Seminar (WiSe und SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (3-4)
Lehrende:
Prof. Dr. Kerstin Jergus
apl. Prof. Dr. Ulrike Pilarczyk
Prof. Dr. Eckhardt Fuchs
Dr. Peter Dietrich
Dr. Elija Horn
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- benennen und erläutern Themen, Fragestellungen und Zugänge der "Historischen und Vergleichenden
Bildungsforschung".
- sind in der Lage, historische Zusammenhänge von Bildungs-, Erziehungs- und Sozialisationsprozessen und deren
Institutionalisierung zu erkennen und zu erläutern.
- können methodische Verfahren der "Historischen und Vergleichenden Bildungsforschung" bestimmen.
- klassifizieren und werten historische Quellen analytisch auf bildungshistorische Fragestellungen hinaus.
- leiten aus Befunden historischer und international vergleichender Bildungsforschung Schlussfolgerungen für aktuelle
Erziehungs- und Bildungssituationen ab.
- sind in der Lage, die kulturellen und gesellschaftspolitischen Rahmenbedingungen von Bildungs-, Erziehungs- und
Sozialisationsprozessen zu beschreiben und im internationalen Vergleich einzuordnen.
Inhalte:
- Einführung in die "Historische und Vergleichende Bildungsforschung"
- Themen, Fragestellungen und Entwicklungstendenzen der "Historischen und Vergleichenden Bildungsforschung" (auch
in transdisziplinärer und internationaler Perspektive)
- Methoden und Paradigmen der "Historischen und Vergleichenden Bildungsforschung"
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Seite 13 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: selbständige Hausarbeit (13-15 Seiten) oder
selbstständiges Projekt mit Projektbericht und Präsentation (15-30 min, ca. 10 Seiten) als Modulprüfung (PL = 6 CP),
WiSe und SoSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss B1a
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Kerstin Jergus
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Parreirra do Amal, M., & Amos, K. (Hrsg.) (2015). Internationale und Vergleichende Erziehungswissenschaft.
Geschichte, Theorie, Methode und Forschungsfelder. Münster, New York: Waxmann.
- Reble, A. (2016). Geschichte der Pädagogik (23. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Schuch, J., Tenorth, H.-E., & Welter, N. (2008). Sozialgeschichte von Bildung und Erziehung Fragestellungen, Quellen
und Methoden der historischen Bildungsforschung. In H. Faulstich-Wieland & P. Faulstich (Hrsg.),
Erziehungswissenschaft. Ein Grundkurs (S. 267-290). Reinbek: Rowohlt.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.))
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 14 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.8. (Reakkr. 2020) - A3: Beratung und pädagogisches Handeln in Organisationen
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - A3: Beratung und pädagogisches Handeln in Organisationen GE-EWS-60
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft A3
Workload: 360 h Präsenzzeit: 90 h Semester: 4
Leistungspunkte: 12 Selbststudium: 270 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 6
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Systemische Beratung (A3) (S)
Beratung bei Konflikten (A3) (S)
a) Vorlesung: Einführung in Beratung und pädagogisches Handeln in Organisationen (SoSe)
Beratung und pädagogisches Handeln in Organisationen (A3) (V)
b) Seminar: Theorien und Ansätze der Beratung und des pädagogischen Handelns in Organisationen (SoSe und WiSe)
Beratung bei Konflikten (A3) (S)
Handlungskompetenzen in Organisationen (A3) (B)
Bildungsberatung (A3) (S)
c) Seminar: Theorien und Ansätze der Beratung und des pädagogischen Handelns in Organisationen (SoSe und WiSe)
Bildungsberatung (A3) (S)
Handlungskompetenzen in Organisationen (A3) (B)
Beratung bei Konflikten (A3) (S)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (SoSe)
b) Seminar (SoSe und WiSe)
c) Seminar (SoSe und WiSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (4-5)
Lehrende:
Prof. Dr. Stefanie Hartz
apl. Prof. Dr. Dietlinde Vanier
apl. Prof. Dr. Gabriele Graube
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Lara Gottfried
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- können verschiedene Beratungsansätze skizzieren.
- erwerben Kenntnisse zur Organisationstheorie und -forschung sowie zu (Interaktions-) Prozessen in Organisationen und
Institutionen.
- können verschiedene (mediale) Beratungsansätze und einzelne Grundformen pädagogischen Handelns in
Organisationen anwenden, analysieren und beurteilen.
- kennen und differenzieren Instrumente zur Steuerung in und von Organisationen im Bildungsbereich.
- können pädagogisches Handeln in Organisationen vor dem Hintergrund ihres Theoriewissens und unter dem Aspekt
pädagogischer Berufsfelder sowie der damit verbundenen Kompetenzprofile analysieren und reflektieren.
- können individuelle und organisationale Beratungssituationen vorbereiten und durchführen und erweitern/festigen
dadurch ihre Kommunikationsfähigkeit, Konfliktkompetenz und Kooperationsfähigkeit.
Inhalte:
- Arten, Formen und Modelle pädagogischer (medialer) Beratung
- Forschungsbefunde zur Beratung und Interaktion in Lehr-Lern-Prozessen
- Grundlagen der Organisationstheorie und -forschung
- Konzepte der Organisationsentwicklung
- Steuerungstheorie, Governanceforschung im Bildungsbereich
- Diversität im Bildungsbereich
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Seite 15 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: selbständige Hausarbeit (13-15 Seiten) oder
selbstständiges Projekt mit Projektbericht und Präsentation (15-30 min, ca. 10 Seiten) als Modulprüfung (PL = 6 CP), im
SoSe und WiSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
- zwingende Zugangsvoraussetzung: erfolgreicher Abschluss B3a
Turnus (Beginn):
jährlich Sommersemester
Modulverantwortliche(r):
Gabriele Graube
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Kieser, A., & Ebers, M. (Hrsg.) (2019). Organisationstheorien (8., erw. und aktualisierte Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Nestmann, F., Engel, F., & Sickendiek, U. (2004/2013). Handbuch der Beratung. Band 1 bis 3. Tübingen: Dgvt-Verlag.
- Göhlich, M., Schröer, A., & Weber, S. M. (2018). Handbuch Organisationspädagogik. Wiesbaden: Springer VS.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 16 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
1.9. (Reakkr. 2020) - A4: Weiterbildung und Lebenslanges Lernen
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - A4: Weiterbildung und Lebenslanges Lernen GE-EWS-61
Institution: Modulabkürzung:
Erziehungswissenschaft A4
Workload: 360 h Präsenzzeit: 90 h Semester: 5
Leistungspunkte: 12 Selbststudium: 270 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Pflicht SWS: 6
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Einführung in die Weiterbildung und das lebenslange Lernen (A4) (V)
Weiterbildung und Medien (A4) (S)
Bedarfsorientierte Angebotsplanung in der Erwachsenen- und Weiterbildung (A4) (S)
a) Vorlesung: Einführung in die Weiterbildung und Lebenslanges Lernen (WiSe)
Einführung in die Weiterbildung und das lebenslange Lernen (A4) (V)
b) Seminar: Organisationen, Arbeitsfelder und Aufgabengebiete in der Weiterbildung (WiSe und SoSe)
Weiterbildung und Medien (A4) (S)
Bedarfsorientierte Angebotsplanung in der Erwachsenen- und Weiterbildung (A4) (S)
Didaktisches Handeln in der Praxis der Erwachsenenbildung. Wie plane und gestalte ich einen Workshop? (A4) (B)
c) Seminar: Organisationen, Arbeitsfelder und Aufgabengebiete in der Weiterbildung (WiSe und SoSe)
Didaktisches Handeln in der Praxis der Erwachsenenbildung. Wie plane und gestalte ich einen Workshop? (A4) (B)
Bedarfsorientierte Angebotsplanung in der Erwachsenen- und Weiterbildung (A4) (S)
Weiterbildung und Medien (A4) (S)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik:
a) Vorlesung (WiSe)
b) Seminar (WiSe und SoSe)
c) Seminar (WiSe und SoSe)
b) Empfohlenes Fachsemester: 1-F-BA EZW+2-F-BA Erstfach EZW: (5-6)
Lehrende:
Prof. Dr. Stefanie Hartz
apl. Prof. Dr. Dietlinde Vanier
apl. Prof. Dr. Gabriele Graube
Dr. Ramona Lorenzen
Dr. Lara Gottfried
N.N. (Dozent Erziehungswissenschaft)
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- benennen aktuelle Forschungs- und Theoriediskurse sowie grundlegende Aspekte des Lehrens und Lernens in der
Weiterbildung resp. im Kontext des Diskurses um Lebenslanges Lernen.
- stellen eine Verbindung von Theorie und Praxis her, indem sie einerseits theoretisches Wissen praktisch anwenden und
andererseits durch Analyse der Praxis weitere Forschungsbedarfe formulieren.
- können verschiedene Organisationen, Arbeitsfelder und Aufgabengebiete der Weiterbildung beschreiben und können
das Feld der Weiterbildung analysieren.
- verfügen über Analyse- und Planungskompetenzen, die sie befähigen, (digitale) Lehr-Lern-Prozesse mit Erwachsenen
vor dem Hintergrund von Theorie- und Forschungsbefunden theoriebegründet und anwendungsorientiert zu planen, zu
gestalten und zu reflektieren/bewerten.
Inhalte:
- Grundbegriffe der Weiterbildung/ des Lebenslangen Lernens
- Forschungslinien und Theoriediskurse der Weiterbildung/des Lebenslangen Lernens
- Institutionen, Arbeitsfelder und Aufgabengebiete
- Zielgruppen, Adressaten und Teilnehmer/erwachsener Lerner
- Formen professionellen Handelns (Planung, Lehre, Beratung und Evaluation) unter Einbezug digitaler Medien
- Handeln im Mehrebenensystem
Lernformen:
Hausaufgaben, Übungen, Referate, Protokolle, Podiumsdiskussionen, Rollenspiele, Videoanalysen, Gruppenarbeiten,
Planspiele, projekt- und forschungsorientierte Lehre, u.Ä. ggf. angereichert um mediale Unterstützung wie Wiki, Forum,
Meeting, etc.
Seite 17 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
PL: selbständige Hausarbeit (13-15 Seiten) oder
selbstständiges Projekt mit Projektbericht und Präsentation (15-30 min, ca. 10 Seiten) als Modulprüfung (PL = 6 CP), im
WiSe und SoSe.
Die Prüfungsform(en) wird/ werden von der/ dem jeweiligen Lehrenden nach Rücksprache mit der/ dem
Modulbeauftragten festgelegt und bei der Ankündigung der Lehrveranstaltung sowie in der ersten Sitzung bekannt
gegeben.
- zwingende Zugangsvoraussetzungen: erfolgreicher Abschluss B2 oder B3a
Turnus (Beginn):
jährlich Wintersemester
Modulverantwortliche(r):
Stefanie Hartz
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
---
Literatur:
- Dinkelaker, J., & von Hippel, A. (2015). Erwachsenenbildung in Grundbegriffen (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W.
Kohlhammer.
- von Hippel, A., Kulmus, C., & Stimm, M. (2019). Didaktik der Erwachsenen- und Weiterbildung (1. Aufl.). Paderborn:
Ferdinand Schöningh.
- Tippelt, R., & von Hippel, A. (Hrsg.) (2018). Handbuch Erwachsenenbildung/Weiterbildung (6., überarb. Aufl.).
Wiesbaden: Springer VS.
Erklärender Kommentar:
Vorlesung und Seminar (in den Lehrveranstaltungen werden unabhängig von den Prüfungsleistungen aktivierende Lehr-
Lernformen eingesetzt (s.o.)).
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 18 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
2. Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
2.1. (Reakkr. 2020) - B: Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - B: Psychologische Grundlagen pädagogischer Prozesse GE-IPP-22
Institution: Modulabkürzung:
Pädagogische Psychologie PPsych B
Workload: 180 h Präsenzzeit: 60 h Semester: 2
Leistungspunkte: 6 Selbststudium: 120 h Anzahl Semester: 1
Pflichtform: Pflicht SWS: 4
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
a) Vorlesung: Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens (nur SoSe)
Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens (OV)
b) Vorlesung: Erziehungspsychologie: Interaktionsprozesse in Familie und Schule (nur SoSe)
Erziehungspsychologie: Interaktionsprozesse in Familie und Schule (OV)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik: Die Studierenden belegen beide Vorlesungen im SoSe.
b) Empfohlenes Fachsemester: EZW und GHR Bildungswissenschaft (2)
Lehrende:
Prof. Dr. Elke Heise
Prof. Dr. Barbara Thies
Dr. Marcus Friedrich
Qualifikationsziele:
Die Studierenden
- können grundlegende Determinanten von Lehr-Lern- und Erziehungsprozessen in Schule, Freizeit und Familie
benennen.
- sind in der Lage, psychologische Teilprozesse, die für das Verständnis pädagogischer Situationen relevant sind, zu
beschreiben und an Hand einfacher Fallbeispiele zu klassifizieren.
- können das erworbene Wissen auf Fallbeispiele übertragen und einfache Verhaltensinterventionen unter Hinzunahme
der relevanten Theorien ableiten und begründen.
Inhalte:
Im instruktionspsychologischen Teilbereich erwerben die Studierenden einen Überblick über
- Determinanten gelingender Lehr-Lern-Prozesse,
- den Erwerb und die Förderung deklarativen und prozeduralen Wissens, Expertise und Lernstrategien,
- die Rolle von motivationalen Prozessen in Lehr-Lern-Kontexten,
- die Bezugsnormen bei der Leistungsbewertung sowie Merkmale guter Klassenführung.
Der erziehungspsychologische Schwerpunkt fokussiert anhand der Sozialisationsinstanzen Familie und Schule
- relevante Kenntnisse und Kompetenzen für die Gestaltung pädagogischer Interaktionssituationen,
- entwicklungs- und sozialpsychologische Voraussetzungen von Erziehung,
- erziehungsleitende Zielvorstellungen, Erziehungsstile und Erziehungsverhalten,
- Verhaltensanalyse und modifikation.
Lernformen:
Lehrendenvorträge, Podiumsdiskussion, interaktive Aufgaben, Online-Einheit
Prüfungsmodalitäten / Voraussetzungen zur Vergabe von Leistungspunkten:
- Prüfungsmodalitäten:
SL: Klausur (90 min) => schriftlich; nur SoSe
Turnus (Beginn):
jährlich Sommersemester
Modulverantwortliche(r):
Elke Heise
Sprache:
Deutsch
Medienformen:
Tafelbild / Beamer-Präsentation, Online-Einheit auf Lernplattform, audio-visuelle Medienformen, Smartphone-Apps
Literatur:
---
Erklärender Kommentar:
Die beiden Vorlesungen sind Pflichtveranstaltungen und werden als solche im Grundzeitenplan berücksichtigt. Sollte im
Ausnahmefall für Studierende des Lehramts der Besuch wegen paralleler Pflichtveranstaltungen eines anderen Faches
der Besuch einer Vorlesung nicht möglich sein, ist mit vorherigem Antrag (formlos per Mail an die Fachstudienberatung
für Pädagogische Psychologie) der Besuch eines ausgewählten Seminars alternativ möglich. Die Klausur bezieht sich
dann auf Inhalte dieses Seminars und der besuchten Vorlesung.
Seite 19 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
Kategorien (Modulgruppen):
Erziehungswissenschaft im Kontext anderer Sozialwissenschaften
Voraussetzungen für dieses Modul:
Studiengänge:
2-Fächer-Bachelor (Reakk 2020) (Bachelor), Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020) (Bachelor),
Kommentar für Zuordnung:
---
Seite 20 von 54Technische Universität Braunschweig | Modulhandbuch: Bachelor Erziehungswissenschaft - 1-Fach (Reakk 2020)
2.2. (Reakkr. 2020) - A1a: Bedingungen des Lehrens und Lernens
Modulbezeichnung: Modulnummer:
(Reakkr. 2020) - A1a: Bedingungen des Lehrens und Lernens GE-IPP-23
Institution: Modulabkürzung:
Pädagogische Psychologie PPsych A1a
Workload: 270 h Präsenzzeit: 90 h Semester: 3
Leistungspunkte: 9 Selbststudium: 180 h Anzahl Semester: 2
Pflichtform: Wahlpflicht SWS: 6
Lehrveranstaltungen/Oberthemen:
Handlungsregulation: Ziele erreichen, Hindernisse überwinden (OSem)
Selbstwert und Selbstwirksamkeit im pädagogischen Kontext (OSem)
Gesprächsführung und Beratung (OB)
Angst und Angstbewältigung (OSem)
HIV- und STI-Prävention (OB)
Schulpsychologie (OB)
Motivation und Motivationsförderung (OSem)
Erfolgreiches Lernen und Lehren (OSem)
Intelligenz (OSem)
Positive Psychologie - Einführung in Theorie und Praxis (S)
Digitalisierung im Unterricht: Chancen und Herausforderungen aus pädagogisch-psychologischer Perspektive (OSem)
Vorurteile, Stereotype und soziale Diskriminierung (OSem)
Allgemeine Psychologie II (V)
Allgemeine Psychologie I (V)
Belegungslogik (wenn alternative Auswahl, etc.):
a) Belegungslogik: Die Studierenden wählen aus den LV-Angebot drei Seminare oder zwei Seminare und eine Vorlesung
aus. Sie belegen diese innerhalb von zwei Semestern.
b) Empfohlenes Fachsemester: EZW (3-6) / MA GYM (2-3)
Lehrende:
Prof. Dr. Elke Heise
Dr. Kim Leonie Prüß
Prof. Dr. Barbara Thies
Prof. Dr. Ingeborg Wender, i.R.
Thorsten Otto, M. Sc.
Peter Fischer, M.Sc.
Dipl.-Psych. Tobias Rahm
Dr. Lena Hannemann
Dipl.-Psych. Marcel Hackbart
Leilei Xie, M.A.
Ronja Yamuna Rott, M.Sc.
Prof. Dr. Mark Vollrath
Prof. Dr. Frank Eggert
Qualifikationsziele:
- Die Studierenden erwerben grundlegende Kenntnisse über psychologische Theoriebildung und empirische Forschung
zu Grundlagen und Möglichkeiten von Wissenserwerb und -vermittlung.
- Sie sind in der Lage, Lern- und Wissenserwerbsprozesse auf wissenschaftlicher Grundlage zu beschreiben, zu erklären
und zu vergleichen. Darauf aufbauend können sie diese auf schulische, außerschulische und psychosoziale Kontexte
anwenden.
- Sie können Konzepte zur Förderung von Lern- und Wissenserwerbsprozessen theoriebegründet konzipieren und deren
Relevanz für Fallbeispiele aus pädagogischen und psychosozialen Kontexten bewerten.
- Anhand von zahlreichen Beispielen aus verschiedenen schulischen, außerschulischen und psychosozialen Kontexten
gewinnen sie einen Einblick in die Übertragbarkeit der erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten auf Situationen in
verschiedene Feldern der späteren Berufspraxis.
- Ein Qualifikationsziel ist auch die inhaltlich kontroverse Auseinandersetzung mit den vorgetragenen Themen der übrigen
Teilnehmenden. Die Studierenden sind mittels Präsentation, Diskussion und Argumentation, einschließlich kooperativer
Lernformen und Gruppenarbeiten, zur diskursiven Wissensvermittlung und -aneignung befähigt.
Inhalte:
Psychologische Theorien und empirische Befunde zu Prozessen des Wissenserwerbs und seiner Förderung, der
Motivation und ihrer Förderung sowie zu Prozessen der volitionalen Handlungssteuerung.
Vertiefende Veranstaltungsinhalte sind z.B.:
- Gedächtnismodelle und Lernstrategien,
- Lernen mit Texten und digitalen Medien,
- effektive Gestaltung von kooperativen Lernsettings,
Seite 21 von 54Sie können auch lesen