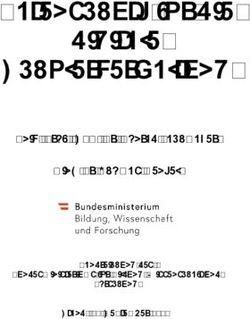Fachanforderungen Geschichte - Allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I Sekundarstufe II
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Ministerium für Schule
und Berufsbildung
Fachanforderungen
Geschichte
Allgemein bildende Schulen
Sekundarstufe I
Sekundarstufe II
Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 1Impressum Herausgeber: Ministerium für Schule und Berufsbildung des Landes Schleswig-Holstein Postfach 7124, 24171 Kiel Kontakt: pressestelle@bimi.landsh.de Layout: Stamp Media im Medienhaus Kiel, Ringstraße 19, 24114 Kiel, www.stamp-media.de Druck: Schmidt & Klaunig im Medienhaus Kiel, Ringstraße 19, 24114 Kiel, www.schmidt-klaunig.de Kiel, Juli 2016 Die Landesregierung im Internet: www.schleswig-holstein.de Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesregierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden.
Fachanforderungen Geschichte Allgemein bildende Schulen Sekundarstufe I Sekundarstufe II
INHALT
Inhalt
I Allgemeiner Teil..................................................................................................................................................................... 6
1 Geltungsbereich und Regelungsgehalt..................................................................................................................................... 7
2 Lernen und Unterricht.................................................................................................................................................................. 8
2.1 Kompetenzorientierung......................................................................................................................................................... 8
2.2 Auseinandersetzung mit Kernproblemen des gesellschaftlichen Lebens....................................................................... 8
2.3 Leitbild Unterricht................................................................................................................................................................... 9
2.4 Aufgabenfelder von besonderer Bedeutung...................................................................................................................... 9
3 Grundsätze der Leistungsbewertung....................................................................................................................................... 11
II Fachanforderungen Geschichte Sekundarstufe I....................................................................................... 12
1 Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe I........................................................................................................................... 12
1.1 Grundlagen und Lernausgangslage.................................................................................................................................. 12
1.2 Der Beitrag des Faches zur allgemeinen und fachlichen Bildung.................................................................................. 12
1.3 Didaktische Leitlinien .......................................................................................................................................................... 12
1.4 Anforderungsebenen und Anforderungsbereiche.......................................................................................................... 13
2 Kompetenzbereiche................................................................................................................................................................... 15
2.1 Wahrnehmungskompetenz................................................................................................................................................. 15
2.2 Erschließungskompetenz.................................................................................................................................................... 15
2.3 Sachurteilskompetenz.......................................................................................................................................................... 15
2.4 Orientierungskompetenz.................................................................................................................................................... 15
3 Themen und Inhalte des Unterrichts........................................................................................................................................ 20
4 Schulinternes Fachcurriculum................................................................................................................................................... 22
5 Leistungsbewertung................................................................................................................................................................... 24
5.1 Unterrichtsbeiträge.............................................................................................................................................................. 24
5.2 Bewertungskriterien............................................................................................................................................................. 25
4 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEINHALT
III Fachanforderungen Geschichte Sekundarstufe II.................................................................................... 26
1 Das Fach Geschichte in der Oberstufe an Gymnasien und Gemeinschaftsschulen.......................................................... 26
1.1 Grundlagen und Lernausgangslage.................................................................................................................................. 26
1.2 Der Beitrag des Faches zur allgemeinen und fachlichen Bildung.................................................................................. 26
1.3 Didaktische Leitlinien........................................................................................................................................................... 26
1.4 Anforderungsniveaus und Anforderungsbereiche........................................................................................................... 26
2 Kompetenzbereiche .................................................................................................................................................................. 27
3 Themen und Inhalte des Unterrichts........................................................................................................................................ 27
E1: Vergangenheit und Gegenwart – Lernen aus der Geschichte?...................................................................................... 28
E2: Begegnungen von Kulturen – Konfrontation, Abgrenzung oder Integration?.............................................................. 28
E3: Wandel von Wirtschaft und Gesellschaft – Kontinuitäten und Brüche........................................................................... 29
Q1.1: Die Menschenrechte aus universal-historischer Perspektive – angeboren, egalitär, unteilbar und universell?.... 29
Q1.2: Nationale Identitäten seit dem 19. Jahrhundert – Realität oder Konstruktion?........................................................ 30
Q2.1: Diktatur und Demokratie im Zeitalter der Extreme...................................................................................................... 31
Q2.2: Dauerhafter Friede – eine Utopie? Friedensschlüsse und Lösungsversuche internationaler Konflikte................. 32
4 Schulinternes Fachcurriculum................................................................................................................................................... 34
5 Leistungsbewertung................................................................................................................................................................... 34
5.1 Unterrichtsbeiträge.............................................................................................................................................................. 35
5.2 Klassenarbeiten und gleichwertige Leistungsnachweise................................................................................................ 35
5.3 Bewertungskriterien............................................................................................................................................................. 35
6 Die Abiturprüfung im Fach Geschichte.................................................................................................................................... 36
6.1 Anforderungsbereiche in der Abiturprüfung.................................................................................................................... 36
6.2 Die schriftliche Abiturprüfung............................................................................................................................................. 36
6.3 Die mündliche Abiturprüfung............................................................................................................................................. 37
6.4 Besondere Lernleistung....................................................................................................................................................... 38
IV Anhang.................................................................................................................................................................................. 39
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 5ALLGEMEINER TEIL
1 Geltungsbereich und Regelungsgehalt
I Allgemeiner Teil
1 Geltungsbereich und Regelungsgehalt Vorgaben der Fachanforderungen
Die Fachanforderungen beschreiben die didaktischen
Die Fachanforderungen gelten für die Sekundarstufe Grundlagen der jeweiligen Fächer und den spezifischen
I und die Sekundarstufe II aller weiterführenden Beitrag der Fächer zur allgemeinen und fachlichen
allgemeinbildenden Schulen in Schleswig-Holstein. Bildung. Darauf aufbauend legen sie fest, was Schüler
Sie sind Lehrpläne im Sinne des Schulgesetzes. Die innen und Schüler jeweils am Ende der Sekundarstufe I
Fachanforderungen gehen von den pädagogischen beziehungsweise am Ende der Sekundarstufe II wissen
Zielen und Aufgaben aus, wie sie im Schleswig- und können sollen. Aus diesem Grund sind die Fachan
Holsteinischen Schulgesetz (SchulG) formuliert sind. In forderungen abschlussbezogen formuliert. Die fachlichen
allen Fächern, in denen die Kultusministerkonferenz (KMK) Anforderungen werden als Kompetenz- bzw. Leistungs
Bildungsstandards beschlossen hat, liegen diese den erwartungen beschrieben und mit Inhalten verknüpft.
Fachanforderungen zugrunde. Sie berücksichtigen auch
die stufenbezogenen Vereinbarungen der KMK. In den Fachanforderungen für die Sekundarstufe I werden
die angestrebten Kompetenzen und die zentralen Inhalte
Die Fachanforderungen sind in einen für alle Fächer auf drei Anforderungsebenen ausgewiesen:
geltenden allgemeinen Teil und einen fachspezifischen ∙ Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA): Die
Teil gegliedert. Der fachspezifische Teil ist nach Anforderungsebene beschreibt die Regelanforderungen
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II unterschieden. Alle für den Erwerb des ESA; diese sind in den weiteren
Teile sind inhaltlich aufeinander bezogen. Sie stellen Anforderungsebenen enthalten.
den verbindlichen Rahmen für die pädagogische und ∙ Mittlerer Schulabschluss (MSA): Die Anforderungsebene
unterrichtliche Arbeit dar. beschreibt die über den ESA hinausgehenden
Regelanforderungen für den Erwerb des MSA.
In der Sekundarstufe I zielt der Unterricht sowohl auf ∙ Übergang in die Oberstufe: Die Anforderungsebene
den Erwerb von Allgemeinbildung als auch auf die beschreibt die über den MSA hinausgehenden
Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler. Sie Regelanforderungen für den Übergang in die Oberstufe.
können am Ende der neunten Jahrgangsstufe den
Ersten allgemeinbildenden Schulabschluss, am Ende der Der Unterricht in der Sekundarstufe I der
zehnten Jahrgangsstufe den Mittleren Schulabschluss Gemeinschaftsschule führt Schülerinnen und Schüler
oder die Versetzung in die Sekundarstufe II erlangen. entsprechend ihres Leistungsvermögens zum Ersten
allgemeinbildenden Schulabschluss, zum Mittleren
In der Sekundarstufe II zielt der Unterricht auf Schulabschluss und zum Übergang in die Oberstufe und
eine vertiefte Allgemeinbildung, die Vermittlung muss daher allen Anforderungsebenen gerecht werden.
wissenschaftspropädeutischer Grundlagen und auf das
Erreichen der allgemeinen Berufs- und Studierfähigkeit. Der Unterricht in der Sekundarstufe I am Gymnasium
In der Sekundarstufe II können die Schülerinnen und zielt auf einen erfolgreichen Übergang in die Oberstufe,
Schüler den schulischen Teil der Fachhochschulreife so dass die Anforderungen für den Übergang in die
oder mit bestandener Abiturprüfung die Allgemeine Oberstufe vorrangig zu berücksichtigen sind.
Hochschulreife erlangen.
Die Fachanforderungen dienen der Transparenz und
Am Gymnasium erwerben Schülerinnen und Schüler Vergleichbarkeit. Sie gewährleisten die Durchlässigkeit
den Mittleren Schulabschluss mit der Versetzung in die und Mobilität im Schulwesen.
Klassenstufe 11.
Die Lehrkräfte gestalten den Unterricht und
die damit verbundene Unterstützung der
6 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEALLGEMEINER TEIL
1 Geltungsbereich und Regelungsgehalt
Persönlichkeitsentwicklung in eigener pädagogischer
Verantwortung. Sie berücksichtigen bei der konkreten
Ausgestaltung der Fachanforderungen die Beschlüsse
der Schulkonferenz zu Grundsatzfragen und dabei
insbesondere die Beschlüsse der Fachkonferenz zur
Abstimmung des schulinternen Fachcurriculums. Mit
ihren Vorgaben bilden die Fachanforderungen den
Rahmen für die Fachkonferenzarbeit in den Schulen.
Innerhalb dieser Rahmenvorgaben besitzen die Schulen
und auch die Fachkonferenzen Gestaltungsfreiheit
bezüglich der Umsetzung der Kontingentstundentafel,
der Lern- und Unterrichtsorganisation, der pädagogisch-
didaktischen Konzepte wie auch der inhaltlichen
Schwerpunktsetzungen. Die Fachanforderungen
verzichten auf kleinschrittige Detailregelungen.
Aufgabe der schulinternen Fachcurricula ist es,
die Kerninhalte und Kompetenzen, die in den
Fachanforderungen auf den jeweiligen Abschluss
bezogen ausgewiesen sind, über die einzelnen
Jahrgangsstufen hinweg aufzubauen. Die schulinternen
Fachcurricula bilden die Planungsgrundlage für den
Fachunterricht und enthalten konkrete Beschlüsse über
∙ anzustrebende Kompetenzen für die einzelnen
Jahrgangsstufen
∙ Schwerpunktsetzungen, die Verteilung und Gewichtung
von Unterrichtsinhalten und Themen
∙ fachspezifische Methoden
∙ angemessene mediale Gestaltung des Unterrichts
∙ Diagnostik, Differenzierung und Förderung,
Leistungsmessung und Leistungsbewertung
∙ Einbeziehung außerunterrichtlicher Lernangebote und
Ganztagsangebote.
Die Fachcurricula berücksichtigen die Prinzipien des
fächerverbindenden und fächerübergreifenden wie
auch des themenzentrierten Arbeitens. Die Fachcurricula
werden evaluiert und weiterentwickelt.
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 7ALLGEMEINER TEIL
2 Lernen und Unterricht
2 Lernen und Unterricht ∙ Sozialkompetenz meint die Fähigkeit, die Bedürfnisse
und Interessen der Mitlernenden empathisch
Ziel des Unterrichts ist der systematische, alters- und wahrzunehmen. Schülerinnen und Schüler sind in
entwicklungsgemäße Erwerb von Kompetenzen. Der der Lage, selbstständig und sozial verantwortlich zu
Unterricht fördert die kognitiven, emotionalen, sozialen, handeln. Sie setzen sich mit den Vorstellungen der
kreativen und körperlichen Fähigkeiten der Schülerinnen anderen kritisch und auch selbstkritisch auseinander,
und Schüler. Er vermittelt ihnen kulturelle und hören einander zu und gehen aufeinander ein. Sie
gesellschaftliche Orientierung und ermuntert sie dazu, können konstruktiv und erfolgreich mit anderen
eigenständig zu denken und vermeintliche Gewissheiten, zusammenarbeiten.
kulturelle Wertorientierungen und gesellschaftliche ∙ Methodenkompetenz meint die Fähigkeit, Aufgaben
Strukturen auch kritisch zu überdenken. Unterricht trägt selbstständig zu bearbeiten. Schülerinnen und Schüler
dazu bei, Bereitschaft zur Empathie zu entwickeln, und verfügen über grundlegende Arbeitstechniken und Me-
fördert die Fähigkeit, die eigenen Überzeugungen und thoden; dazu gehört auch die sichere Nutzung der Infor-
das eigene Weltbild in Frage zu stellen. Er unterstützt mationstechnologie. Sie wählen Verfahrensweisen und
die Schülerinnen und Schüler dabei, Unsicherheiten Vorgehensweisen selbstständig und wenden methodische
auszuhalten und Selbstvertrauen zu erwerben. Kenntnisse sinnvoll auf unbekannte Sachverhalte an. Sie
können Sachverhalte sprachlich differenziert darstellen.
2.1 Kompetenzorientierung
Die fortschreitende Entwicklung und Ausbildung
In den Fachanforderungen wird ein Kompetenzbegriff dieser überfachlichen Kompetenzen ermöglicht es den
verwendet, der das Wissen und Können, die Fähigkeiten Schülerinnen und Schülern, Lernprozesse zunehmend
und Fertigkeiten eines Menschen umfasst. Das selbst zu gestalten, d.h.: zu planen, zu steuern, zu
schließt die Bereitschaft ein, das Wissen und Können analysieren und zu bewerten.
in unterschiedlichen Situationen zur Bewältigung von
Herausforderungen und zum Lösen von Problemen 2.2 Auseinandersetzung mit Kernproblemen des
anzuwenden. Die Fachanforderungen sind in gesellschaftlichen Lebens
diesem Sinne auf die Darstellung der angestrebten
fachbezogenen Kompetenzen fokussiert. Schülerinnen und Schüler werden durch die
Auseinandersetzung mit Kernproblemen des sozio-
Über die fachbezogenen Kompetenzen hinaus fördert kulturellen Lebens in die Lage versetzt, Entscheidungen
der Unterricht aller Fächer den Erwerb überfachlicher für die Zukunft zu treffen und dabei abzuschätzen,
Kompetenzen: wie sich das eigene Handeln auf andere Menschen,
∙ Selbstkompetenz meint die Fähigkeit, die eigene auf künftige Generationen, auf die Umwelt oder das
Situation wahrzunehmen und für sich selbst eigenständig Leben in anderen Kulturen auswirkt. Die Kernprobleme
zu handeln und Verantwortung zu übernehmen. beschreiben Herausforderungen, die sich sowohl auf
Die Schülerinnen und Schüler artikulieren eigene die Lebensgestaltung des Einzelnen als auch auf das
Bedürfnisse und Interessen differenziert und reflektieren gemeinsame gesellschaftliche Handeln beziehen.
diese selbstkritisch. Dazu gehört die Bereitschaft,
vermeintliche Gewissheiten, das eigene Denken Die Auseinandersetzung mit Kernproblemen richtet sich
und das eigene Weltbild kritisch zu reflektieren und insbesondere auf:
Unsicherheiten auszuhalten. Bezogen auf das Lernen ∙ Grundwerte menschlichen Zusammenlebens:
bedeutet Selbstkompetenz, Lernprozesse selbstständig Menschenrechte, das friedliche Zusammenleben in
zu planen und durchzuführen, Lernergebnisse zu einer Welt mit unterschiedlichen Kulturen, Religionen,
überprüfen, ggf. zu korrigieren und zu bewerten. Gesellschaftsformen, Völkern und Nationen
8 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEALLGEMEINER TEIL
2 Lernen und Unterricht
∙ Nachhaltigkeit der ökologischen, sozialen und ∙ Inklusive Schule: Die inklusive Schule zeichnet
ökonomischen Entwicklung: Erhalt der natürlichen sich dadurch aus, dass sie in allen Schularten und
Lebensgrundlagen, Sicherung und Weiterentwicklung Schulstufen Kinder und Jugendliche mit und ohne
der sozialen, wirtschaftlichen und technischen Behinderung gemeinsam beschult und ihren Unterricht
Lebensbedingungen im Kontext der Globalisierung auf eine Schülerschaft in der ganzen Bandbreite
∙ Gleichstellung und Diversität: Entfaltungsmöglichkeiten ihrer Heterogenität ausrichtet. Diese Heterogenität
der Geschlechter, Wahrung des Gleichberechtigungs- bezieht sich nicht allein auf Behinderung oder
gebots, Wertschätzung gesellschaftlicher Vielfalt sonderpädagogischen Förderbedarf. Sie steht
∙ Partizipation: Recht aller Menschen zur generell für Vielfalt und schließt beispielsweise
verantwortungsvollen Mit-Gestaltung ihrer sozio- die Hochbegabung ebenso ein wie den
kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Migrationshintergrund oder unterschiedliche soziale
Lebensverhältnisse Ausgangslagen.
∙ Sonderpädagogische Förderung: Auch die
2.3 Leitbild Unterricht Förderung von Schülerinnen und Schülern mit
sonderpädagogischem Förderbedarf orientiert sich an
Guter Unterricht den Fachanforderungen. Das methodische Instrument
∙ fördert gezielt die Freude der Schülerinnen und Schüler dafür ist der Förderplan, der in Ausrichtung auf die
am Lernen und die Entwicklung fachlicher Interessen individuelle Situation und den sonderpädagogischen
∙ lässt Schülerinnen und Schüler Selbstwirksamkeit erfahren Förderbedarf einer Schülerin oder eines Schülers und
∙ vermittelt Wertorientierungen in Zusammenarbeit mit einem Förderzentrum erstellt,
∙ fördert nicht allein die intellektuellen und kognitiven umgesetzt und evaluiert wird.
Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler, sondern ∙ Durchgängige Sprachbildung: Die Vermittlung schul-
auch ihre sozialen und emotionalen, kreativen und und bildungsrelevanter sprachlicher Fähigkeiten
körperlichen Potenziale (Bildungssprache) erfolgt im Unterricht aller Fächer.
∙ ermöglicht den Schülerinnen und Schülern durch Das Ziel ist, die sprachlichen Fähigkeiten der Kinder
passende Lernangebote, die auf ihre individuellen und Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund,
Voraussetzungen und ihr Vorwissen abgestimmt sind, unabhängig von ihrer Erstsprache, im Schriftlichen wie
einen systematischen − alters- und entwicklungs im Mündlichen systematisch auf – und auszubauen.
gerechten − Erwerb von Wissen und Können sowie die Das setzt entsprechenden Wortschatz und die Kenntnis
Chance, Leistungserwartungen zu erfüllen bildungssprachlicher grammatischer Strukturen voraus.
∙ fördert und fordert eigene Lernaktivität der Schülerinnen Die Lehrkräfte planen und gestalten den Unterricht
und Schüler, vermittelt Lernstrategien und unterstützt mit Blick auf die Sprachebene Bildungssprache und
die Fähigkeit zum selbstgesteuerten Lernen stellen die Verbindung von Alltags –, Bildungs- und
∙ zielt auf nachhaltige Lernprozesse Fachsprache explizit her.
∙ bietet Gelegenheit, das Gelernte in ausreichender Form Alle Schülerinnen und Schüler werden an die Besonder
systematisch einzuüben, anzuwenden und zu festigen. heiten von Fachsprachen und an fachspezifische Textsor
ten herangeführt. Deshalb ist Fachunterricht auch stets
2.4 Aufgabenfelder von besonderer Bedeutung Sprachunterricht auf bildungs- und fachsprachlichem
Niveau.
Folgende Aufgabenfelder von besonderer Bedeutung, ∙ Kulturelle Bildung: Kulturelle Bildung ist unverzichtbarer
die sich aus den pädagogischen Zielen des Schulgesetzes Teil der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung,
ergeben, sind nicht dem Unterricht einzelner Fächer die den Einzelnen zur Mitgestaltung gesellschaftlicher
zugeordnet. Sie sind im Unterricht aller Fächer zu Prozesse befähigt. Der Zusammenarbeit mit
berücksichtigen: professionellen Künstlerinnen, Künstlern und
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 9ALLGEMEINER TEIL
2 Lernen und Unterricht
Kulturschaffenden auch an außerschulischen Lernorten
kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu.
∙ Niederdeutsch und Friesisch: Seinem Selbstverständnis
nach ist Schleswig-Holstein ein Mehrsprachenland,
in dem Regional- und Minderheitensprachen als
kultureller Mehrwert begriffen werden. Für die
Bildungseinrichtungen des Landes erwächst daraus die
Aufgabe, das Niederdeutsche und das Friesische zu
fördern und zu seiner Weiterentwicklung beizutragen.
∙ Medienbildung: Medien sind Bestandteil aller
Lebensbereiche; wesentliche Teile der Umwelt sind nur
medial vermittelt zugänglich. Schülerinnen und Schüler
sollen in die Lage versetzt werden, selbstbestimmt,
sachgerecht, sozial verantwortlich, kommunikativ und
kreativ mit den Medien umzugehen. Dazu gehört auch
die kritische Auseinandersetzung mit dem Bild von
Wirklichkeit, das medial erzeugt wird. Schülerinnen und
Schüler sollen den Einfluss der Medien reflektieren und
dabei erkennen, dass Medien (Nachrichten, Zeitungen,
Bücher, Filme etc.) immer nur eine Interpretation,
eine Lesart von Wirklichkeit bieten, und sie sollen sich
bewusst werden, dass ihr vermeintlich eigenes Bild von
Wirklichkeit durch die Medien (mit-)bestimmt wird.
∙ Berufs- und Studienorientierung: Diese ist
integrativer Bestandteil im Unterricht aller Fächer und
Jahrgangsstufen. Sie hat einen deutlichen Praxisbezug,
z.B. Betriebspraktika, schulische Veranstaltungen
am Lernort Betrieb. Die Schulen haben ein eigenes
Curriculum zur Berufs- und Studienorientierung, sie
gewährleisten in Zusammenarbeit mit ihren Partnern,
wie z.B. der Berufsberatung, eine kontinuierliche
Unterstützung der beruflichen Orientierung der
Schülerinnen und Schüler. Ziel ist, dass alle Schülerinnen
und Schüler nach dem Schulabschluss einen beruflichen
Anschluss finden.
10 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEALLGEMEINER TEIL
3 Grundsätze der Leistungsbewertung
3 Grundsätze der Leistungsbewertung Schülerinnen und Schüler, die vorübergehend an der
Teilnahme am Unterricht beeinträchtigt sind .
Leistungsbewertung wird verstanden als Dokumentation ∙ Bei Schülerinnen und Schülern, deren Zweitsprache
und Beurteilung der individuellen Lernentwicklung und Deutsch ist, kann die Schule wegen zu geringer
des jeweils erreichten Leistungsstands. Sie erfasst alle Deutschkenntnisse auf eine Leistungsbewertung in
in den Fachanforderungen ausgewiesenen Kompetenz bestimmten Fächern verzichten.
bereiche und berücksichtigt sowohl die Prozesse als auch ∙ Besonderen Schwierigkeiten im Lesen und
die Ergebnisse schulischen Arbeitens und Lernens. Die Rechtschreiben wird durch Ausgleichs- und
Beurteilung von Leistungen dient der kontinuierlichen Fördermaßnahmen gemäß Erlass begegnet.
Rückmeldung an Schülerinnen, Schüler und Eltern, zudem
ist sie für die Lehrkräfte eine wichtige Grundlage für För- Leistungsbewertung im Zeugnis
derungs- und Beratungsstrategien. Die individuelle Leistungs- Die Leistungsbewertung im Zeugnis ist das Ergebnis einer
bewertung erfüllt neben der diagnostischen auch eine er- sowohl fachlichen als auch pädagogischen Abwägung der
mutigende Funktion. Kriterien und Verfahren der Leistungs- erbrachten Unterrichtsbeiträge und ggf. Leistungsnach
bewertung werden den Schülerinnen, Schülern und Eltern weise. Es ist sicherzustellen, dass die Bewertung für die
vorab offengelegt und erläutert. Schülerinnen und Schüler Unterrichtsbeiträge auf einer ausreichenden Zahl unter-
erhalten eine kontinuierliche Rückmeldung über den Lei- schiedlicher Formen von Unterrichtsbeiträgen beruht. Bei
stungsstand. Diese erfolgt so rechtzeitig, dass die Schü- der Gesamtbewertung hat der Bereich der Unterrichts
lerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, aus der Rück- beiträge ein stärkeres Gewicht als der Bereich der Leistungs-
meldung zukünftige Lern- und Arbeitsstrategien abzuleiten. nachweise. Fachspezifische Hinweise zur Leistungsbe
wertung werden in den Fachanforderungen ausgeführt.
In der Leistungsbewertung werden zwei Beurteilungsbereiche
unterschieden: Unterrichtsbeiträge und Leistungsnachweise. Vergleichsarbeiten
∙ Unterrichtsbeiträge umfassen alle Leistungen, die sich Vergleichsarbeiten in den Kernfächern sind länderüber
auf die Mitarbeit und Mitgestaltung im Unterricht oder greifend konzipiert und an den KMK- Bildungsstandards
im unterrichtlichen Kontext beziehen. Zu ihnen gehören orientiert. Die Ergebnisse geben Aufschluss darüber, ob
sowohl mündliche als auch praktische und schriftliche und inwieweit Schülerinnen und Schüler die in den Bil-
Leistungen. dungsstandards formulierten Leistungserwartungen er-
∙ Leistungsnachweise werden in Form von Klassenarbeiten füllen. Vergleichsarbeiten dienen in erster Linie der Selbst-
und Leistungsnachweisen, die diesen gleichwertig sind, evaluation der Schule. Sie ermöglichen die Identifikation
erbracht; sie decken die verbindlichen Leistungserwartun- von Stärken und Entwicklungsbedarfen von Lerngruppen.
gen der Fächer und die Kompetenzbereiche angemessen Die Ergebnisse der Vergleichsarbeiten werden schulintern
ab. Art und Zahl der in den Fächern zu erbringenden ausgewertet. Die Auswertungen sind Ausgangspunkt für
Leistungsnachweise werden per Erlass geregelt. Strategien und Maßnahmen der Unterrichtsentwicklung.
Vergleichsarbeiten gehen nicht in die Leistungsbewertung
Besondere Regelungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler ein. Die Teilnahme
∙ Für Schülerinnen und Schüler mit anerkanntem an den Vergleichsarbeiten ist per Erlass geregelt.
sonderpädagogischen Förderbedarf, die zieldifferent
unterrichtet werden, wird ein Förderplan mit individuell Zentrale Abschlussprüfungen
zu erreichenden Leistungserwartungen aufgestellt. Im Rahmen der Prüfungen zum Erwerb des Ersten allge-
∙ Werden Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogi meinbildenden Schulabschlusses, des Mittleren Schulab-
schem Förderbedarf entsprechend den Anforderungen schlusses und der Allgemeinen Hochschulreife werden in
der allgemeinbildenden Schule unterrichtet, hat die einigen Fächern Prüfungen mit zentraler Aufgabenstellung
Schule der Beeinträchtigung angemessen Rechnung durchgeführt. Die Prüfungsregelungen richten sich nach
zu tragen (Nachteilsausgleich). Dies gilt ebenso für den Fachanforderungen und den KMK-Bildungsstandards.
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 11FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
1 Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe I
II Fachanforderungen Geschichte Sekundarstufe I
1 Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe I fremder Epochen und ihren Spuren in der eigenen
Lebenswelt trägt dazu bei, rational und kritisch fundierte
1.1 Grundlagen und Lernausgangslage Positionen im Sinne eines historisch-politischen
Urteilsvermögens zu gewinnen. Mit der Entwicklung
Die Lernausgangslage des Faches Geschichte in den dieses Urteilsvermögens werden die Schülerinnen und
Gemeinschaftsschulen und Gymnasien ist durch folgende Schüler zugleich in die Lage versetzt, am demokratischen
Merkmale charakterisiert: Gemeinwesen und an der Gestaltung der politischen
∙ Aufgrund der Kontingentstundentafel und differierender Kultur teilzuhaben.
schulinterner Fachcurricula beginnt Geschichte als eigen-
ständiges Unterrichtsfach in den Klassenstufen 5 oder 6. Der Geschichtsunterricht vermittelt auch die Einsicht in
∙ Geschichte ist in allen Medien präsent. die Verschiedenheit menschlicher Daseinsformen und die
Populärwissenschaftliche Veröffentlichungen, Fähigkeit, sich in die Situation der am historischen Prozess
Kinderlexika, Comics, Ausstellungen, Angebote beteiligten Individuen und Gruppen hineinzuversetzen.
außerschulischer Lernorte und die Präsentation Dies ist zugleich mit dem Ziel verbunden, dass die
geschichtlicher Themen in den audiovisuellen Schülerinnen und Schüler Kompetenzen erwerben, die
Medien und im Internet führen zu einer Vorprägung ihnen ein souveränes, selbstgesteuertes historisches
der Schülerinnen und Schüler. Solche Elemente der Denken ermöglichen, damit sie sich nach ihrer Schulzeit
Geschichtskultur beeinflussen ihre Erwartungshaltung als autonome Subjekte in der Geschichtskultur orientieren
bei der Begegnung mit historischen Phänomenen, und behaupten können.
Ereignissen und Persönlichkeiten im Unterricht.
Damit werden Grundlagen für das Leben in einer pluralen
Im Unterricht der Grundschule werden die Schülerinnen Welt bereitgestellt.
und Schüler bereits an historische Inhalte und
Fragestellungen aus ihrer Lebenswelt herangeführt. Dabei In diesem Sinne ist das übergeordnete Ziel des
wird versucht, die subjektive und erlebnisorientierte Geschichtsunterrichts die Entwicklung eines reflektierten
Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler durch Geschichtsbewusstseins. Dieses artikuliert sich in
Begegnungen mit Wirklichkeit und Lebenswelt narrativer Kompetenz, d. h. der Fähigkeit, durch
zu versachlichen und zu objektivieren. Die in der rational begründetes historisches Erzählen Sinn über
Grundschule vermittelten Kompetenzen ermöglichen es, Zeiterfahrung zu bilden (Konstruktion). Umgekehrt
auf unterschiedliche Sozialformen und auf methodische stellt auch die Dekonstruktion, d. h. die kritische
Fertigkeiten wie zielgerichtetes Sammeln, Ordnen und Analyse bereits vorliegender und fremder historischer
Auswerten zurückzugreifen. Narrationen (Deutungen), eine wichtige Aufgabe des
Geschichtsunterrichts dar.
1.2 Der Beitrag des Faches zur allgemeinen und
fachlichen Bildung 1.3 Didaktische Leitlinien
Der Geschichtsunterricht vermittelt die Fähigkeit und die Die in diesen Fachanforderungen formulierten Standards
Bereitschaft, sich mit den geschichtlichen Elementen, sollen im Rahmen der verbindlichen Halbjahresthemen
Strukturen und Abläufen auseinanderzusetzen, die für die in themenzentrierter Auseinandersetzung mit den
Orientierung in der heutigen Gesellschaft von Bedeutung historischen Inhalten erreicht werden.
sind und trägt so zur Identitätsbildung bei.
Es bleibt den Fachkonferenzen vorbehalten, mit Blick
Diese Beschäftigung mit den historisch gewachsenen auf die eigene Schülerschaft sowie auf das lokale und
Denkmustern, Wertmaßstäben und Lebensgewohnheiten regionale Umfeld im Rahmen der vorgegebenen Themen
12 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEFACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
1 Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe I
dazu geeignete historische Inhalte und Vorgaben für ∙ ermöglichen die Entwicklung und Ausdifferenzierung
Unterrichtsverfahren (Fachtage, Projekte, Exkursionen, …) eines je eigenen reflektierten Geschichtsbewusstseins
im schulinternen Fachcurriculum festzulegen. der Lernenden in den verschiedenen Dimensionen.
Diese können sein: Temporalbewusstsein (gestern
Für die Aufbereitung der Unterrichtsinhalte und die – heute – morgen), Wirklichkeitsbewusstsein real -
Organisation des Lernprozesses sind die folgenden fiktiv), Wandelbewusstsein (statisch – veränderlich),
didaktischen Prinzipien besonders zu beachten: Identitätsbewusstsein (wir – ihr – sie), politisches
∙ Problemorientierung, Bewusstsein (oben – unten), ökonomisch-soziales
∙ Multiperspektivität, Bewusstsein (arm – reich), moralisches Bewusstsein
∙ Kontroversität (richtig – falsch).
∙ Pluralität und Interkulturalität,
∙ Wissenschaftsorientierung, Im Sinne einer Schülerorientierung entsprechen Themen,
∙ Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung Inhalte, Methoden und Anforderungen dem Erfahrungs-
∙ Handlungsorientierung. und Lernstand der Schülerinnen und Schüler, die den
historischen Erkenntnisprozess zunehmend selbstständig
Im Unterricht sind verschiedene fachspezifische vollziehen. Narrative Kompetenz bedeutet in diesem
Verfahrensweisen bzw. thematische Zusammenhang, dass die Schülerinnen und Schüler
Strukturierungskonzepte einzusetzen; dazu gehören lernen, ihre persönlichen geschichtlichen Vorkenntnisse
chronologisch-genetisches Verfahren, Längsschnitt, und Voreinstellungen in eine methodisch fundierte
Querschnitt, Fallanalyse und historischer Vergleich. Narration zu übertragen. Hierfür eignen sich besonders
regional- und landesgeschichtlichen Inhalte, die im
Die acht vorgegebenen Themen (ab S.21) sind für die schulinternen Fachcurriculum ausgewiesen werden.
Gestaltung der schulinternen Fachcurricula verbindlich.
1.4 Anforderungsebenen und Anforderungsbereiche
Die Themen und die historischen Inhalte
∙ berücksichtigen grundlegende Inhalte, die im In den Fachanforderungen für die Sekundarstufe I werden
kollektiven Gedächtnis und der Geschichtskultur unserer die angestrebten Kompetenzen und die zentralen Inhalte
Gesellschaft präsent sind (Basisnarrative), auf drei Anforderungsebenen ausgewiesen:
∙ sind für die Diskursfähigkeit der Lernenden und deren ∙ Erster allgemeinbildender Schulabschluss (ESA)
kulturelle Anschlussfähigkeit relevant, ∙ Mittlerer Schulabschluss (MSA)
∙ stellen einen Bezug zu derzeitigen gesellschaftlichen ∙ Übergang in die Oberstufe
Schlüssel- bzw. Kernproblemen her,
∙ berücksichtigen unterschiedliche Für die Gestaltung des Unterrichts, die Erstellung von
geschichtswissenschaftliche Dimensionen, wie Aufgaben und die Bewertung von Unterrichtsbeiträgen
zum Beispiel Politik-, Wirtschafts-, Sozial-, Alltags-, und Leistungsnachweisen sind auf allen
Mentalitäts-, Kultur- und Geschlechtergeschichte, Anforderungsebenen (ESA, MSA, Übergang Oberstufe)
∙ weisen exemplarische Bedeutung auf, die grundlegende die folgenden Anforderungsbereiche zu berücksichtigen:
Einsichten in historische Prozesse, Strukturen und ∙ Der Anforderungsbereich I (AFB I) umfasst das
Zusammenhänge eröffnet, Wiedergeben von Sachverhalten aus einem
∙ ermöglichen es den Lernenden, in intensiver abgegrenzten Gebiet und im gelernten Zusammenhang
Auseinandersetzung mit dem historischen unter rein reproduktivem Benutzen eingeübter
Sachgegenstand Fachbegriffe sowie Methoden Arbeitstechniken (Reproduktion).
historischer Erkenntnis zu lernen und anzuwenden, um ∙ Der Anforderungsbereich II (AFB II) umfasst das
fachspezifische Kompetenzen auszubilden, selbstständige Erklären, Bearbeiten und Ordnen
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 13FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
1 Das Fach Geschichte in der Sekundarstufe I
bekannter Inhalte und das angemessene Anwenden
gelernter Inhalte und Methoden auf andere Sachverhalte
(Reorganisation und Transfer).
∙ Der Anforderungsbereich III (AFB III) umfasst den
reflexiven Umgang mit neuen Problemstellungen,
den eingesetzten Methoden und gewonnenen
Erkenntnissen, um zu eigenständigen Begründungen,
Folgerungen, Deutungen und Wertungen zu gelangen
(Reflexion und Problemlösung).
Im Unterricht müssen für jede Schülerin und jeden
Schüler die Anforderungsbereiche I, II und III angemessen
angeboten und entsprechende Leistungen von ihnen
eingefordert werden. Das ist unabhängig von der
Anforderungsebene, auf der die Lernenden sich
individuell befinden, zu gewährleisten.
Den Anforderungsbereichen zugeordnet sind Operatoren
(siehe Anhang). Diese dienen dazu, den Schülerinnen und
Schülern die Anforderungen der Aufgabenstellungen
transparent zu machen. Der Umgang mit den Operatoren
wird im Laufe der Sekundarstufe I vermittelt und eingeübt.
14 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEFACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
2 Kompetenzbereiche
2 Kompetenzbereiche Narrative Kompetenz als Ausdruck historischen Denkens
und reflektierten Geschichtsbewusstseins setzt sich aus
Geschichtsunterricht zielt auf den Erwerb fachlicher vier Teilbereichen zusammen:
Kompetenzen in Auseinandersetzung mit historischen
Inhalten. Kenntnisse von geschichtlichen Ereignissen ∙ 1. Wahrnehmungskompetenz
und Entwicklungen sind eine notwendige, nicht jedoch Die Schülerinnen und Schüler werden auf historische
eine hinreichende Voraussetzung historischen Lernens. Zeugnisse und Präsentationen (z.B. Geschichtsfilme,
Übergeordnetes Ziel des Geschichtsunterrichts muss Ausstellungen) aus der Geschichtskultur aufmerksam
daher die Entwicklung einer narrativen Kompetenz sein, und können aus ihnen Fragen und Vermutungen
die es den Schülerinnen und Schülern ermöglicht, durch ableiten, die Grundlage für deren Erschließung sind.
historisches Erzählen Sinn über Zeiterfahrung zu bilden.
Historisches Erzählen verknüpft einzelne Sachverhalte ∙ 2. Erschließungskompetenz
aus der Vergangenheit und misst ihnen dadurch eine Die Schülerinnen und Schüler können durch
besondere Bedeutung zu. Dies wird erreicht, indem die sachgerechten Umgang mit verschiedenen Gattungen
Schülerinnen und Schüler lernen, historische Fragen von historischen Quellen und Darstellungen eigene
zu stellen, Sachverhalte zu analysieren, Sachurteile geschichtliche Sachanalysen entwickeln und formulieren
und Werturteile zu formulieren. Das heißt, dass in sowie bereits vorhandene kritisch überprüfen.
der Auseinandersetzung mit Geschichte Narrationen
konstruiert werden, in denen Vergangenheitspartikel ∙ 3. Sachurteilskompetenz
sinnhaft und sinnstiftend miteinander verknüpft werden. Die Schülerinnen und Schüler nutzen eigene
Historisches Erzählen ist daher eine Art rationaler und erfassen vorliegende Sachanalysen in ihrem
Argumentation, deren Geltungsanspruch begründet Zusammenhang und verwenden diese, um plausible
werden muss und kritisiert werden kann. Beziehungszusammenhänge in einem Sachurteil zu
bündeln und um die Grundlagen von Sachurteilen zu
Umgekehrt stellt auch die Dekonstruktion, d. h. die erkennen und zu reflektieren.
kritische Analyse bereits vorliegender und fremder
historischer Narrationen (Deutungen), eine wichtige ∙ 4. Orientierungskompetenz
Aufgabe des Geschichtsunterrichts dar. Diese Deutungen Die Schülerinnen und Schüler gewinnen in der
finden sich beispielsweise in Werken von Historikerinnen Auseinandersetzung mit historischen Inhalten
und Historikern, in geschichtlichen Dokumentar- oder Orientierung in der individuellen und sozialen
Spielfilmen, in mündlichen Erzählungen oder vermittelt Lebenspraxis mit Blick auf Gegenwart und Zukunft und
durch Denkmäler u.v.m. Die Schülerinnen und Schüler entwickeln reflektierte und reflexive Einstellungen und
werden mit diesen bestehenden historischen Narrationen Haltungen. Dies geschieht durch Konstruktion und
alltäglich mehr konfrontiert als mit historischen Quellen Dekonstruktion von Werturteilen unter Berücksichtigung
und daher ist es von wesentlicher Bedeutung, deren verschiedener Perspektiven sowie durch Reflexion des
Gültigkeit, Stimmigkeit, Plausibilität, Aussageabsicht oder historischen Lernens und seiner Dimensionen.
Begründungen zu überprüfen. Beides zusammen, also
Konstruktion und Dekonstruktion, versetzen Schülerinnen
und Schüler in die Lage, historisch zu denken.
Das Kompetenzmodell für Schleswig-Holstein
zur Entwicklung dieser narrativen Kompetenz bei
Schülerinnen und Schülern orientiert sich an dem Modell
des Geschichtsdidaktikers Peter Gautschi.
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 15FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
2 Kompetenzbereiche
Zusammenfassende Darstellung des Kompetenzmodells
Sachurteil Werturteil
Sachurteils- Orientierungs-
kompetenz kompetenz
Historisches Erzählen
Vergangenheit Gegenwart Zukunft
Reflektiertes
Geschichtsbewusstsein
Sachanalyse Frage
Erschließungs- Wahrnehmungs-
kompetenz kompetenz
Die folgenden Kompetenzerwartungen sind für die auch für die Schülerinnen und Schüler, die den
Schülerinnen und Schüler, die den Übergang von Ersten Allgemeinbildenden Schulabschluss oder den
der Sekundarstufe I zur Oberstufe absolvieren, im Mittleren Schulabschluss anstreben. Dabei bedürfen
Sinne von Standards verbindlich. In unterschiedlichen diese Schülerinnen und Schüler zur Erlangung der
Ausprägungen wie dem Komplexitätsgrad von Kompetenzen besonderer individueller Hilfestellungen
Materialien und Aufgaben gilt diese Verbindlichkeit (Binnendifferenzierung).
2.1 Wahrnehmungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
ESA MSA Übergang Oberstufe
∙ erkennen in der eigenen Gegenwart und Umgebung Phänomene, Sachverhalte und Spuren, die in die Vergangenheit weisen,
∙ entwickeln eine individuelle Neugier,
∙ stellen Fragen an die Vergangenheit, ∙ stellen gezielte und weiterführende Fragen an die Vergangenheit,
∙ diskutieren über Wege zur Beantwor- ∙ diskutieren über Wege zur Beantwortung der Fragen und formulieren Hypo-
tung der Fragen mit Hilfen, thesen, die historisches Lernen anregen,
∙ erkennen Veränderungen in der Zeit und Zeitdifferenzen,
∙ suchen mit Hilfe Materialien oder ∙ suchen größtenteils selbstständig Materialien oder Menschen, die über die
Menschen, die über die Vergangen- Vergangenheit Auskunft geben,
heit Auskunft geben,
∙ begegnen Zeitzeugen mit Offenheit, Respekt und Neugier.
16 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEFACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
2 Kompetenzbereiche
2.2 Erschließungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
ESA MSA Übergang Oberstufe
∙ unterscheiden Quellen und ∙ unterscheiden Quellen (und ihre Gattungen) sowie Darstellungen (und ihre
Darstellungen, Formen),
∙ beschreiben Merkmale der verschie- ∙ beschreiben Merkmale der verschiedenen Quellen und Darstellungen und
denen Quellen und Darstellungen, charakterisieren diese,
∙ entnehmen Texten, Bildern, Schau ∙ entnehmen Texten, Bildern, Schau- ∙ entnehmen Texten, Bildern, Schau-
bildern und Karten angeleitet Infor- bildern und Karten größtenteils bildern und Karten selbstständig
mationen, selbstständig Informationen, Informationen,
∙ identifizieren unterschiedliche Phä- ∙ identifizieren unterschiedliche Phä- ∙ identifizieren unterschiedliche Phä-
nomene, Sachverhalte und Personen, nomene, Sachverhalte und Personen, nomene, Sachverhalte und Personen,
angeleitet durch gezielte Fragestel- angeleitet durch Fragestellungen,
lungen,
∙ ziehen aus Quellen Rückschlüsse auf ∙ ziehen größtenteils selbstständig ∙ ziehen aus Quellen selbstständig
die Autoren auf der Basis von bereit aus Quellen Rückschlüsse auf die Rückschlüsse auf die Autoren,
gestellten Informationen, Autoren,
∙ nennen Zeit, Ort und historischen ∙ nennen Zeit, Ort und historischen ∙ nennen Zeit, Ort und historischen
Zusammenhang einer Quelle oder Zusammenhang einer Quelle oder Zusammenhang einer Quelle oder
Darstellung, Darstellung und stellen diese sprach- Darstellung und stellen diese sprach-
lich angemessen dar, lich angemessen und umfassend dar,
∙ entwickeln einfache Fragen an leicht ∙ entwickeln Fragen an gut verständli- ∙ entwickeln Fragen an Quellen und
verständliche Quellen und Darstel- che Quellen und Darstellungen und Darstellungen und beantworten
lungen und beantworten diese, beantworten diese, diese,
∙ prüfen Aussagekraft und Verlässlich- ∙ prüfen Aussagekraft und Verlässlich- ∙ prüfen Aussagekraft und Verlässlich-
keit von Quellen und Darstellungen keit von Quellen und Darstellungen keit von Quellen und Darstellungen
mit gezielten Hilfestellungen, mit Hilfestellungen und schätzen den nach eingeübten Kriterien und schät-
Erkenntniswert ein, zen den Erkenntniswert ein,
∙ zitieren stark angeleitet gehaltvolle ∙ zitieren angeleitet gehaltvolle Aussa- ∙ zitieren gehaltvolle Aussagen, weisen
Aussagen, weisen diese bibliogra- gen, weisen diese bibliografisch nach diese bibliografisch nach und leisten
fisch nach und leisten dadurch formal und leisten dadurch formal korrekte dadurch formal korrekte Textarbeit,
korrekte Textarbeit, Textarbeit,
∙ entwickeln anhand von Quellen und ∙ stellen anhand von Quellen und Darstellungen begründete Hypothesen auf
Darstellungen Vermutungen und und überprüfen sie,
überprüfen sie,
∙ präsentieren angeleitet, anschaulich präsentieren größtenteils selbstständig, anschaulich und sprachlich angemes-
und sprachlich angemessen ihre Ar- sen ihre Arbeitsergebnisse unter Zuhilfenahme funktionaler Medien.
beitsergebnisse unter Zuhilfenahme
funktionaler Medien.
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 17FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
2 Kompetenzbereiche
2.3 Sachurteilskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
ESA MSA Übergang Oberstufe
∙ grenzen Gegenwärtiges von Vergangenem und Zukünftigem ab,
∙ identifizieren mit Hilfestellung ∙ identifizieren größtenteils selbst- ∙ identifizieren Zusammenhänge wie
Zusammenhänge wie z.B. Ursache ständig Zusammenhänge wie z.B. z.B. Ursache und Wirkung in Erzäh-
und Wirkung in Erzählungen und Ursache und Wirkung in Erzählungen lungen und Erklärungen,
Erklärungen, und Erklärungen,
∙ erkennen die Perspektiven verschie- ∙ erkennen die Perspektiven verschiedener Beteiligter in konkreten historischen
dener Beteiligter in konkreten histori- Situationen und unterscheiden diese voneinander,
schen Situationen,
∙ stellen angeleitet Bezüge zu anderen ∙ stellen Bezüge zu anderen histori-
historischen Phänomenen her, schen Phänomenen her,
∙ ordnen Ereignisse, Sachverhalte und ∙ ordnen Ereignisse, Sachverhalte und Personen zeitlich ein, setzen sie in Bezie-
Personen zeitlich ein und setzen sie hung zueinander und vergleichen diese,
in Beziehung zueinander,
∙ beurteilen Handlungsspielräume historischer und gegenwärtiger Akteure im Hinblick auf offene Möglichkeiten und
Zwangslagen,
∙ ermitteln die Aussageabsicht von ∙ ermitteln die Aussageabsicht von Quellen und Darstellungen und setzen
Quellen und Darstellungen, diese in den historischen Kontext,
∙ formulieren begründete Sachurteile, ∙ formulieren multikausal begründete ∙ formulieren multikausal und reflek-
Sachurteile, tiert begründete Sachurteile,
∙ überprüfen fremde und eigene Sach- ∙ überprüfen fremde und eigene Sach- ∙ überprüfen fremde und eigene Sach-
urteile anhand leicht verständlicher urteile anhand ausgewählter Quellen, urteile anhand von Quellen,
Quellen,
∙ stellen historische Sachverhalte mit ∙ stellen historische Sachverhalte mit ∙ stellen historische Sachverhalte plau-
Hilfen zusammenhängend dar, Hilfen plausibel dar, sibel dar,
∙ erkennen und formulieren die Vielfalt möglicher Sachurteile und dadurch den Konstruktcharakter von Geschichte.
18 FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTEFACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE SEKUNDARSTUFE I
2 Kompetenzbereiche
2.4 Orientierungskompetenz
Die Schülerinnen und Schüler
ESA MSA Übergang Oberstufe
∙ erkennen in Erzählungen und Dar- ∙ erkennen in Erzählungen und Dar- ∙ erkennen in Erzählungen und Dar-
stellungen durch gezielte Hinweise stellungen durch Hinweise wertende stellungen wertende Sinnbildungs-
wertende Sinnbildungsmuster, Sinnbildungsmuster, muster,
∙ stellen einen Bezug von Phänomenen aus der Vergangenheit zur eigenen Person oder Gegenwart her,
∙ erkennen Interessen und Werte, die ∙ erkennen Interessen und Werte, die ∙ erkennen Interessen und Werte, die
bei Menschen der Vergangenheit bei Menschen der Vergangenheit bei Menschen der Vergangenheit
eine Rolle spielten, und formulieren eine Rolle spielten, und reflektieren eine Rolle spielten, und reflektieren
diese, diese mit Hilfestellungen, diese,
∙ erklären angeleitet den Einfluss his- ∙ erklären angeleitet den Einfluss ∙ erklären den Einfluss historischer
torischer Konfliktsituationen auf die historischer Konfliktsituationen auf Konfliktsituationen auf die Gegen-
Gegenwart, begründen diese nach die Gegenwart, begründen diese wart, begründen diese und schätzen
vorgegebenen Kriterien und schät- und schätzen deren Einfluss für die deren Einfluss für die Zukunft ab,
zen deren Einfluss für die Zukunft ab, Zukunft ab,
∙ formulieren eigene Werturteile krite- ∙ formulieren eigene plausible Wertur- ∙ formulieren eigene plausible Wertur-
rienorientiert, teile kriterienorientiert und stellen sie teile kriterienorientiert und stellen sie
sprachlich angemessen dar, sprachlich angemessen und umfas-
send dar,
∙ überprüfen ihre Werturteile anhand ∙ überprüfen ihre Werturteile anhand ∙ überprüfen ihre Werturteile anhand
geltender Normen, geltender Normen und vergleichen geltender Normen, vergleichen sie
sie mit anderen, mit anderen und reflektieren dadurch
ihre eigenen Werturteile,
∙ finden in der Geschichte Orientierung für die Bewältigung ihrer Gegenwart und Gestaltung der Zukunft,
∙ reflektieren ihren Lernprozess.
Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und Schülerinnen und
Schüler Schüler Schüler Schüler
kommen in GU lernen durch Narrative versprachliches erreichen reflek-
Konstruktion und Kompe- tiertes Geschichts-
mit naiven ihr historisches
Dekonstruktion tenz bewusstsein
Geschichtsbildern Denken
historisch denken
Prozessmodell des Geschichtsunterrichts
FACHANFORDERUNGEN GESCHICHTE 19Sie können auch lesen