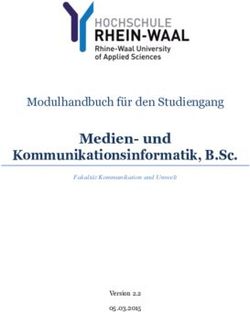GEM 2 UWG IRREFÜHRUNG DURCH UNTERLASSUNG - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Eingereicht von
Marlene Reichl
Angefertigt am
Institut für
Unternehmensrecht
Beurteilerin
Univ.- Prof.in Dr.in Eveline
Artmann
IRREFÜHRUNG DURCH Monat Jahr
Februar 2020
UNTERLASSUNG
GEM § 2 UWG
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magistra Iuris
im Diplomstudium
der Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
www.jku.at
DVR 0093696EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Linz, 03.02.2020 Ort, Datum Unterschrift 03. Februar 2020 Marlene Reichl 2/40
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................... 5
I. Einleitung ............................................................................................................. 8
II. Normzweck .......................................................................................................... 9
A. Der Schutz der Mitbewerber ....................................................................... 9
B. Schutz der Abnehmer ................................................................................. 9
C. Schutz des Interesses der Allgemeinheit an einem unverfälschten
Wettbewerb............................................................................................... 10
III. Normadressat .................................................................................................... 10
IV. Positivierung und Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere
Geschäftspraktiken ............................................................................................ 11
V. Der Tatbestand des § 2 Abs 4 UWG .................................................................. 12
A. Fallprüfung ................................................................................................ 12
1. Dreistufige Lauterkeitsprüfung ................................................................ 12
2. Prüfung innerhalb des Irreführungstatbestands ...................................... 12
B. Grundtatbestand ....................................................................................... 13
1. Begriff der Geschäftspraktik.................................................................... 14
2. Pflicht zur Vollständigkeit ........................................................................ 14
3. Wesentlichkeitserfordernis ...................................................................... 14
a) Beispiele aus der Judikatur ......................................................... 16
4. Maßgebliche Verkehrsauffassung........................................................... 16
a) Unternehmerleitbild ..................................................................... 17
b) Leitbild des Verbrauchers ............................................................ 18
(1) Leitbild des „flüchtigen Verbrauchers“ ....................................... 18
(2) Leitbild des „informierten und verständigen
Durchschnittsverbrauchers“ ...................................................... 19
5. Zeitpunkt der Aufklärung – Irreführendes Anlocken ................................ 20
6. Beschränkung des Kommunikationsmediums......................................... 21
a) Anderweitiges Zur-Verfügung-Stellen von Informationen ............. 23
03. Februar 2020 Marlene Reichl 3/407. Relevanzprüfung/Täuschungseignung .................................................... 23
8. Information overload ............................................................................... 25
C. Sonderfälle ............................................................................................... 25
1. Verheimlichen ......................................................................................... 25
2. Tarnung des kommerziellen Zwecks ....................................................... 26
a) Advertorials ................................................................................. 27
b) Produktplatzierung ...................................................................... 28
c) Werbefahrten .............................................................................. 29
d) Erlagscheinwerbung .................................................................... 30
e) Tarnung als Privatpost ................................................................ 30
f) Influencer Marketing .................................................................... 31
g) Beispiele zur Tarnung des kommerziellen Zwecks aus der
Judikatur ..................................................................................... 31
VI. Verletzung unionsrechtlicher Informationspflichten (Abs 5) ................................ 32
VII. Aufforderung zum Kauf gegenüber Verbrauchern (Abs 6) ................................. 32
A. Informationspflichten im Einzelnen ............................................................ 34
VIII. Resümee ........................................................................................................... 36
IX. Literaturverzeichnis............................................................................................ 38
A. Monographien, selbständige Werke, Bücher ............................................. 38
B. Kommentare, Handbücher ........................................................................ 38
C. Beiträge in Zeitschriften und Sammelwerken sowie
Entscheidungsanmerkungen ..................................................................... 38
Hinweis: Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechtsspezifische
Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der
Gleichbehandlung für beide Geschlechter.
03. Februar 2020 Marlene Reichl 4/40Abkürzungsverzeichnis
aA andere Ansicht
ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
ABl L Amtsblatt der Europäischen Union
Reihe L: Rechtsvorschriften
Abs Absatz
aF alte Fassung
allg allgemein
aM anderer Meinung
AMD-G Audiovisuelle Mediendienste-Gesetz
Anh Anhang
AnwBl Österreichisches Anwaltsblatt
ao außerordentlich, -e, -er, -es
Art Artikel
bes besonders
BGH Bundesgerichtshof
bspw beispielsweise
bzw beziehungsweise
bzgl bezüglich
ca circa
d deutsch (vor einer anderen Abkürzung)
dh das heißt
E Entscheidung(-en)
ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht
ect et cetera
ErwGr Erwägungsgrund
EuGH Europäischer Gerichtshof
f und der, die folgende
ff fortfolgende
FAGG Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz
GBl Gesetzblatt
03. Februar 2020 Marlene Reichl 5/40gem gemäß
grds grundsätzlich
hA herrschende Ansicht
hL herrschende Lehre
hM herrschende Meinung
idaF in der alten Fassung
idF in der Fassung
idnF in der neuen Fassung
idR in der Regel
idS in diesem Sinn
ieS im engeren Sinn
insb insbesondere
iSd im Sinn des, -der
iVm in Verbindung mit
iwS im weiteren Sinn
iZm im Zusammenhang mit
Jud Judikatur
lfd laufend
lit litera
mE meines Erachtens
MedienG Mediengesetz
nF neue Fassung
oÄ oder Ähnliches
OGH Oberster Gerichtshof
ORF-G Bundesgesetz über den
Österreichischen Rundfunk
RDB Rechtsdatenbank
RL Richtlinie
03. Februar 2020 Marlene Reichl 6/40RL-UGP Richtlinie 2005/29/EG des
Europäischen Parlaments und des
Rates vom 11. Mai 2005 über
unlautere Geschäftspraktiken im
binnenmarktinternen Geschäftsverkehr
zwischen Unternehmern und
Verbrauchern
Rspr Rechtsprechung
stRsp ständige Rechtsprechung
UGB Unternehmensgesetzbuch
uU unter Umständen
UWG Unlauteres Wettbewerbsgesetz
usw und so weiter
va vor allem
vgl vergleiche
Z Ziffer
ZPO Zivilprozessordnung
03. Februar 2020 Marlene Reichl 7/40I. Einleitung Es kann als allgemein gültig angenommen werden, dass jedem zumindest latent laienhaft bewusst ist, dass ein Unternehmer seinen Abnehmern nicht das Blaue vom Himmel erzählen und sie damit mittels unwahren Aussagen in die Irre führen darf. Im Zuge dieser Diplomarbeit wird hingegen der Frage nachgegangen, wie weit ein Unternehmer Eigenschaften seines Produktes oder seiner Dienstleistung verschweigen darf und sich trotzdem noch im Bereich des lauteren Wettbewerbs bewegt. Das Lauterkeitsrecht allgemein wurde in der Vergangenheit mehr von Entscheidungen und weniger von laufenden Gesetzesänderungen geprägt, da nur mittels solchen Rechtsfortbildungen die facettenreichen Wettbewerbsverstöße effektiv verfolgt, und die Täter verurteilt werden können. Die Möglichkeiten seine Produkte bzw Dienstleistungen besser darzustellen als sie tatsächlich sind, sind online sowie offline beinahe grenzenlos. Wirtschaftstreibende geben sich beispielsweise als Kunden auf Social-Media-Plattformen aus um ihre eigenen Produkte zu bewerten, platzieren ihre Marke in beliebten Fernsehsendungen oder laden potentielle Abnehmer zu einem vermeintlichen Wochenendausflug ein, der im Endeffekt doch nur zum Verkauf diverser Waren dient. Da solche Verhaltensweisen bewusst an den Tag gelegt werden um in den Leistungswettbewerb einzugreifen und damit den Verkauf der eigenen Waren zu forcieren, sind sie am Maßstab des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb zu messen. Unter Zuhilfenahme diverser Literatur und höchstgerichtlicher Entscheidungen wird im Zuge dieser Diplomarbeit im Detail auf die Irreführung durch Unterlassung iSd § 2 Abs 4 bis 6 UWG eingegangen. Im Besonderen werden die Auslegungen einzelner Termini mit Bedachtnahme auf unterschiedliche Positionen von Lehre und Rechtsprechung besprochen. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 8/40
II. Normzweck In § 1 dUWG wird im Gegensatz zur österreichischen Fassung der Normzweck festgelegt, nämlich als Schutznorm für die Mitbewerber, die Verbraucher inkl sonstiger Marktteilnehmer und zum Schutz des Interesses der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb (die so genannte Schutzzwecktrias). Der Normzweck des österreichischen UWG ist tendenziell an die deutsche Fassung angelehnt.1 § 2 UWG erfasst aber im Gegensatz zur RL-UGP nicht nur Verbraucher als Marktgegenseite, sondern auch Unternehmer. Die Unterscheidung, ob ein Verbraucher oder ein Unternehmer Ziel der irreführenden Unterlassung wurde, wird aber erst bei der Frage wie der Werbeadressat die Botschaft verstehen konnte, also der maßgeblichen Verkehrsauffassung, relevant.2 A. Der Schutz der Mitbewerber Mitbewerber sind Unternehmer, die als Marktteilnehmer in einem konkreten Wettbewerbsverhältnis zueinander stehen.3 Ein Unternehmer handelt dann rechtswidrig, wenn er die Belange eines anderen Unternehmers in unlauterer Art und Weise tangiert. Der Schutz erstreckt sich faktisch auf das vollständige Handeln des Unternehmers am Markt, egal, ob im Bereich der Beschaffung, des Vertriebs, der Produktion oder der eigenen Darstellung nach außen. In den wenigsten Fällen berührt eine Handlung jedoch nur den mitwerbenden Unternehmer oder nur den Verbraucher. Im Regelfall ist eine Handlung gegenüber dem unternehmerischen Marktteilnehmer und gleichzeitig gegenüber dem Verbraucher unlauter.4 B. Schutz der Abnehmer Die Entscheidungsfreiheit des Verbrauchers ist zu schützen. Es ist wichtig, dass sich dieser in jeder Phase des Geschäftsabschlusses mit den ihm zur Verfügung stehenden Informationen frei entscheiden kann, in welcher Form das Geschäft zu Stande kommt, oder ob es überhaupt abgeschlossen wird. Des Weiteren ist auch das Eigentum, der Besitz und das Vermögen vom Schutzzweck des UWG mitumfasst.5 1 Koppensteiner, „Privates“ und „öffentliches“ Wettbewerbsrecht, wbl 2017, 260, 261. 2 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek (Hrsg), UWG2 § 2 Rz 478 (Stand 1.12.2016, rdb.at). 3 Ernst in Ullmann (Hrsg), jurisPK-UWG4 (2016) § 1 Rz 3. 4 Sosnitza in Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG)3 (2020) § 1 Rz 23 f. 5 Sosnitza in Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG)3 § 1 Rz 25 ff. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 9/40
Unter den Begriff Abnehmer fallen jedoch nicht wie erwähnt nur die Verbraucher, sondern auch sonstige Marktteilnehmer. Darunter versteht man alle Personen oder Unternehmer, die als Anbieter oder Nachfrager von Waren oder Dienstleistungen fungieren. Die Bedeutung der sonstigen Abnehmer fällt jedoch eher gering aus, weil sie einerseits weniger schutzbedürftig sind als Verbraucher und anderseits hiervon nur B2B-Werbung betroffen ist, die beträchtlich weniger verbreitet ist als B2C-Werbungen.6 C. Schutz des Interesses der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbewerb Da nicht nur ein persönliches Bedürfnis der unmittelbar Beteiligten, nämlich der Abnehmer und der Mitbewerber, an einem unverfälschten Wettbewerb besteht, sondern auch seit jeher ein Interesse der Allgemeinheit, ist auch deren Intention vom Schutzzweck des UWG gleichwertig mitumfasst.7 III. Normadressat Normadressaten des § 2 UWG sind alle Teilnehmer am geschäftlichen Verkehr, ohne Unterschied, ob es sich dabei um natürliche oder juristische Personen handelt, auch Personengesellschaften sind von der Norm miterfasst. Eine Handlung ist dann Teil des geschäftlichen Verkehrs, wenn sie eine selbständige und auf Erwerb ausgerichtete ist. Das Tätigwerden hat über ein rein privates Handeln hinauszugehen. Dies ist dann der Fall, wenn der Unternehmer nicht nur eine, sondern viele gleichartige Geschäfte tätigt. Auf eine gewisse Dauer, wie etwa beim Unternehmerbegriff iSd § 1 KSchG, kommt es hierbei hingegen nicht an. Es ist nicht die Person, sondern die Handlung maßgeblich, dh, dass eine Handlung eines Unternehmers nicht per se als eine des geschäftlichen Verkehrs zu qualifizieren ist. Handlungen, die als reine Vorbereitungshandlungen einzustufen sind, sind dann für § 2 UWG maßgeblich, wenn sie bereits so konkret sind, dass sie zur Aufnahme des Geschäftsbetriebs vorgenommen werden und der Markteintritt kurz bevor steht.8 Die Tätigkeit des Unternehmers muss zwar von erwerblichem Charakter, jedoch nicht zwingend auf Gewinn ausgerichtet sein. Auch freiberuflich Tätige sind Normadressaten 6 Ernst in Ullmann, jurisPK-UWG4, § 1 Rz 9. 7 Burgstaller/Frauenberger/Handig/Heidinger/Wiebe in Wiebe/Kodek (Hrsg) , UWG2 § 1 (Stand 1.8.2017, rdb.at) Rz 5. 8 Burgstaller/Frauenberger/Handig/Heidinger/Wiebe in Wiebe/Kodek, UWG2 § 1 (Stand 1.8.2017, rdb.at) Rz 88 ff. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 10/40
des UWG. Die Hoheitsverwaltung fällt hingegen nicht unter den Anwendungsbereich,
weil Hoheitsakte keine Wettbewerbshandlungen darstellen. Werden jedoch
Rechtsträger des öffentlichen Rechts in privatwirtschaftlicher Form tätig, ist ihr
Verhalten sehr wohl am Maßstab des UWG zu messen.9
IV. Positivierung und Umsetzung der Richtlinie 2005/29/EG über
unlautere Geschäftspraktiken
Am 11. Mai 2005 erließ das Europäische Parlament und der Rat die Richtlinie über
unlautere Geschäftspraktiken. Ziel dieser Richtlinie war eine volle Harmonisierung im
Geschäftsverkehr zwischen gewerbetreibenden Unternehmern und Verbrauchern.10
Mittels der UWG-Novelle 200711 versuchte der österreichische Gesetzgeber das erste
Mal der Richtlinie zu entsprechen. Der Nationalrat hatte bei der Umsetzung primär
Klarheit und Transparenz der Verbote irreführender und aggressiver
Geschäftspraktiken im Fokus.12 Dies helfe beiden Seiten des Marktes, also sowohl dem
Verkäufer als auch dem Käufer, fundierte Entscheidungen zu treffen. Der
österreichische Gesetzgeber führte aus, dass ein gesicherter lauterer Wettbewerb
einen starken Wirtschaftsstandort Österreich fördere, dem Unternehmer somit ein
leichteres Auftreten ermögliche und auch Arbeitsplätze sichere.13 Jedoch blieb diese
UWG-Novelle als Folge der Richtlinie über unlautere Geschäftspraktiken, nicht ganz
freiwillig, nicht die letzte:
Der EuGH judizierte, dass die Umsetzung der RL-UGP nicht ausreichend erfolgte. Er
führte aus, dass § 9a UWG aF nicht der europäischen Harmonisierung entspricht,14
weshalb der österreichische Gesetzgeber 2013 das UWG erneut novellieren musste.
Aufgrund dessen untersuchte die Kommission das gesamte österreichische UWG auf
ihre angemessene Umsetzung. Im darauffolgenden Mahnschreiben vom
26. September 2013, C (2013) 6080 führte die Kommission aus, dass Österreich ihren
Verpflichtungen in der Umsetzung der RL-UGP bzgl den
§§ 1a Abs 2; 2 Abs 4, 5, 6 Z 6; 2a Abs 1, 2; 30 und 34 Abs 2 UWG nicht nachkam.
9 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 24 f.
10 Enzinger, Lauterkeitsrecht (2012), 15.
11 NR; GP XXIII RV 144 AB 236 S. 35 BR: AB 7773 S. 749.
12 ErläutRV 144 BlgNR 23. GP.
13 ErläutRV 144 BlgNR 23. GP.
14 EuGH 09.11.2010, C- 540/08 (Mediaprint).
03. Februar 2020 Marlene Reichl 11/40Aufgrund dessen wurde 2015 das UWG erneut novelliert und weitgehend an den Wortlaut der RL-UGP angepasst.15 V. Der Tatbestand des § 2 Abs 4 UWG A. Fallprüfung 1. Dreistufige Lauterkeitsprüfung Wenn eine Handlung des geschäftlichen Verkehrs (siehe III. Normadressat) potentiell unlauter ist und somit dem UWG zuwiderhandelt, ist zunächst zu prüfen, ob das konkret gesetzte Verhalten unter die Spezialtatbestände der „Schwarzen Liste“ des Anhangs des UWG zu subsumieren ist und somit ein Per-se-Verbot verletzen würde. Wenn dies nicht der Fall ist, ist das Verhalten an den §§ 1a, 2 und 2a UWG zu messen. Erst falls das wieder zu verneinen ist, ist innerhalb der Generalklausel des § 1 Abs 1 leg cit vorzugehen.16 Der OGH hielt sich jedoch nicht ständig an die dreistufige Vorprüfung. Der Senat führte die Prüfung der „schwarzen Liste“ dann nicht zwangsläufig durch, wenn der Sachverhalt zweifelsohne den Tatbestand der Generalklauseln des § 1 leg cit erfüllt.17 Diese Linie behielt er aber nicht ständig bei, da er bei anderen Entscheidungen weiter auf das dreistufige Prüfsystem zurückgreift.18 2. Prüfung innerhalb des Irreführungstatbestands Zu Beginn wird die Frage behandelt, ob der Sachverhalt in den persönlichen und sachlichen Anwendungsbereich des § 2 Abs 4 UWG fällt. In den Tatbestand des Abs 4 bis 6 fallen irreführende Unterlassungen.19 Als nächster Schritt ist der vom Unternehmer angesprochene Verkehrskreis zu ermitteln, weil auf dessen maßgebliche Auffassung abzustellen ist, ob eine Handlung geeignet ist, jemanden in die Irre zu führen oder nicht.20 15 Seidelberger in Stauddegger/Thiele, Jahrbuch 2016 Geistiges Eigentum, 261 f. 16 ErläutRV 144 BlgNR 23. GP 2. 17 OGH 05.10.2010, 4 Ob 87/10p; OGH 11.05.2010, 4 Ob 4/10g. 18 OGH 4 Ob 165/11k RdW 2012, 317 = ÖBl 2012, 256 = ecolex 2008, 447 (Tonninger); OGH 22.11.2008, 4 Ob 177/07v; OGH 08.07.2008, 4 Ob 113/08h. 19 Wiltschek/Horak in Wiltshek/Horak (Hrsg), UWG8.02 § 2 E 1741 (Stand 1.3.2019). 20 OGH 4 Ob 2066/96 MR 1996, 160. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 12/40
Wird bereits das Wesentlichkeitserfordernis erfüllt, dh werden dem Abnehmer solche Informationen verschwiegen, die er benötigt um eine fundierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, muss die Täuschungseignung nicht mehr separat geprüft werden.21 Mit der Relevanzprüfung ist fortzufahren: Hier wird untersucht, ob das Verschweigen von Informationen dazu geführt hat oder geführt haben kann, dass aufgrund dessen eine geschäftliche Entscheidung getroffen wurde, die der Abnehmer sonst nicht getroffen hätte. Hier ist ein Kausalzusammenhang zwischen der Fehlvorstellung und der uU getroffenen geschäftlichen Entscheidung erforderlich.22 Der OGH setzt sich zusätzlich noch mit der Frage auseinander, ob eine „geldwerte geschäftliche Veränderung im Vermögen des Verbrauchers“ stattfand. Es wird hier abstrakt und objektiv darauf abgestellt, ob das Verhalten des Unternehmers geeignet ist, das Verhalten des Verbrauchers für ihn negativ zu beeinflussen.23 B. Grundtatbestand Ob eine Geschäftspraktik eines Unternehmers als irreführende Unterlassung zu qualifizieren ist, prüft der OGH in drei Schritten: Ob „wesentliche Informationen verschwiegen werden, die der Durchschnittsmarktteilnehmer zu einer informierten geschäftlichen Entscheidung benötigt“ und „ob sich dies auf sein geschäftliches Verhalten auszuwirken vermag“. Dabei sind die allenfalls beschränkten Möglichkeiten zur Informationsvermittlung in Erwägung zu ziehen.24 Bei der Beurteilung, ob eine Werbeaussage irreführend ist, kommt es immer auf den vermittelten Gesamteindruck der Mitteilung an.25 Die Rechtswidrigkeit eines Unterlassens kann sich aufgrund juristischer Grundprinzipien nur durch eine Pflicht zum Tun ergeben. Diese leitet sich unmittelbar aus § 2 Abs 4 UWG ab. Da die Rechtswidrigkeit bei einem tatbestandsmäßigem Verschweigen indiziert wird, muss sie nicht gesondert geprüft werden.26 21 Strittig – Auseinandersetzung bzgl dieses Themas, siehe VI. B. 3. Wesentlichkeitserfordernis. 22 Augenhofer, Ein „Flickenteppich“ oder doch der „große Wurf“, Überlegungen zur neuen RL über unlautere Geschäftspraktiken, ZfRV 2005/30. 23 RIS-Justiz RS0124374. 24 RIS-Justiz RS0124472. 25 RIS-Justiz RS0078524. 26 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 482. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 13/40
1. Begriff der Geschäftspraktik Der Gesetzgeber definiert den Begriff der Geschäftspraktik in § 1 Abs 4 Z 2 UWG. Darunter ist „jede Handlung, Unterlassung, Verhaltensweise oder Erklärung, kommerzielle Mitteilung einschließlich Werbung oder Marketing eines Unternehmers, die unmittelbar mit der Absatzförderung, dem Verkauf oder der Lieferung des Produktes zusammenhängt“ zu verstehen. Der Konnex mit der Absatzförderung bedeutet, dass das Verhalten des Unternehmers immer darauf gerichtet sein muss das Verhalten des potentiellen Abnehmers für den Anbieter zu verändern bzw zu beeinflussen. Dieses muss objektiv und abstrakt beurteilt dazu geeignet sein, eine negative Vermögensverschiebung herbeizuführen.27 Aufgrund des vorgeschriebenen Zusammenhangs zu einem Verkauf oder zu einer Lieferung subsumiert der Gesetzgeber sowohl die Phase der Vertragsanbahnung als auch die Vertragsabwicklung unter den Begriff der Geschäftspraktik, wodurch auch nachvertragliche Handlungen miterfasst wurden.28 2. Pflicht zur Vollständigkeit Eine allgemeine Pflicht zur Vollständigkeit einer Werbeaussage trifft den Unternehmer nicht. Er muss nicht auf negative Informationen seines Produkts oder seiner Dienstleistung gesondert hinweisen. Ein Verschweigen ist erst dann eine rechtswidrige Irreführung durch Unterlassung, wenn wesentliche Informationen verschwiegen werden, deren Aufklärung zu erwarten gewesen wäre und dadurch ein falscher Gesamteindruck für die anderen Marktteilnehmer entsteht.29 3. Wesentlichkeitserfordernis Die RL-UGP bezeichnet eine wesentliche Information als solche, „die der durchschnittliche Verbraucher je nach den Umständen benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, und die somit einen Durchschnittsverbraucher zu einer geschäftlichen Entscheidung veranlasst oder zu veranlassen geeignet ist, die er sonst nicht getroffen hätte.“30 Wenn Informationen verschwiegen werden, die in § 2 Abs 5 UWG bzw in Art 7 RL-UGP aufgezählt wurden, dann ist die Wesentlichkeit nicht mehr separat zu prüfen, da eine Eignung der Irreführung damit automatisch 27 Wiltschek/Horak in Wiltschek/Horak, UWG8.02 § 1 E 241. 28 Enzinger, Lauterkeitsrecht, Rz 83. 29 RIS-Justiz RS0078579. 30 Art 7 Abs 1 RL-UGP. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 14/40
angenommen wird.31 Weiters gelten die im Anhang II des UWG demonstrativ aufgezählten Anforderungen an Informationen iZm kommerzieller Kommunikation immer als wesentlich.32 Eine Information ist zudem dann wesentlich, wenn ihr Verschweigen dazu geeignet ist, einen falschen Gesamteindruck hervorzurufen.33 Sie ist nicht auf die Hauptpunkte des zustande kommenden Rechtsgeschäfts beschränkt. Beim Wesentlichkeitserfordernis des § 2 Abs 4 UWG wird nicht wie beim zivilrechtlichen Irrtum iSd §§ 871 f ABGB darauf abgestellt, ob der Vertrag ohne dem Verschweigen überhaupt zustande gekommen wäre.34 Es reicht auch ein Verschweigen im Bereich der Nebenabreden vollkommen aus, um das Wesentlichkeitserfordernis zu erfüllen.35 ISd § 2 Abs 5 UWG sind „wesentliche Informationen iSd Abs 4 […] jedenfalls die im Unionsrecht festgelegten Informationsanforderungen im Bezug auf kommerzielle Kommunikation einschließlich Werbung und Marketing.“ (Näheres siehe VII.) Ob eine Information in einem konkreten Sachverhalt wesentlich ist, um eine fundierte geschäftliche Entscheidung zu treffen, ist jedoch immer einzelfallabhängig und kann auch keine erhebliche Rechtsfrage iSd § 502 ZPO darstellen.36 Beispielsweise ist eine Information dann wesentlich, wenn der Abnehmer die finanzielle Gesamtbelastung nicht überblicken kann und ihm somit nicht von vornherein klar war, ob es ihm finanziell möglich ist das Produkt zu erwerben. Ein derartiges Verschweigen führt einen Anlockeffekt herbei, welcher auch unter § 2 Abs 4 UWG zu subsumieren ist. 37 (Weitere Ausführungen bzgl Anlockeffekt siehe Punkt 5.) Eine Pflicht zur Vollständigkeit besteht weiter nicht. Vom Verkäufer wird nicht verlangt über Informationen aufzuklären, dessen Aufklärung entweder der Abnehmer überhaupt 31 OGH 4 Ob 15/13 ecolex 2013,644 (Tonninger) = ÖBl 2013,214 (Gamerith) = jusIT 2013, 209 (Thiele) - Totalabverkauf II - Alles muss raus. 32 OLG Graz 5 R 72/13t ZIR 2014, 135. 33 OGH 4 Ob 131/98p MR 1998, 293 (Korn). 34 Rummel in Rummel/Lukas (Hrsg), ABGB4 § 872 Rz 1 (Stand 1.11.2014, rdb.at). 35 OGH 4 Ob 108/16k ecolex 2016, 990 (Hofmarcher). 36 OGH 4Ob203/15d ÖBl-LS 2016/3 (Hinger) = WRP 2017, 909 (Wiltschek/Majchrzak, Rechtsprechungs- übersicht). 37 OGH 4 Ob 163/08m ecolex 2009, 602 (Horak). 03. Februar 2020 Marlene Reichl 15/40
nicht erwartet,38 diese sich ohnehin aus den Umständen ergeben39, die produkttypisch oder selbstverständlich sind.40 a) Beispiele aus der Judikatur Da das Wesentlichkeitserfordernis immer einzelfallbezogen zu beurteilen ist, werden in Folge konkrete OGH E beispielhaft angeführt: Ein Schuhverkäufer verkaufte Kinderschuhe aus zweiter Wahl, was bedeutet, dass sie gewisse, wenn auch nur geringe, Fehler aufwiesen. Der Verkäufer machte jedoch auf diesen Umstand beim Verkauf nicht aufmerksam, wodurch er wesentliche Informationen in irreführender Weise rechtswidrig verschwieg.41 Ein Zeitungsherausgeber warb mit einem hohen prozentuellen Zuwachs an Abonnenten seiner Zeitung. Er unterließ jedoch die Information, dass er aufgrund der Tatsache, dass er erst kürzlich in den Markt eingestiegen war, diese Prozentzahl von einer niedrigen Gesamtzahl berechnete, wodurch der prozentuelle Zuwachs höher ausfällt als bei den Zeitungen, die bereits von vornherein eine weitaus höhere Abonnementenzahl vorweisen können. Der hohe prozentuelle Zuwachs wird natürlich bei einer niedrigeren Ausgangszahl leichter erreicht als bei einer höheren.42 4. Maßgebliche Verkehrsauffassung In § 1 Abs 2 UWG legt der Gesetzgeber Bezugspunkte fest, die bei der Prüfung der Irreführungseignung einer Geschäftspraktik, die sich an Verbraucher richtet, anzuwenden sind. „Wendet sich eine Geschäftspraktik“ nämlich „an eine Gruppe von Verbrauchern, so ist [der] Durchschnittsverbraucher das durchschnittliche Mitglied dieser Gruppe. Geschäftspraktiken gegenüber Verbrauchern, die voraussichtlich in einer für den Unternehmer vernünftigerweise vorhersehbaren Art und Weise das wirtschaftliche Verhalten nur einer eindeutig identifizierbaren Gruppe von Verbrauchern wesentlich beeinflussen, die auf Grund von geistigen oder körperlichen Gebrechen, Alter oder Leichtgläubigkeit im Hinblick auf diese Praktiken oder die ihnen zugrundeliegenden Produkte besonders schutzbedürftig sind, sind aus der Sicht eines durchschnittlichen Mitglieds dieser Gruppe zu beurteilen.“ 38 RIS-Justiz RS0077894. 39 Art 7 Abs 1 RL-UGP. 40 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 488. 41 OGH 26.06.1997, 4 Ob 164/97i. 42 OGH 4 Ob 177/17v MR 2008,111 = ÖBl 2008, 287 (Gamerith) - Das beste Wachstum = ecolex 2008, 447 (Tonninger). 03. Februar 2020 Marlene Reichl 16/40
Die UWG-Novelle 2007 dehnte den zitierten Verbraucherbegriff auf das gesamte Lauterkeitsrecht aus. § 2 UWG unterscheidet sich jedoch dahingehend von § 1 leg cit, dass hier bzgl der Irreführungseignung nicht nur auf den Verbraucher abgestellt wird, sondern auf den angesprochenen Marktteilnehmer, egal ob es sich dabei um einen Unternehmer oder Verbraucher handelt. Das bedeutet, dass eine Geschäftspraktik, die nur an Unternehmer gerichtet ist, auch nur am Maßstab der durchschnittlichen Verkehrsauffassung eines Unternehmers zu messen ist.43 Richtet sich eine Geschäftspraktik nicht nur an Verbraucher oder nur an Unternehmer, ist die Irreführungseignung getrennt voneinander, gruppenspezifisch zu beurteilen.44 a) Unternehmerleitbild Ganz allgemein gesprochen ist ein Unternehmer iSd § 1 UGB, wer ein Unternehmen betreibt. Ein Unternehmen ist jede auf Dauer angelegte Organisation selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mag sie auch nicht auf Gewinn ausgerichtet sein (Abs 2). Das heißt, sobald jemand in der Funktion des Unternehmers auftritt, werden seine Rechtsgeschäfte zum Betrieb des Unternehmers gezählt, wodurch zumindest eine formale Abgrenzung zwischen Unternehmer und Verbraucher geschaffen werden kann.45 Dem unternehmerisch tätigen Marktteilnehmer ist nicht nur im deutschen, sondern auch im österreichischen Recht das Leitbild des „dynamisch eigenverantwortlichen Unternehmers“ zu Grunde zu legen. Wenn sich zwei Unternehmer gegenüberstehen, ist bei beiden unter normalen Umständen ein einigermaßen gleicher Erwartungs- und Empfängerhorizont anzunehmen, wodurch sich ein reduzierter Schutzbedarf des Unternehmers ergibt.46 Der OGH spricht jedoch in einer Einzelfallentscheidung von einem schutzbedürftigen Unternehmer, nämlich im Bereich der Erlagscheinwerbung. Hier sei es dem Unternehmer nicht zuzumuten sich im Detail mit dem Posteingang zu beschäftigen, va deshalb, weil die Eintragung in die ‚Gelben Seiten‘ von Herold in aller Regel kostenlos ist, was den Empfänger der Erlagscheinwerbung trotz seiner Unternehmerfunktion schutzwürdiger macht als den Anbieter, der den anderen Marktteilnehmer bewusst in die Irre führen wollte.47 Diese E bzgl der 43 Burgstaller/Frauenberger/Handig/Heidinger/Wiebe in Wiebe/Kodek, UWG2 § 1 (Stand 1.8.2017, rdb.at) Rz 58 ff. 44 OGH 27.02.1996, 4 Ob 1016/96 = OGH 17.01.2012, 4 Ob 112/11s. 45 § 1 Abs 1 Z 1 KSchG. 46 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 53 ff. 47 OGH 4 Ob 45/11p ÖBl 2011/50 (Gamerith). 03. Februar 2020 Marlene Reichl 17/40
Schutzbedürftigkeit des Unternehmers ist aber eine sehr stark einzelfallbezogene, die sehr eng mit der Art und Weise der Irreführung verschmolzen ist, wodurch eine solche erhöhte Schutzbedürftigkeit des Unternehmers nicht über den Einzelfall hinaus angenommen werden kann.48 b) Leitbild des Verbrauchers Das Europäische Parlament und der Rat determinieren den Verbraucher in Art 2 lit a RL-UGP als „jede natürliche Person, die im Geschäftsverkehr im Sinne dieser Richtlinie zu Zwecken handelt, die nicht ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können“. Diese Definition wurde vom österreichischen Gesetzgeber jedoch nicht in das UWG übernommen, wodurch hier iSd § 1 Abs 1 KSchG jeder Verbraucher ist, der nicht im Zuge seiner unternehmerischen Tätigkeit handelt. Von dieser sehr allgemeinen Definition des Verbrauchers, muss für die Beurteilung der Tauglichkeit der Irreführung, der theoretische Durchschnittsverbraucher der vom Unternehmer angesprochenen Guppe iSd § 1 UWG für den betreffenden Anlassfall herausgearbeitet werden. Hierbei gibt es zwei Herangehensweisen: (1) Leitbild des „flüchtigen Verbrauchers“ In seinen älteren E geht der OGH von einem flüchtigen Verbraucher aus, an den ein durchschnittlicher Maßstab anzulegen ist. Dieser Durchschnittsverbraucher widmet sich einer ihn tangierenden Werbeaussage nur mittels flüchtiger Betrachtung und durchschnittlicher Aufmerksamkeit.49 Der Senat schreibt in einer der zitierten E über den Durchschnittsinteressenten wörtlich, dass „dieser pflegt eine geschäftliche Ankündigung weder genau, vollständig und kritisch zu würdigen noch grammatikalische und philologische Überlegungen anzustellen.“50 Das Leitbild des flüchtigen Verbrauchers wurde vom Leitbild des informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers abgelöst. Es ist nur noch im Sonderfall der so genannten situationsbezogenen Aufmerksamkeit des durchschnittlich informierten Verbrauchers anzuwenden. Davon ist auszugehen, wenn in einer konkreten Situation 48 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 58. 49 OGH 4 Ob 318/73 ÖBl 1974, 32; OGH 4 Ob 389/82 ÖBl 1983, 43; OGH 07.12.1989 4 Ob 123/88; OGH 4 Ob 37/95 ÖBl 1996, 28; OGH 31. 1. 1995, 4 Ob 1007/95; 4 Ob 2064/96 MR 1996, 118. 50 OGH 07.12.1989 4 Ob 123/88. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 18/40
vom Durchschnittsverbraucher nicht mehr erwartet werden kann, als eine bloß flüchtige Wahrnehmung der Ankündigung.51 (2) Leitbild des „informierten und verständigen Durchschnittsverbrauchers“ Der Durchschnittsverbraucher wurde im ErwGr 18 der RL-UGP als „angemessen gut unterrichtet und angemessen aufmerksam und kritisch“ beschrieben, was geringfügig zum Wortlaut des EuGH divergiert, weil dieser auf einen „durchschnittlich informierten aufmerksamen und verständigen“ Durchschnittsverbraucher abstellt.52 Aus dieser geringfügigen sprachlichen Unterscheidung resultiert jedoch keine inhaltliche, weil erstens im genannten ErwGr direkt auf die E des EuGH verwiesen wird, und zweitens der Text im Englischen und Französischen wörtlich mit dem der EuGH E ident ist.53 Bei der Informiertheit beurteilt man, welches Informationsniveau der Unternehmer seinen Adressaten unterstellen darf. Da dieses Niveau natürlich zwischen den verschiedenen Verbrauchern sehr stark divergieren kann, hat der Unternehmer, wie in allen Bereichen, immer auf den durchschnittlich informierten Verbraucher abzustellen.54 Bei der Einstufung des Grades der vorauszusetzenden Aufmerksamkeit des Verbrauchers stellt man sich die Frage inwiefern dieser die ihm zur Verfügung stehenden Informationen versteht, zur Kenntnis nimmt und im Entscheidungsfindungsprozess des zu tätigenden Rechtsgeschäfts einfließen lässt. In diesem Bereich findet das veraltete Leitbild des flüchtigen Verbrauchers, wie oben erwähnt, Einzug. Denn welche Anforderungen an die Aufmerksamkeit des durchschnittlichen Abnehmers zu stellen sind, orientiert sich an der konkreten Situation. Es ist hier auf die Art und das Ausmaß des Rechtsgeschäfts abzustellen. Wenn es sich bspw um einen Einkauf des täglichen Lebens handelt, kann die angemessene Aufmerksamkeit auch eine bloß flüchtige sein.55 Bei der Frage wie verständig der Durchschnittsteilnehmer ist, geht es darum, wie er die ihm zur Verfügung gestellten Informationen verstehen, und wie weit er daraus die für 51 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 60. 52 EuGH 06.07.1998 C-210/96. 53 Seichter, WRP 2005, 1087 (1091). 54 Köhler in Köhler/Bornkamm (Hrsg), UWG38 (2020) § 1 Rz 34. 55 RIS-Justiz RS0114366; OGH 23.08.2018 4 Ob 144/18g; OGH 20.05.2008 4Ob69/08p. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 19/40
ihn relevanten Vor- bzw Nachteile des Produktes oder der Dienstleistung einschätzen kann.56 Wie eingangs erwähnt, ist iSd § 1 Abs 2 UWG auf den Durchschnittsverbraucher einer bestimmten Gruppe abzustellen. Diese zu spezifizierende Gruppe muss anhand eindeutiger Merkmale wie etwa Alter, Geschlecht, Bildung etc festgemacht werden. Ist dies aufgrund eines zu inhomogenen Adressatenkreises der Werbung jedoch nicht möglich, ist jeweils eine gruppenspezifische Prüfung vorzunehmen. Die Rechtswidrigkeit einer Handlung ist bereits dann zu bejahen, wenn ein durchschnittlicher Verbraucher nur einer der angesprochenen Gruppen soweit getäuscht wurde, dass er eine geschäftliche Entscheidung tätigt, die er ohne Irreführung nicht realisiert hätte.57 Leitbild des „besonders schutzwürdigen Verbrauchers“ ISd § 1 Abs 2 UWG sind besondere Gruppen von Verbrauchern schützenswerter als andere. Darunter fallen Personen, die aufgrund etwaiger körperlicher oder geistiger Gebrechen, ihres Alters oder ihrer Leichtgläubigkeit einer Geschäftspraktik nicht dieselbe Aufmerksamkeit, das selbe Verständnis etc entgegenbringen können, wie ein durchschnittlich informierter und verständiger Verbraucher. Bei der Beurteilung der Irreführungseignung ist hier auf ein durchschnittliches Mitglied dieses speziellen Adressatenkreises abzustellen. 5. Zeitpunkt der Aufklärung – Irreführendes Anlocken Fraglich bleibt jedoch, ob der Verkäufer notwendige Informationen bereits bei einem Anlocken des potentiellen Kunden bereitstellen muss, oder ob es ausreicht, über diese erst zu einem späteren Zeitpunkt aufzuklären. Die hL und stRspr geht davon aus, dass auch ein reines Anlocken durch mangelnder Bekanntgabe von wesentlichen Informationen, worauf ein Rechtsgeschäft folgen 56 Burgstaller/Frauenberger/Handig/Heidinger/Wiebe in Wiebe/Kodek, UWG2 § 1 (Stand 1.8.2017, rdb.at) Rz 64. 57 OGH 4 Ob 202/12b ZIR 2013,120; OGH 20.01.2009 4 Ob 188/08p. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 20/40
könnte, bereits eine Irreführung durch Unterlassung begründet.58 Dies wird va aus dem Anhang I Z 5 der RL-UGP59 abgeleitet.60 Daran ändert auch eine etwaige Aufklärung unmittelbar vor Abschluss des Rechtgeschäfts nichts, weil das irreführende Anlocken bereits abgeschlossen und die Verletzung von § 2 UWG verwirklicht ist. Eine spätere Aufklärung über die verschwiegenen Tatsachen nimmt daher der Geschäftspraktik nicht ihre Irreführungseignung.61 In gewisser Art und Weise ähnlich ist die Lage auch bei der so genannten Blickfangwerbung. Dabei werden vom Unternehmer bestimmte Angaben oder Ankündigungen im Vergleich zu anderen besonders markiert oder hervorgehoben. Dies bewirkt, dass sich die Marktgegenseite gar nicht mehr mit dem Rest der Werbung, die den Blickfang evtl erläutern oder genauer ausführen würde, beschäftigt. Zu beachten ist hier jedoch, dass aufklärende Zusätze einer solchen Geschäftspraktik die Irreführungseignung sehr wohl nehmen können. Diese müssen dafür jedoch ausreichend wahrzunehmen sein und die gleiche Auffälligkeit wie der Blickfang selbst haben.62 6. Beschränkung des Kommunikationsmediums ISd Art 7 RL-UGP, folglich auch § 2 Abs 4 Z 1 UWG, sind bei der Beurteilung der Täuschungseignung immer auf die räumlichen und zeitlichen Schranken des verwendeten Kommunikationsmediums abzustellen.63 Um eine räumliche Beschränkung handelt es sich dann, wenn nur eine bestimmte Menge an Informationen auf dem Medium, bspw eines Fernsehbildschirms oder eines Briefbogens platztechnisch untergebracht werden kann. Anders sieht es hingegen bei 58 OGH 4 Ob 108/16k VbR 2016/130 S 191 – VbR 2016, 191 = ecolex 2016, 990 (Hofmarcher) = ÖBl-LS 2017/1 (Hinger). 59 Aufforderung zum Kauf von Produkten zu einem bestimmten Preis, ohne dass darüber aufgeklärt wird, dass der Gewerbetreibende hinreichende Gründe für die Annahme hat, dass er nicht in der Lage sein wird, dieses oder ein gleichwertiges Produkt zu dem genannten Preis für einen Zeitraum und in einer Menge zur Lieferung bereitzustellen oder durch einen anderen Gewerbetreibenden bereitstellen zu lassen, wie es in Bezug auf das Produkt, den Umfang der für das Produkt eingesetzten Werbung und den Angebotspreis angemessen wäre (Lockangebote). 60 OGH 4 Ob 163/08m MR 2009, 52 = wbl 2009 256/115 = ecolex 2009, 604 (Horak). 61 OGH 4 Ob 405/79 ÖBl 1980, 73; OGH 4 Ob 163/08 MR 2009, 52 (Korn). 62 Cizek, Irreführende Blickfangwerbung in der TV-Werbung – Anforderungen an aufklärenden Hinweis, ecolex 2013, 1006, 1006 ff. 63 OGH 4 Ob 108/16k wbl 2017/16. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 21/40
Onlinewerbung aus. Hier ist der Platz so gut wie grenzenlos, va da man jede Werbeeinschaltung auch mit Links versehen kann, die dann zu den notwendigen Informationen führen. Zeitliche Beschränkungen resultieren aus nur kurz zur Verfügung stehenden Sendezeiten im Fernsehen oder Radio, da eine übermäßige Verlängerung dieser einen unverhältnismäßig hohen finanziellen Aufwand begründen würde.64 Die Möglichkeit alle notwendigen Informationen bereit zu stellen, differenziert stark zwischen den einzelnen Kommunikationsmedien. Besonders beschränkte Optionen werden sich bei Fernseh-, Rundfunk- und Plakatwerbung ergeben, da einerseits aus offenkundigen Gründen nur sehr limitiert Platz bzw Zeit gegeben ist, und andererseits das Publikum der Werbung sehr wenig Aufmerksamkeit schenkt, mithin diese überwiegend nur flüchtig wahrnimmt.65 Das Fehlen wesentlicher Informationen kann der Unternehmer nicht mit der Art des gewählten Mediums und der damit einhergehenden Einschränkung entschuldigen, wenn es nur einer minimalen Aufstockung an Zeit oder Raum bedarf, die in einem finanziellen Verhältnis steht, um den Abnehmer über alle wesentlichen Informationen aufzuklären.66 Die Frage, wie weit ein Werbespot ausgedehnt werden muss um alle wesentlichen Informationen unterzubringen ist auch eine Frage der Zumutbarkeit.67 Der wirtschaftliche Aspekt bzgl einer etwaig nur geringfügig benötigten zusätzlichen Sendezeit bzw mehr Druckfläche in Print-Medien, um über notwendige Informationen aufzuklären, spielt nur in extremen Konstellationen eine Rolle. Kann eine wesentliche Unzulänglichkeit nur durch geringe Aufstockung der Sendezeit oder Platz ausgemerzt werden, ist diese vorzunehmen.68 In manchen Fällen reicht es aus, bestimmte Merkmale des Produktes anzugeben und für die restlichen Informationen seine Webseite als Referenz zu nennen, wofür keine übermäßige Verlängerung der Sendezeit oder Ausdehnung des Platzes notwendig ist.69 64 Alexander, Münchner Kommentar zum Lauterkeitsrecht (UWG)3 § 5a Rz 280 ff. 65 Wiltschek/Majchrzak, Die UWG-Novelle 2007 – Die Umsetzung der Richtlinie über unlauter Geschäftspraktiken in Österreich, ÖBl 2008/2. 66 RIS-Justiz RS0124471. 67 Thiele, Möglichkeiten und Pflichten bei der Informationsvermittlung im Rahmen der Radiowerbung, ZIIR 2014, 135, 140. 68 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 494. 69 EuGH 12.05.2011, C-122/10 GRUR 2011, 930. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 22/40
a) Anderweitiges Zur-Verfügung-Stellen von Informationen Wenn es dem Unternehmer aufgrund zeitlicher und/oder räumlicher Schranken des Kommunikationsmediums nicht möglich ist alle wesentlichen Informationen zur Verfügung zu stellen, sind iSd § 2 Abs 5 UWG anderweitig getroffene Maßnahmen, womit die Informationen dem Abnehmer zugänglich gemacht wurden, zu berücksichtigen. Dh, dass der Gesetzgeber einen Medienbruch, wie zB einen Verweis auf die Homepage des Werbenden in einem Fernsehspot genügen lässt, um noch lauter zu handeln. Er verlangt einen solchen geradezu, wenn das verwendete Kommunikationsmedium keine andere Möglichkeit zulässt, als auf eine andere Art von Kommunikationsmedium zu verweisen.70 Die Entscheidung, ob ein Medienbruch geeignet ist, um nicht irreführend zu handeln, ist einzelfallabhängig. Es ist immer zu examinieren, ob der angesprochenen Zielgruppe zur primären wie zur verwiesenen Mediengattung der gleiche Zugang offen steht.71 Ist die Werbung bspw hauptsächlich an ältere Personen gerichtet, könnte eine Verweisung auf die Homepage in einem TV-Werbespot mE nicht ausreichen. Eine Streuung auf mehrere Kommunikationswege bietet daher eine akkurate Alternative.72 7. Relevanzprüfung/Täuschungseignung Eine Irreführungshandlung enthält immer eine Täuschungseignung, wenn die subjektiven Vorstellungen der Marktgegenseite nicht der Wirklichkeit entsprechen.73 Diese Täuschungshandlung muss auch immer kausal für die geschäftliche Handlung des getäuschten Marktteilnehmers sein. Das Relevanzerfordernis stellt daher klar, dass ein Unterlassen erst relevant ist, wenn die Geschäftspraktik geeignet ist den anderen Marktteilnehmer zu einer geschäftlichen Entscheidung zu verleiten, die er bei Kenntnis der wahren Sachlage nicht getroffen hätte. Es muss also ein Kausalzusammenhang zwischen der durch die Täuschung hervorgerufenen Fehlvorstellung und des gesetzten Verhaltens des Abnehmers vorliegen.74 Das Relevanzerfordernis ist auch als eine Art Bagatellschwelle anzusehen. Wenn es sich bei den Informationen über die getäuscht wurden nur um etwas so Nebensächliches oder gar Geringfügiges handelt, dass diese die Entscheidung des anderen 70 Horak, Zugabenverbot: Veröffentlichung von Gewinnnummern im Teletext keine gleichwertige Alternative zu Zeitungskauf, ecolex 2008/315. 71 OGH 30.01.2008, 3 Ob 273/07d. 72 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 495. 73 RIS-Justiz RS0078541. 74 Thöni, Relevanzerfordernis bei unvollständiger Kaufinformation?, ecolex 2009, 972, 973. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 23/40
Marktteilnehmers gar nicht beeinflussen wird, dann kann das potentiell irreführende Verhalten auch dem wettbewerbsrechtlichen Erheblichkeitserfordernis nicht standhalten.75 Ob das Erfüllen aller Tatbestandselemente alleine ausreicht, um eine irreführende unlautere Geschäftspraktik per se bejahen zu können, oder ob eine Prüfung der Relevanz der Irreführung vorzunehmen ist, ist strittig. Ein Teil des Schrifttums schließt aus der Wortfolge des Art 7 Abs 2 RL-UGP „jeweils […] geeignet“, dass eine Prüfung der geschäftlichen Relevanz immer vorzunehmen ist.76 Der EuGH entschied, dass Art 6 RL-UGP lex specialis zu Art 5 Abs 2 RL-UGP ist, worin dieser Teil der Lehre bei allen Fällen einer Irreführung iSd Art 6 RL-UGP, angelehnt an Art 5 Abs 2 RL-UGP, die Täuschungseignung zwingend prüft.77 Davon abgeleitet sehen Hintermayr und Mayr, dass auch Art 7 RL-UGP lex specialis zu Art 5 Abs 2 RL-UGP ist und man folgerichtig auch hier, ua im Hinblick auf den allgemeinen Zweck der Richtline auf den der EuGH nicht nur einmal verweist, nämlich den Verbraucherschutz, die Täuschungseignung zu prüfen habe. Der Entscheidung Konsumentenombutsmann/Ving Sverige78 worin keine tatsächliche geschäftliche Handlung des Verbrauchers gesetzt wurde, ist zu entnehmen, dass sich der EuGH für die verpflichtende Prüfung der geschäftlichen Relevanz ausspricht.79 Der überwiegende Teil der Lehre80 (und auch der BGH81) lässt jedoch das Erfüllen der objektiven Tatbestandselemente des § 2 Abs 4 UWG genügen, was eine Prüfung der Täuschungseignung nicht mehr erforderlich macht. Hier wird diese rein durch das Erfüllen des objektiven Tatbestandes unwiderruflich angenommen. Dieser Teil der Lehre vertritt, dass das Fehlen von verpflichteten Informationen iSd Art 7 Abs 4 RL-UGP allein schon ausreicht, um geeignet zu sein den anderen Marktteilnehmer in rechtswidriger Weise in die Irre zu führen. Eine fehlende Relevanz der Irreführung in diesem Fall stelle eher die Ausnahme dar. 82 75 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2 § 2 Rz 49. 76 Hintermayr/Mayer, Zur Auslegung einer „irreführenden Geschäftspraxis“, ZIR 2014, 142, 147. 77 EuGH 19.12.2013, C-281/12 Rz 30 (Sviluppo). 78 EuGH 12.05.2011, C-122/10 (Konsumentenombudsmann/Ving Sverige). 79 Hintermayr/Mayer, ZIR 2014, 147. 80 etwa Anderl/Appl in Wiebe/Kodek, UWG2, § 2 Rz 480; auch die Anm von Noha zu OGH 18. 11. 2008, 4 Ob 186/08v ecolex 2009/89. 81 BGH 21. 12. 2012, I ZR 190/10 GRUR 2012, 842 Rz 25. 82 Hoeren, Das neue UWG - der Regierungsentwurf im Überblick, BB 2008, 1182, 1186. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 24/40
Der OGH sprach sich in seiner älteren Jud immer für eine verpflichtende Prüfung der Relevanz aus. Er legte dar, dass eine Verhaltensweise, die das geschäftliche Verhalten eines Abnehmers in keiner Weise berührt, weder eine Verletzung der Generalklausel des § 1 UWG noch von § 2 UWG darstellt.83 In einer jüngeren E lässt der OGH das Vorenthalten einer wesentlichen Information allein genügen um den Irreführungstatbestand, ohne einer gesonderten Relevanzprüfung, zu erfüllen. Dies begründet er mit dem Wortlaut des § 2 Abs 4 Z 1 UWG84, dem nach Ansicht des Senats keine verpflichtende Relevanzprüfung zu entnehmen ist, da dieser nur von „vorenthalten“ spricht.85 8. Information overload Eine überaus große Fülle an Informationen kann im Einzelfall dasselbe bewirken, wie wesentliche Informationen zu verschweigen, nämlich eine Verzerrung der Markttransparenz. Bei „information overload“ verbirgt der Unternehmer die wesentlichen Informationen unter einer immensen Masse an unwesentlichen.86 Die Täuschung durch „information overload“ kann sowohl als eine Täuschung durch wahre Angaben, als auch als eine Irreführung durch Unterlassung klassifiziert werden.87 C. Sonderfälle Mit der UWG-Novelle 2015 wurden die Tatbestände des Art 7 Abs 2 RL-UGP in § 2 Abs 4 Z 2 UWG übernommen. Diese Sondertatbestände wurden jedoch schon vor der Positivierung von der Rspr angewandt, da dies bei einer EU-rechtskonformen Auslegung der RL-UGP ohnehin unumgänglich war.88 1. Verheimlichen Worin der genaue Unterschied zwischen „vorenthaltenen Informationen“‘ im Grundtatbestand und „verheimlichten Informationen“ in der Z 2 des § 2 Abs 4 UWG liegt, ist aus der RL-UGP nicht klar ersichtlich. In der englischen Fassung der zitierten 83 OGH 4 Ob 186/08v JusIT 2009, 56 (Auer) = ecolex 2009, 246 (Noha). 84 „Eine Geschäftspraktik gilt auch als irreführend, wenn sie unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände […] wesentliche Informationen vorenthält, die der Marktteilnehmer benötigt, um eine informierte geschäftliche Entscheidung zu treffen“. 85 OGH 4 Ob 64/19v RdM 2019, 151 (Steinböck). 86 Schoeller, Eingeschränkte Informationspflicht durch Radiowerbung, MR 2013, 331, 337. 87 Wiebel/ Kodek § 2 Rz 496 ff. 88 OGH 13.02.2007, 4 Ob 233/06b. 03. Februar 2020 Marlene Reichl 25/40
Richtlinie wurden die Wörter „omit“ (unterlassen) und „hide“ (verheimlichen) verwendet.
Daraus kann geschlossen werden, dass der Sondertatbestand der Z 2 die Z 1 um ein
subjektives Element erweitert, nämlich die Absichtlichkeit.89
2. Tarnung des kommerziellen Zwecks
Der andere Fall des § 2 Abs 4 Z 2 UWG ist das Verheimlichen des kommerziellen
Zwecks. Eine solche Tarnung liegt dann vor, wenn es für den Adressaten nicht spürbar
ist, dass die Einschaltung eine kommerzielle Werbung ist und ergo dieser keine
korrekte Einordnung treffen kann. Bei dieser Taktik ist nicht nur problematisch, dass
dem Adressaten nicht klar ist mit einer kommerziellen Einschaltung konfrontiert zu sein,
sondern es liegt weiter die Gefahr einer Überrumplung vor. Abzustellen ist darauf, ob
der Adressat eine Werbung in der bestimmten Situation erwarten konnte. Ist dies der
Fall, liegt keine Irreführung vor.90
Auch wenn eine verhüllte Werbemaßnahme von Z 1191 und Z 2292 des Anhangs zum
UWG nicht erfasst sein sollte, kann es sich um eine irreführende Geschäftspraktik iSd
UWG handeln. In seiner älteren Rsp subsumiert der OGH im Einklang mit dem
Schrifttum das Verschleiern des kommerziellen Zwecks noch unter § 1 UWG.93 Da
jedoch ein Verheimlichen des kommerziellen Zwecks nun ausdrücklich durch
Art 7 Abs 2 RL-UGP mit erfasst wurde, ist eine solche Taktik nun zweifelsohne unter
§ 2 Abs 4 UWG einzuordnen.94
Im Bereich der Tarnung des kommerziellen Zwecks kann man zwischen verschiedenen
Vorgehensweisen differenzieren:
89 Anderl/Appl in Wiebe/Kodek § 2 Rz 963.
90 Hofmarcher, Internet of Things – Wenn (Gebrauchs-)Gegenstände werben, ecolex 2017, 101, 102f.
91 Z 11: Redaktionelle Inhalte werden in Medien zu Zwecken der Verkaufsförderung eingesetzt und das
Unternehmen hat diese Verkaufsförderung bezahlt, ohne dass dies aus dem Inhalt oder aus für den
Verbraucher klar erkennbaren Bildern und Tönen eindeutig hervorgehen würde (als Information
getarnte Werbung).
92 Z 22: Die unrichtige Behauptung oder Erwecken des unrichtigen Eindrucks, dass der Händler nicht für
die Zwecke seines Handels, Geschäfts, Gewerbes oder Berufs handelt, oder fälschliches Auftreten
als Verbraucher.
93 OGH 13.03.2002 4 Ob 1/02d, RIS-Justiz -S0077817.
94 Hofmarcher, ecolex 2017, 103.
03. Februar 2020 Marlene Reichl 26/40Sie können auch lesen