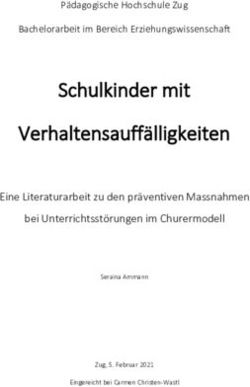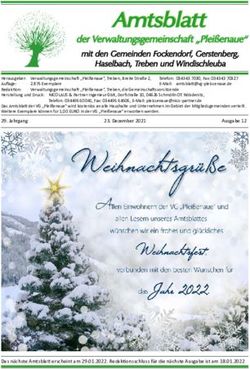Gestaltungsspielräume beim Forschenden Lernen - ein Leitfaden für Lehrende - Working Paper der AG Forschendes Lernen in der dghd - Uni Oldenburg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
dghd Deutsche Gesellschaft
für Hochschuldidaktik
Melanie Sauer-Großschedl, Leona Kruse, Falk Renth & Jörg Großschedl
Gestaltungsspielräume beim
Forschenden Lernen –
ein Leitfaden für Lehrende
Working Paper der AG Forschendes Lernen
in der dghdDiese Working Paper Reihe ist ein Produkt der AG Forschendes Lernen in der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik (dghd). Sie erscheint als Online-Publikation an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und richtet sich an alle, die an Forschendem Lernen interessiert sind. Veröffentlicht werden wissenschaftliche und praxisnahe Beiträge zum Forschenden Lernen. Die Autor_innen müssen nicht Mitglied der AG Forschendes Lernen sein. Veröffentlichungen sind in deutscher und englischer Sprache möglich. Alle eingereichten Beiträge durchlaufen einen Begutachtungsprozess. Herausgeber_innenteam: Dr. Kerrin Riewerts* Dr. Susanne Haberstroh Universität Bielefeld Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Dr. Constanze Saunders* Dr. Janina Thiem Humboldt-Universität zu Berlin Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Susanne Wimmelmann* Georg-August-Universität Göttingen *Sprecher_in der AG Forschendes Lernen in der dghd Redaktion und Kontakt: Dr. Janina Thiem (fl-workingpaper@uol.de) Das Herausgeber_innen-Team bedankt sich beim Vorstand der dghd für dessen Unterstützung der Reihe. Die Working Paper sind abrufbar unter https://www.uni-oldenburg.de/fl-workingpaper/ Herausgeber: Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Druck: BIS-Druckzentrum Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werks darf ohne schriftliche Genehmigung der Autor_innen in irgendeiner Form reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Veröffentlichung der Working Paper Reihe wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und For- schung unter dem Förderkennzeichen FKZ 01PL16056 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Ver- öffentlichung liegt bei den Autor_innen.
Gestaltungsspielräume beim
Forschenden Lernen –
ein Leitfaden für Lehrende
Melanie Sauer-Großschedl, Leona Kruse,
Falk Renth & Jörg Großschedl
Working Paper Nr. 8, 2021
Carl von Ossietzky Universität OldenburgInhaltsverzeichnis
Zusammenfassung / Summary | 4
Einleitung | 5
1 Forschendes Lernen – die bessere Alternative | 6
1.1 Lernziele und überfachliche Kompetenzen | 6
1.2 Idealer Veranstaltungsprozess | 8
2 Grundpfeiler des Forschenden Lernens | 10
2.1 Projektmanagement | 10
2.2 Rückmeldestrukturen | 11
2.3 Reflexion | 12
2.4 Dokumentation | 13
2.5 Präsentation | 13
3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären
Rahmenbedingungen | 14
3.1 Gruppengröße | 14
3.2 Zeit | 15
3.3 Personal | 16
3.4 Vorwissen und Fähigkeiten der Studierenden | 17
3.5 Vorwissen und Fähigkeiten der Dozierenden | 17
3.6 Prüfungsformen | 18
3.7 Materielle Ressourcen | 19
3.8 Verwertbarkeit der Ergebnisse | 19
4 Didaktische Gestaltungmöglichkeiten | 22
4.1 Veränderungen des „idealen Veranstaltungsprozesses“ | 22
4.1.1 Themenfindung (Forschungsgebiet) | 22
4.1.2 Forschungsfrage | 22
4.1.3 Forschungsdesign | 22
4.2 Anregungen zu Unterrichtsmethoden | 24
4.2.1 Gruppenarbeit | 24
4.2.2 Peer-to-Peer | 25
4.2.3 Blended Learning | 25
5 Rolle der Lehrperson | 27
Fazit | 29
Literaturverzeichnis | 30
Autor*innen | 31Zusammenfassung / Summary
Der vorliegende Beitrag geht aus einer interdisziplinä- The results presented in this article are based on an ex-
ren Arbeitsgruppe Hochschullehrender hervor, in der change of an interdisciplinary working group for four
Lehrerfahrungen im Bereich des Forschenden Lernens years. The group members, lecturers in higher educa-
ausgetauscht wurden. Die Ergebnisse dieses mehr als tion, aim to develop a simple practical guide for lectur-
vier Jahre währenden Austausches werden in Form ers in order to alter and consequently improve re-
eines leicht verständlichen Praxisleitfadens zum For- search-based learning activities. This article presents
schenden Lernen zusammengefasst und sollen andere the concept of research-based learning as well as the
Hochschullehrende unterstützen, Lehrveranstaltungen benefits for the students’ experience when applying
nach dem Konzept des Forschenden Lernens umzuge- this approach, with a special focus on the framework,
stalten. Neben dem Konzept des Forschenden Lernens which is needed to successfully implement a research-
zeigt dieser Leitfaden auf, welchen Mehrwert For- based learning course. Moreover, we also show how
schendes Lernen Studierenden, gegenüber anderen research-based learning can be realized under chal-
Lehr- und Lernformaten, bietet. Dabei richtet der Bei- lenging circumstances, e.g., a big group size or limited
trag ein besonderes Augenmerk auf die Rahmenbedin- stuff resources.
gungen, die eine erfolgreiche Implementation For-
Keywords: Higher education didactics, practical guide,
schenden Lernens in der Hochschullehre begünstigen.
research-based learning
In diesem Zusammenhang wird auch aufgezeigt, wie
Forschendes Lernen unter scheinbar ungünstigen Rah-
menbedingungen (z. B. große Gruppengröße, geringe
personelle Ressourcen) sinnvoll umgesetzt werden
kann.
Schlagwörter: Forschendes Lernen, Hochschuldidak-
tik, Praxisleitfaden
4 ____ Zusammenfassung / SummaryEinleitung
Seit die Bundesassistentenkonferenz (1970) ein Ler- Der vorliegende Beitrag bündelt die Ergebnisse eines
nen durch Forschung bzw. eine Beteiligung Studieren- interdisziplinären, vier Jahre währenden Erfahrungs-
der an Forschung (Huber et al., 2009) zu einem An- austausches von Lehrenden der unterschiedlichen
spruch an universitäres Lernen erhob, ist der Begriff Fakultäten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,
Forschendes Lernen aus der hochschuldidaktischen die sich im monatlichen Turnus in der „Fokusgruppe
Diskussion nicht mehr wegzudenken. Forschendes Forschendes Lernen“ trafen und dabei hochschuldidak-
Lernen ist in seinem Wesenskern dadurch bestimmt, tisch durch das Qualitätspakt-Projekt PerLe unterstützt
dass Studierende in einem ergebnisoffenen Prozess wurden. Der Beitrag stellt einen Leitfaden von Lehren-
und hoher Selbstständigkeit Erkenntnisse generieren, den für Lehrende dar und soll andere Lehrende unter-
die auch für Dritte von Interesse sind. Dabei ist das For- stützen, Lehrveranstaltungen so zu planen, dass Stu-
schende Lernen nach Huber et al. (2009) durch Ent- dierende forschend lernen können. Er beschreibt das
scheidungen und Reflexionen in allen Phasen des For- Konzept des Forschenden Lernens, betrachtet seinen
schungsprozesses (auch als Forschungszyklus bezeich- Mehrwert für die Kompetenzentwicklung der Studie-
net) gekennzeichnet. Neben dem Forschenden Lernen renden, bietet praktische und teilweise auch pragmati-
nach Huber et al. (2009) werden verwandte Lehr- und sche Umsetzungsvorschläge, um mit ungünstigen
Lernformate wie Forschungsnahe Lehre (Riewerts Rahmenbedingungen umzugehen, hat jedoch nicht vor
et al., 2013), Lernen im Format der Forschung (Ludwig, in die aktuelle Forschungsdiskussion einzugreifen.
2011), Forschungsorientierte Lehre und Forschungs- Kästchen innerhalb dieses Beitrages...
basierte Lehre (Jenkins & Healey, 2005; Kossek, 2009;
Ludwig, 2011) unterschieden. Im vorliegenden Beitrag greifen relevante Konzepte zur Veranschauli-
wird diese begriffliche/konzeptuelle Differenzierung, chung auf oder geben Beispiele,
wie sie in der (hochschul-)didaktischen Literatur
verweisen auf weiterführende Literatur oder
(Huber, 2014) üblich ist, ausgeblendet. Stattdessen
werden unter Forschendem Lernen in einem weiteren fordern dazu auf innezuhalten, um Entscheidun-
Sinne alle Lehr- und Lernformate verstanden, in denen gen für die eigene Lehrveranstaltung zu treffen.
Studierende selbstständig forschen bzw. in denen sich
Elemente Forschenden Lernens versammeln.
Einleitung ____ 51 Forschendes Lernen – die bessere
Alternative
Im universitären Lehralltag ist Forschendes Lernen bis- fest, welche Kompetenzen1 Studierende erwerben sol-
lang kaum vertreten. Stattdessen wird auch in prak- len, helfen diesen das Wesentliche vom Nebensächli-
tisch orientierten Lehrveranstaltungen überwiegend chen zu unterscheiden und geben Orientierung bei der
der „klassische“ Ansatz der Vermittlung von inhaltli- Auswahl von Lerninhalten sowie der Identifikation
chem, fachorientiertem Wissen verfolgt, bei dem möglicher Prüfungsinhalte. Dabei kommt es bei der
thematische Schwerpunkte oft ohne Spielraum für die Formulierung kompetenzorientierter Lernziele (s. Info-
Lernenden vorab festgelegt werden. Durch das hohe box) v. a. auf die Beantwortung der Frage an, „was die
Maß an Gestaltungsfreiheit und Selbstständigkeit sei- Studierenden am Ende der Lehrveranstaltung können
tens der Studierenden bietet Forschendes Lernen Leh- sollten und wie die Kompetenz beobachtbar und prüf-
renden ein vielversprechendes Lehr- und Lernformat, bar ist“ (Brinker & Schumacher, 2008, S. 183). Viele
um neben Fachwissen auch überfachliche Kompeten- Lehrende setzen hier einen Schwerpunkt auf die fach-
zen zu fördern. Dadurch kommt der bloßen Wissens- liche Kompetenz. Neben der fachlichen Kompetenz för-
vermittlung eine neue Rolle zu – sie ist nicht mehr dert Forschendes Lernen jedoch auch überfachliche
Hauptzweck der Veranstaltung, sondern soll gewähr- Kompetenzen bei den Studierenden (s. Abbildung 1),
leisten, dass die Studierenden einer selbstständigen wie den Umgang mit Unbestimmtheit, Selbstständig-
und aktiven Gestaltung des Forschungsprozesses ge- keit, Sozialkompetenz, Organisationsvermögen und
recht werden können. Dabei übernehmen sie Verant- Kommunikationskompetenz (vgl. Kossek, 2009; Müller,
wortung für ihr eigenes Lernen, bringen kreative Ideen 2010; Schneider, 2009; Wessels et al., 2019). Um Stu-
ein, sind mitunter motivierter und interessierter und dierenden genügend Raum für die Entfaltung eben-
entlasten auf diese Weise auch die Lehrenden, denen dieser Kompetenzen zu geben, müssen sich Lehrende
die Ideen der Studierenden als Inspiration für die zurücknehmen. Dieses „Loslassen“ empfinden jedoch
eigene Arbeit dienen können. viele als eine Form des Kontrollverlustes. Die Formulie-
rung von Lernzielen kann das Gefühl des Kontrollver-
lustes minimieren, da mit ihnen die Bedeutung der
1.1 Lernziele und überfachliche überfachlichen Kompetenzen ins Bewusstsein der
Kompetenzen Lehrenden rückt und das „Loslassen“ nicht mehr nur als
Kontrollverlust empfunden wird, sondern als Lern-
Die hohe Offenheit Forschenden Lernens scheint zu- chance für die Studierenden wahrgenommen werden
nächst schwer vereinbar mit dem Bedürfnis vieler Stu- kann. Wie kompetenzorientierte Lernziele für die
dierender nach klar abgesteckten Lern- und Prüfungs- Gruppe der überfachlichen Kompetenzen aussehen
inhalten. Die Mitteilung der Lernziele an die Studieren- können, soll exemplarisch für den „Umgang mit Unbe-
den ist daher auch beim Forschenden Lernen eine stimmtheit“ und die „Selbstständigkeit“ aufgezeigt
Voraussetzung für erfolgreiche Lehre. Lernziele legen werden (s. Tabelle 1).
1 Wir lehnen uns an den Kompetenzbegriff von Weinert (2001) motivationalen, volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähig-
an, der Kompetenzen als „die bei Individuen verfügbaren oder durch keiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich
sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten [beschreibt], und verantwortungsvoll nutzen zu können“ (Weinert, 2001, S. 27).
um bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen
6 ____ 1 Forschendes Lernen – die bessere AlternativeAbbildung 1:
Fachliche und überfachliche
Kompetenzen greifen ineinander
Bei der Planung einer Lehrveranstaltung nach dem
Konzept des Forschenden Lernens sollten Sie damit begin-
nen die Lernziele festzulegen und mit der Modulbeschrei-
bung abzugleichen. Formulieren Sie Lernziele so, dass Sie
selbst erkennen können, ob diese Lernziele von den Studie-
renden erreicht werden können. In einem präzise formulier-
ten Lernziel legen Sie fest, „wer (1) was (2) wie (3) bis wann
(4) tut (5)“. Beispiel: „Studierende der Pädagogik (1) können
nach Abschluss des Seminars ‚Methodik I‘ (4) selbstständig
(3) Items für einen Fragebogen (2) formulieren (5)“. Dabei
ist es bei der Beschreibung des „Tuns“ wichtig, das erwar-
tete Verhalten präzise, d. h. operationalisierbar zu beschrei-
ben (Operationalisierbarkeit ist z. B. gewährleistet bei Ver-
ben wie „formulieren, berichten, zusammenfassen, verglei-
chen, übertragen, unterscheiden, prüfen, ableiten, ordnen,
begründen, strukturieren“; Operationalisierbarkeit ist nicht
gewährleistet bei Verben wie z. B. „begreifen, erkennen,
einsehen, verstehen, wissen“).
1 Forschendes Lernen – die bessere Alternative ____ 7Tabelle 1: Eine exemplarische Auswahl kompetenzorientierter Lernziele für die überfachlichen Kompetenzen des
„Umgangs mit Unbestimmtheit“ und der „Selbstständigkeit“
Kompetenzbereich Kompetenzorientiertes Lernziel
Umgang mit Die Studierenden...
Unbestimmtheit
... erarbeiten sich ein Überblickswissen über das Forschungsfeld und grenzen den
eigenen Forschungsbereich ein.
... entwickeln eine Forschungsfrage, um diese im Anschluss mit wissenschaftlichen
Methoden zu bearbeiten.
... suchen sich eigenständig Informationen und können diese abwägen, um Entschei-
dungen fällen und begründen zu können.
... fällen Entscheidungen (bezüglich Forschungsbereich, -frage, -methode, -design,
Stichprobe etc.).
... probieren verschiedene Vorgehensweisen aus, überwachen dabei den Forschungs-
prozess und reflektieren das Ergebnis.
... reflektieren Fehler und nutzen diese, um andere Vorgehensweisen einzuschlagen
und zu begründen.
... sind in der Lage, selbst gefundene Antworten gegenüber Kritik argumentativ zu
untermauern.
Selbstständigkeit Die Studierenden...
(fördern)
... nutzen ihr Vorwissen / ihre Stärken, um diese in den Forschungsprozess zu inte-
grieren.
... suchen eigenständig nach benötigten Informationen, um ein Problem zu lösen.
... probieren verschiedene Vorgehensweisen aus, überwachen dabei den Forschungs-
prozess und reflektieren das Ergebnis.
... fällen eigenständig Entscheidungen, die den Forschungsprozess strukturieren (wie
Forschungsbereich, -frage, -methode, -design, Stichprobe etc.) und begründen diese.
... entscheiden sich selbstständig für eine Vorgehensweise bzw. Forschungsmethode
und begründen diese Entscheidung wissenschaftlich.
1.2 Idealer Veranstaltungsprozess gestellung zu formulieren und gegebenenfalls eine vor-
läufige Antwort auf diese Fragestellung in Form einer
Forschendes Lernen folgt naturgemäß den Schritten Hypothese zu finden. Ist die Fragestellung/Hypothese
des Forschungsprozesses. In Anlehnung an Wildt festgelegt, kann das Forschungsdesign entworfen
(2009) wird dieser Forschungsprozess in sieben Pha- werden. Hierbei ist eine genaue Planung der weiteren
sen unterteilt2 (s. Abbildung 2). Er startet in der Regel Schritte notwendig, die u. a. die Beantwortung folgen-
mit der Themenfindung, an die sich die theoretische der nachgelagerter Fragen erfordert: „Welche For-
Fundierung des Forschungsvorhaben anschließt. Im schungsmethode möchte ich zur Erhebung und Aus-
Rahmen einer Literaturrecherche sammeln die Studie- wertung der Daten verwenden?“ und „Welcher Gegen-
renden theoretische und/oder empirische Evidenz, um stand und welche Zielgruppe sollen untersucht wer-
ein logisches Argument für die Sinnhaftigkeit ihrer Fra-
2 Der hier skizzierte Forschungsprozess und das gewählte For- schaftliche) Forschung. Beides muss gegebenenfalls an andere For-
schungsparadigma beziehen sich auf die empirische (sozialwissen- schungsbereiche angepasst werden.
8 ____ 1 Forschendes Lernen – die bessere AlternativeAbbildung 2:
Forschungszyklus einer Lehrveranstaltung
(angelehnt an Wildt, 2009, S. 5)
den?“. In dieser Phase (Entwurf eines Forschungs- ben macht. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen,
designs) findet auch die Projektplanung statt, die Ent- dass ein maximales Maß an studentischer Gestaltungs-
scheidungen über die nächsten Schritte erfordert freiheit dem Konzept des Forschenden Lernens am
(„Was wird bis wann von wem getan?“). Ist der For- besten gerecht wird und dass davon ausgegangen
schungsprozess durchdacht und sind die Rahmen- werden kann, dass ein größerer Gestaltungsspielraum
bedingungen, wie der Zugang zum Forschungsfeld, mit motivationalen Vorteilen (z. B. Begeisterung für
geplant, kann die Durchführung des Forschungspro- Forschung, Freude an der Durchführung des For-
zesses mitsamt der Datenerhebung beginnen. Die er- schungsprojektes, Lernmotivation) verbunden ist. Die
hobenen Daten werden im Anschluss einer Auswer- Rolle der Lehrperson ist dabei die einer Lernbegleitung.
tung unterzogen, gefolgt von einer Interpretation der Sie unterstützt die Studierenden bei auftretenden
Ergebnisse. Diese Interpretation wird dann mit anderen Schwierigkeiten (s. Kapitel 5) und greift ein, falls diese
Forschungsergebnissen auf diesem Gebiet in Bezug den Forschungsprozess und/oder den Verlauf der
gesetzt und mit der Wirklichkeit abgeglichen. Daraus Lehrveranstaltung gefährden.
ergeben sich in der Regel Ideen für künftige For-
schungsvorhaben, sodass Forschung auch als zyklisch
beschrieben wird.
Jede Phase des Forschungszyklus zwingt die Studie-
renden zu begründeten Entscheidungen über die
Gestaltung des Forschungsprozesses. In diesen Ent-
scheidungen kommt auch der Anspruch Forschenden
Lernens zum Ausdruck – die Selbstständigkeit der Stu-
dierenden zu fördern. Dabei liegt es im Ermessen der
Lehrperson, welche Entscheidungen sie den Studieren-
den überlässt und bei welchen sie selbst klare Vorga-
1 Forschendes Lernen – die bessere Alternative ____ 92 Grundpfeiler des
Forschenden Lernens
Bei der Planung einer Lehrveranstaltung nach dem
2.1 Projektmanagement
Konzept des Forschenden Lernens muss sich die Lehr-
person entscheiden, wie weit sie sich zurücknehmen Ein gutes Projektmanagement soll den Forschungspro-
kann, um den Studierenden möglichst viel Gestal- zess möglichst berechenbar und planbar machen, Res-
tungsfreiheit beim Durchlaufen des Forschungspro- sourcen verteilen und Rahmenbedingungen abstecken.
zesses zu gewähren, und wo sie eingreifen muss, um Dabei ist es ein wesentlicher Teil des Projektmanage-
das Erreichen der Lernziele nicht zu gefährden. Dabei ments einen Zeitplan mit verbindlichen Meilensteinen
ist eine Steigerung der studentischen Gestaltungsfrei- aufzustellen. Diese Meilensteine sollten sich aus den
heit nicht zwangsläufig mit einem höheren Kompe- Lernzielen der Veranstaltung ableiten lassen und Be-
tenzerwerb oder einer gesteigerten Lernmotivation zug haben zu den wichtigsten (Teil-)Ergebnissen
assoziiert (Deci & Ryan, 1993); ein Mehr an Gestal- innerhalb des Forschungsprozesses (z. B. Akquise der
tungsfreiheit birgt auch immer das Risiko des Schei- Stichprobe, Erstellung eines Fragebogens, Zugang zu
terns, was zu Vorbehalten der Studierenden gegen- Laboratorien) und die einzelnen Phasen des For-
über dem Lehr- und Lernformat des Forschendes Ler- schungszyklus sichtbar machen. Innerhalb dieser
nens beitragen kann. Wir schlagen daher fünf Maßnah- Grobstruktur aus Meilensteinen hat es sich bewährt,
men vor, die den Studierenden Sicherheit beim Durch- bereits vorab zeitliche Puffer einzubauen, sodass Ver-
laufen des Forschungsprozesses geben (im Folgenden zögerungen im Forschungsprozess kein Scheitern des
als Grundpfeiler bezeichnet; s. Abbildung 3). Es handelt Forschungsprojektes herbeiführen. Dabei sollte in der
sich dabei um Projektmanagement, Rückmeldestruktu- Lehrveranstaltung auch regelmäßig überprüft werden,
ren, Reflexion, Dokumentation und Präsentation. Diese ob die Meilensteine erreicht werden. Deshalb müssen
Maßnahmen greifen wie Zahnräder ineinander, über- Zeiten für Rückmeldung, Reflexion, Dokumentation
schneiden sowie ergänzen sich und bilden ein hilfrei- und Präsentation als feste Bestandteile im Zeitplan
ches Fundament für eine gelungene Lehrveranstaltung. berücksichtigt werden. Ein gutes Projektmanagement
Grundpfeiler des
Forschenden Lernens
Rückmeldestrukturen
Projektmanagement
Dokumentation
Präsentation
Reflexion
Abbildung 3:
Die fünf Grundpfeiler des
Forschenden Lernens
10 ____ 2 Grundpfeiler des Forschenden Lernens Wer hat die Verantwortung für die Erledigung?
Womit kann die Aufgabe erfüllt werden (mit welchen Voraussetzungen, Ergebnissen, Mitarbeitenden,
Sachmitteln, Methoden usw.)?
Was wird wo und wie dokumentiert?
Wann geschieht was (Zeitpunkt, -dauer, -raum)?
Wo geschieht was (Ort, Raum)?
Mit welchem Aufwand / welchen Kosten ist dabei zu rechnen?
Welche Risiken existieren (Zeit, Kosten, Qualität)?
Was ist besonders zu beachten?
gibt den Studierenden die Sicherheit, dass der For-
2.2 Rückmeldestrukturen
schungsprozess innerhalb des Veranstaltungszyklus
realisierbar ist, und trägt damit zu einer positiven Ar- Rückmeldestrukturen sollten den Informationsfluss
beitsatmosphäre bei. über den Stand des Projektfortschritts und die Qualität
der Projektentwicklung zwischen Lehrenden und Stu-
Das Projektmanagement kann von der Lehrperson
dierenden bidirektional ermöglichen aber auch unter
übernommen, es kann jedoch auch in die Hände der
den Studierenden selbst. Die Aufgabe von Rückmelde-
Studierenden gelegt werden oder aber in gemeinsamer
strukturen ist es allerdings nicht, die Gestaltungsfrei-
Anstrengung erfolgen. Verantworten die Studierenden
heit der Studierenden einzuschränken oder deren Ver-
das Projektmanagement, bauen sie Kompetenzen auch
antwortlichkeit für den Forschungsprozess zu unter-
in diesem, für Forschung relevanten Bereich auf. Mög-
graben. Vielmehr geben Rückmeldestrukturen beiden
licherweise identifizieren sie sich dadurch stärker mit
Parteien – Lehrenden wie Studierenden – ein Gefühl
„ihrem“ Forschungsprojekt, was sich positiv auf moti-
der Sicherheit und machen eine ausgewogene Balance
vationale Variablen auswirken sollte. Studierende ver-
zwischen „forschen lassen“ und angemessener/not-
fügen jedoch nicht über die gleichen Erfahrungen im
wendiger Anleitung überhaupt erst möglich. Der Infor-
Projektmanagement wie die Lehrperson und unter-
mationsfluss zwischen Lehrenden und Lernenden,
schätzen häufig, wie viel Zeit für die einzelnen Phasen
aber auch zwischen den Lernenden selbst, kann durch
des Forschungsprozesses benötigt wird. Entscheidet
verschiedene Faktoren beeinträchtigt werden, so z. B.
sich die Lehrperson dafür, das Projektmanagement den
die Gruppengröße. Wir schlagen drei Methoden vor,
Studierenden zu übertragen, muss diesen auch die
die im Forschungsprozess für Rückmeldungen geeig-
nötige Zeit für diese Aufgabe eingeräumt werden und
net sind – Vordrucke, Exposés und Präsentationen, die
der entwickelte Zeitplan sollte diskutiert und überprüft
die Studierenden nach jeder Phase des Forschungs-
werden. In der Praxis hat es sich daher bewährt, dass
prozesses fertigstellen. Vordrucke können bei einer
die Lehrperson zunächst einen Zeitplan mit verbind-
großen Gruppengröße ein hilfreiches Instrument sein.
lichen Meilensteinen fixiert, während die zugehörigen
Sie sind so aufgebaut, dass Studierende die für die
Arbeitspakete je Meilenstein von den Studierenden
jeweilige Phase des Forschungsprozesses getroffenen
selbst herausgearbeitet werden. Dieses „Mikromana-
Entscheidungen verschriftlichen. Da die Vordrucke eine
gement“ durch die Studierenden kann durch vorberei-
klare Struktur vorgeben, können Lehrende auch bei
tete Hilfestellungen, wie sie im obigen Kasten in Form
einer größeren Anzahl an studentischen Forschungs-
von Fragen aufgezeigt werden, unterstützt werden.
projekten die Verschriftlichungen / Entscheidungen der
Studierenden schnell erfassen. Für die Abgabe der
Vordrucke empfiehlt sich das Festlegen einer verbind-
2 Grundpfeiler des Forschenden Lernens ____ 11lichen Deadline, sodass sich die Lehrperson bereits vor Forschungskontexte zu übertragen und gleichzeitig
dem nächsten Zusammentreffen mit den Studierenden einen Einblick in andere Forschungsansätze erhalten.
ein Bild über den Projektfortschritt machen kann, um
die Zeit im persönlichen Kontakt bestmöglich für Feed-
2.3 Reflexion
back nutzen zu können. Dabei sollte im Voraus festge-
legt werden, dass Vordrucke immer von allen Gruppen- Reflexionsfördernde Maßnahmen stellen einen weite-
mitgliedern gemeinsam zu erstellen sind, da auf diesem ren vorgeschlagenen Grundpfeiler des Forschenden
Weg unterschiedliche Vorstellungen der einzelnen Lernens dar. Sie zielen im Gegensatz zu den zuvor be-
Gruppenteilnehmenden sichtbar werden und die von schriebenen Rückmeldestrukturen auf eine nach innen
der Gruppe getroffenen Entscheidungen auch noch gewandte Betrachtung des eigenen Handelns ab. Re-
später nachvollziehbar bleiben. Neben der Verwen- flexionsfördernde Maßnahmen unterstützen die Stu-
dung von Vordrucken ist auch die Ausarbeitung von dierenden beim bewussten Umgang mit Fehlern und
Exposés und Präsentationen (s. Kapitel 2.5) ein sinn- dem Aufbau von Kompetenzen. Reflexion betrifft folg-
volles Rückmeldeformat, um den studentischen Aus- lich sowohl die Ebene des Forschungsprozesses als
tausch, aber auch den Austausch zwischen Studieren- auch die persönliche Ebene. Die Studierenden durch-
den und Lehrenden zu unterstützen. Während Leh- denken den Forschungsprozess und treffen bewusste
rende darin erfahren sind Rückmeldungen zu geben, Entscheidungen, wie weiter vorzugehen ist. Somit
sind bei geplanten Rückmeldungen durch die Studie- unterstützt Reflexion das eigene Lernen, indem eine
renden gegebenenfalls im Vorfeld Feedbackregeln auf- Metaebene eingenommen wird. Reflexion ist damit die
zustellen bzw. eine Feedbackkultur aufzubauen. Dabei Grundlage für die Entwicklung fachlicher und über-
hat es sich bewährt, am Anfang Kriterien und Leitfra- fachlicher Kompetenzen. Deren Erwerb und Einsatz
gen vorzugeben, die das Feedback strukturieren. Dies wird durch Reflexion während des Forschungsprozes-
ist insbesondere bei der unbeaufsichtigten Rückmel- ses immer wieder sichtbar. Für die Studierenden be-
dung von Studierenden an Studierende, dem soge- deutet die bewusste Wahrnehmung ihrer eigenen Kom-
nannten Peer-to-Peer-Feedback3 von Relevanz (s. Ka- petenzen ein hohes Maß an Sicherheit für das weitere
pitel 4.2.2). Diese Form des Feedbacks entlastet die Durchlaufen des Forschungsprozesses. Wie Reflexions-
Lehrperson und fördert gleichzeitig die Forschungs- prozesse angeregt werden können und welche Instru-
kompetenzen der Studierenden, da diese Gelegenheit mente (z. B. Lerntagebücher, Portfolios) hierbei hilf-
bekommen eigenes Wissen und Können auf andere reich sind, wird bei (Riewerts et al., 2018) beschrieben.
Pecha Kucha und Science Slam
Wer die Präsentation etwas unterhaltsamer gestalten will, kann sich für den Science Slam als Präsenta-
tionsformat entscheiden. Da es sich hierbei um die populärwissenschaftliche Aufbereitung der Forschung
in einem Wettkampf handelt, ist diese Form insbesondere geeignet, falls die Präsentation vor einem
breiten, fachfremden Publikum stattfinden soll. Bei dem Format Pecha Kucha handelt es sich um eine
Präsentationsform, in der die Anzahl der Folien auf 20 Stück begrenzt ist. Jede Folie hat eine 20-sekün-
dige Projektionsdauer. Die Gesamtdauer des Vortrags beträgt somit 6 Minuten und 40 Sekunden. Dabei
wird möglichst auf Text verzichtet. Gerade durch die kurze Präsentationsdauer kann dieses Präsenta-
tionsformat hilfreich sein, z. B. um zeitökonomisch Rückmeldung einzuholen.
3 Beim Peer-to-Peer-Feedback handelt es sich um eine Unter- Personen der gleichen Statusgruppe (hier Studierende) Ideen, Wissen
richtsmethode, die mit dem Ziel eingesetzt wird, dass verschiedene und Erfahrung austauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen.
12 ____ 2 Grundpfeiler des Forschenden Lernens2.4 Dokumentation 2.5 Präsentation
Eine Forschungsarbeit ist ein Projekt, welches sich über Den letzten Grundpfeiler des Forschenden Lernens bil-
mehrere Wochen, Monate oder gar Jahre erstreckt. den regelmäßige Präsentationen, bei denen die Studie-
Damit zu jedem Zeitpunkt jeder Schritt nachvollzogen, renden in schriftlicher und/oder mündlicher Form über
erklärt und dargelegt werden kann, ist eine kontinuier- ihren Forschungsstand (Kapitel 2.1) berichten. Dabei
liche und lückenlose Dokumentation des gesamten ist die Präsentation nicht trennscharf zu den anderen
Forschungsablaufs unabdingbar. Dabei sollte die Grundpfeilern des Forschenden Lernens zu verstehen.
Dokumentation bereits die ersten Gedanken zum For- Vielmehr ermöglicht die Präsentation das Einholen von
schungsvorhaben festhalten und dann kontinuierlich Rückmeldungen (Kapitel 2.2); sie stellt zudem eine
alle weiteren Entscheidungen verschriftlicht darlegen Form der Dokumentation (Kapitel 2.4) dar und regt
und begründen. Hierbei ist auch ein Fixieren von Refle- Reflexionsprozesse (Kapitel 2.3) an. Eine Präsentation
xionsergebnissen und erfahrenen Rückmeldungen von kann im Plenum, einer ausgewählten Gruppe von Stu-
Relevanz. Dokumentation sollte jedoch nicht zum dierenden (Peer-to-Peer, Kapitel 4.2.2) oder vor der
Selbstzweck werden, sondern den Forschungsprozess Lehrperson erfolgen.
vorantreiben; eine genaue Dokumentation, z. B. in
Neben den Zwischenständen im Verlauf des For-
Form eines Protokolls, erleichtert die spätere Präsenta-
schungsprozesses sollte das jeweilige Forschungspro-
tion des Forschungsprojekts in Form eines Posters,
jekt zu seinem Abschluss auch in Gänze präsentiert
eines Vortrags oder eines Manuskripts. Sofern es die
werden. Die Form der Präsentation kann z. B. in Form
Prüfungsordnung erlaubt, kann die schriftliche Doku-
eines Manuskripts (mehr dazu in Kapitel 3.8), eines For-
mentation der Studierenden auch zur Leistungsbeur-
schungsberichts, Lerntagebuchs oder Portfolios erfol-
teilung herangezogen werden.
gen. Auch mündliche oder Kombinationen aus mündli-
chen und schriftlichen Präsentationen sind denkbar,
wie sie z. B. in Form von Forschungsvorträgen, Poster-
präsentationen, Pecha Kuchas oder Science Slams er-
folgen können (s. Infobox). Da das Lernen beim For-
schenden Lernen im Mittelpunkt steht, ist die Reflexion
(s. Kapitel 2.3) fester Bestandteil der Präsentation.
2 Grundpfeiler des Forschenden Lernens ____ 133 Lösungsvorschläge zum Umgang
mit universitären Rahmenbedingungen
Abbildung 4:
Übersicht über verschiedene
universitäre Rahmenbedingungen
Häufig begrenzen die vorherrschenden Rahmenbedin- Arbeiten Studierende an einem gemeinsamen For-
gungen die Gestaltungsfreiheit der Studierenden beim schungsprojekt, nimmt mit der Gruppengröße auch das
Forschenden Lernen. Die in Abbildung 4 aufgezeigten Risiko zu, dass sich einzelne Personen aus der Projekt-
Rahmenbedingungen verdienen besondere Aufmerk- arbeit ausklinken, ohne einen wesentlichen Beitrag zu
samkeit. leisten. Dieses Risiko kann minimiert werden, indem die
Studierenden auf Kleingruppen verteilt werden, die an
3.1 Gruppengröße verschiedenen Teilprojekten arbeiten (s. Kapitel 4.2.1).
Dadurch wird zwar die Anzahl an Forschungsprojekten
Während der Betreuungsaufwand einer Vorlesung üb-
erhöht, aber es steigt – positiv gewendet – die Vielfalt
licherweise kaum von der Größe der Lerngruppe ab-
an Projekten und es ergeben sich Möglichkeiten, zum
hängt, nimmt er in Veranstaltungen, die dem Konzept
des Forschenden Lernens folgen, mit steigender Grup- Abschluss der Lehrveranstaltung das beste Projekt
auszuzeichnen.
pengröße deutlich zu. Mit steigender Gruppengröße
verändert sich zudem die Kommunikation und die Die Anzahl der Forschungsprojekte kann durch eine
Interaktion innerhalb der Lerngruppe. Größere Lern- Vergrößerung der Studierendenzahl pro Teilprojekt
gruppen sind außerdem prädestiniert für eine größere verringert werden. Dabei sollte jedoch stets sicher-
Heterogenität und können ein Mehr an materiellen gestellt werden, dass die Teilprojekte arbeitsfähig
Ressourcen, z. B. in Form von Verbrauchsmaterialien bleiben und sich einzelne Gruppenmitglieder nicht
für die Laborarbeit, benötigen (s. Abbildung 5). Um unbemerkt aus der Projektarbeit ausklinken können.
diese Herausforderung zu meistern, schlagen wir die
folgenden Maßnahmen vor:
14 ____ 3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären RahmenbedingungenAbbildung 5:
Auswirkung der Gruppengröße
auf die Lehrveranstaltung
Werden mehrere kleinere Forschungsprojekte reali-
3.2 Zeit
siert, sollten diese einen gemeinsamen thematischen
Schwerpunkt und/oder die gleiche Forschungsmetho- Die zur Verfügung stehende Zeit stellt meist eine nicht
dik teilen. Dadurch wird zwar die Diversität der Teil- änderbare und gleichzeitig stark determinierende Rah-
projekte eingeschränkt, Überschneidungen zwischen menbedingung beim Forschenden Lernen dar. Soll ein
den Teilprojekten machen jedoch Phasen mit instruk- Forschungsprojekt eigenständig geplant, durchgeführt,
tionalem Charakter relevant für die gesamte Lern- ausgewertet und präsentiert werden, ist der vorgese-
gruppe, strukturieren die Vielfalt der Teilprojekte und hene Zeitrahmen (i. d. R. ein Semester) meist sehr
minimieren den Betreuungsaufwand für die Lehr- knapp bemessen. Hierbei leistet ein gutes Projekt-
person. Gleichzeitig kann sichergestellt werden, dass management durch die Lehrperson in Form von Zeit-
die Anforderungen an die Studierenden vergleichbar plänen und/oder Vordrucken Abhilfe und kann eine
gehalten werden, wodurch auch Peer-to-Peer-Feed- zeitökonomische Umsetzung gewährleisten. Die Erfah-
back leichter umgesetzt werden kann. rung zeigt allerdings, dass bereits die Suche nach einer
passenden Forschungsfrage und die theoretische Fun-
Eine große Lehrveranstaltung mit vielen Studieren-
dierung derselben viel Zeit in Anspruch nehmen. In der
den schränkt die Kommunikation zwischen Lehrenden
Regel kennen Studierende den aktuellen Forschungs-
und Studierenden ein, da auf Fragen oder Probleme
stand nur eingeschränkt, sodass es ihnen schwerfällt,
u. U. nicht mehr im Detail eingegangen werden kann.
eine innovative Forschungsfrage zu finden. Häufig fehlt
Mittels Peer-to-Peer-Feedback können Beratungs-
ihnen auch die nötige Erfahrung, sodass ihre For-
verantwortlichkeiten jedoch an die Studierenden de-
schungsfragen mitunter zu ambitioniert sind. Daher
legiert werden, sodass der Betreuungsaufwand der
kann viel Zeit für die konkrete Umsetzung des For-
Lehrperson sinkt, die Studierenden ein Kompetenz-
schungsprojektes gewonnen werden, wenn die Lehr-
erleben erfahren und gleichzeitig die Gelegenheit er-
person das Forschungsgebiet (s. Kapitel 4.1.1) bereits
halten, das im Rahmen ihrer eigenen Forschungstä-
vorab eingrenzt oder sogar die Forschungsfrage (s. Ka-
tigkeit erworbene Wissen und Können auf andere
pitel 4.1.2) vorgibt. Zudem ist der gezielte Einsatz von
Forschungsprojekte zu übertragen (s. Kapitel 4.2.2).
Ressourcen wie Apparaturen oder Computerprogram-
Die Kommunikation der Lehrperson mit den Klein- men hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit und ihres Nutzens
gruppen kann über eine studentische Gruppenlei- für das Forschungsprojekt zu prüfen. Beispielsweise
tung erleichtert werden, die Fragen zum / Schwie- kann mittels Online-Befragungen in der empirischen
rigkeiten im Forschungsprojekt gebündelt an die Sozialforschung die Zeit der Dateneingabe eingespart
Lehrperson heranträgt oder bei dieser Feedback ein- werden. Ebenso könnten im Vorfeld Teilnahmevoraus-
holt. Auf diese Weise wird die Abstimmung zwi- setzungen definiert werden, sodass nur Studierende
schen Lehrperson und Studierenden (z. B. Termin- mit ausreichenden Vorkenntnissen teilnehmen können.
findung) vereinfacht. Zeit für individuelles Feedback und Raum für Diskurs
3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären Rahmenbedingungen ____ 15kann jedoch auch gewonnen werden, indem einzelne
3.3 Personal
Lehrinhalte auf Online-Plattformen oder in Form von
Blended Learning-Szenarien (s. Kapitel 4.2.3) ausge- Die universitäre Rahmenbedingung „Personal“ bezieht
lagert werden. Beispielsweise können vorhandene sich auf die nicht-ideale Anzahl Lehrender für eine
Videos aus dem Internet zur Verfügung gestellt wer- Lehrveranstaltung. Dabei können Probleme auftreten,
den, um Studierende mit statistischen Methoden ver- wenn zu wenig Lehrpersonal vorhanden ist aber auch,
traut zu machen. Ebenso können Lernmaterialien auf wenn sich Lehrende abwechseln oder Parallelver-
einer Lernplattform zugänglich gemacht werden, so- anstaltungen von verschiedenen Lehrenden betreut
dass z. B. das Aufarbeiten von Lernstoff oder auch das werden.
Vorbereiten auf die Lehrveranstaltung erleichtert wird
Einige Lösungsmöglichkeiten, die eine Lehrperson bei
und aufkommende Fragen in der Präsenz beantwortet
einem ungünstigen Betreuungsverhältnis (zu wenig
werden können (sogenannter Inverted/Flipped Class-
Lehrpersonal) hat, wurden bereits in Zusammenhang
room-Ansatz4). mit der Gruppengröße (s. Kapitel 3.1) in Form des Peer-
Steht dagegen ein sehr langer Zeitraum (mehrere Se- to-Peer-Feedback (s. Kapitel 4.2.2) und in Zusammen-
mester) für das Forschungsprojekt zur Verfügung, kann hang mit dem Faktor Zeit (s. Kapitel 3.2) in Form von
der erforderliche Spannungsbogen mit der Zeit verlo- Blended Learning-Szenarien vorgestellt (s. Kapitel
ren gehen. Um „Durststrecken“ zu überwinden und die 4.2.3). Gegebenenfalls können Lehrende durch die Ein-
Motivation der Studierenden aufrechtzuerhalten, muss führung einer Teilnehmendenbegrenzung entlastet
den Studierenden immer wieder aufgezeigt werden, werden, um sicherzustellen, dass alle Studierenden
welches Ziel sie verfolgen, an welcher Stelle des For- (-gruppen) fachgerecht betreut werden können und
schungsprozesses sie sich aktuell befinden und welche Lehrende den Überblick über die Projekte behalten. Ist
Lernfortschritte sie gemacht haben. Der Lernfortschritt dies nicht möglich, so können Lehrende die Größe der
kann aufgezeigt werden, indem die erreichten Lern- Kleingruppen erhöhen. Zu überlegen ist, für die Lehr-
ziele (s. Kapitel 1.1) vergegenwärtigt werden. Es soll- veranstaltung gewisse Vorkenntnisse vorauszusetzen,
ten zudem Fehler oder Irrwege im Forschungsprozess damit theoretischer Input möglichst geringgehalten
im Rahmen von Reflexions- (s. Kapitel 2.3) und Feed- werden kann. Des Weiteren können die studentischen
backgelegenheiten (s. Kapitel 2.2) aufgearbeitet wer- Freiheitsgrade (s. Kapitel 4.1) insoweit eingeschränkt
den und den Studierenden gezeigt werden, wo sie ihr werden, dass z. B. bei Gruppenarbeiten alle Gruppen
Vorwissen produktiv einbringen konnten. Dabei kann dasselbe Thema behandeln, aber jeweils eine andere
es motivierend wirken, wenn die Relevanz des Gelern- Methode anwenden.
ten für das gesamte Studium bzw. den später ange- Steht hingegen eher viel Personal zur Verfügung, so er-
strebten Beruf aufgezeigt wird. Motivationale Vorteile leichtert das die Durchführung der Lehrveranstaltung.
können auch durch ein selbstständig gewähltes Thema Die Lehrveranstaltung könnte aufgeteilt, in Parallel-
(s. Kapitel 4.1.1) bzw. eine selbst gewählte For- kursen oder mit mehr Personal durchgeführt werden.
schungsmethode (s. Kapitel 4.1.3) sowie die abschlie- Jedoch gilt es auch hier einige Aspekte zu berücksich-
ßende Publikation des Forschungsprojektes (s. Kapitel tigen: Allgemein sollte bei der Kooperation mehrerer
3.8) erreicht werden. Insbesondere bei einer geplanten Lehrender bedacht werden, dass eine gut strukturierte
Publikation des Forschungsprojekts ist mit einem Zusammenarbeit das Fundament ihrer gemeinsamen
hohen Zeitaufwand zu rechnen, sodass trotz eines Arbeit ist. Die Struktur muss präzise klären, wer wann
hohen Zeitkontingents gegen Ende noch Zeitnot auf- welche Aufgabe übernimmt. Daher ist in diesem Fall
kommen kann. So müssen ein Manuskript erstellt, ein auch bei den Lehrenden Teamarbeit gefragt. Wichtig
Reviewprozess überstanden und eine möglicherweise ist ebenfalls, dass die Prüfungsanforderungen durch
aufwändige Überarbeitung des eingereichten Manu- eine gute Kommunikationsstruktur zwischen den Leh-
skripts geleistet werden. Deshalb ist auch unter dieser renden, studentischen Hilfskräften und Assistierenden
scheinbar günstigen Bedingung ein adäquates Projekt- transparent gemacht werden, um z. B. einheitliche Aus-
management (s. Kapitel 2.1) inklusive regelmäßiger sagen auf die Fragen Studierender zu gewährleisten.
Treffen und Arbeitsphasen unerlässlich.
4 Mit den Begriffen „Inverted Classroom“ bzw. „Flipped Class- Verfügung gestellten Inhalte meist zuhause eigenständig an. Die
room“ wird ein Unterrichtskonzept bezeichnet, in dem die üblichen Präsenzveranstaltung wird zur gemeinsamen Vertiefung des Ge-
Aktivitäten innerhalb und außerhalb des Hörsaals „umgedreht“ wer- lernten genutzt (vgl. E-teaching.org, 2020).
den. Die Lernenden eignen sich die von den Lehrenden digital zur
16 ____ 3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären Rahmenbedingungen3.4 Vorwissen und Fähigkeiten relevanten Forschungsgebiet selbst. Neben Leitfäden
(z. B. Sonntag et al., 2017) können Lehrende Work-
der Studierenden shops besuchen, Beratungstermine vereinbaren,
Kolleg*innen nach ihren Erfahrungen befragen, Team-
Auch beim Forschenden Lernen stellen die vorhande-
Teaching umsetzen oder auch Möglichkeiten zur Hos-
nen Kompetenzen der Studierenden eine wichtige Ge-
pitation wahrnehmen. Außerdem kann der eigenen
lingensbedingung dar. Mangelnde Kompetenzen erhö-
Unsicherheit mit verschiedenen Maßnahmen begegnet
hen den Betreuungsaufwand und können den Zeitplan
werden.
der Lehrveranstaltung gefährden. Generell stehen Leh-
renden verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Die Lehrperson sollte den Studierenden erklären,
mit ungünstigen Ausgangsbedingungen seitens der was sie selbst am Forschenden Lernen begeistert
Studierenden umzugehen. Dabei unterscheiden wir und wo die Potenziale dieses Lehr- und Lernformats
zwischen (a) Maßnahmen, die dem Kompetenzaufbau liegen.
dienen, und (b) Maßnahmen, die eine Vereinfachung Die Lehrperson sollte ansprechen, dass sie mit dem
des Forschungsprozesses herbeiführen. Lehr- und Lernformat des Forschenden Lernens
a) Maßnahmen, die dazu dienen, ein Kompetenzdefizit selbst „Neuland betritt“. Damit sorgt die Lehrperson
auf Seiten der Studierenden auszugleichen, können nicht nur für Transparenz hinsichtlich der eigenen
verschiedenartig sein. Beispielsweise kann den Stu- Erfahrungen, sondern ermöglicht den Studierenden
dierenden ein zeitökonomischer Überblick über das ein Einbringen auf Augenhöhe.
Themengebiet in Form von frontal gestalteten Lehr- Die Lehrperson sollte die Studierenden dazu ermuti-
situationen (z. B. Vortrag) gegeben werden. Da der- gen, eigene Forschungserfahrungen einzubringen.
artige Lehrsituationen jedoch selten auf die Lernvor-
aussetzungen aller Studierenden abgestimmt sein Die Lehrperson kann auf Materialien/Daten anderer
können, bieten sich besonders in sehr heterogenen Lehrender zurückgreifen, die Erfahrungen im For-
Lerngruppen auch Blended Learning-Szenarien an schenden Lernen oder der zu behandelnden Thema-
(s. Kapitel 4.2.3), bei denen Quellen und Materialen tik haben. Hilfreiche Informationen könnten z. B. zu
wie z. B. Wikis, Foreneinträge, Texte, Podcasts relevanten Fragestellungen, einer geeigneten Grup-
online zur Verfügung gestellt werden und von den pengröße oder der Nutzung von verfügbaren Res-
Studierenden bedarfsgerecht zur Vor- und Nach- sourcen eingeholt werden.
bereitung (Zeitplan vorgeben!) ausgewählt werden Die Lehrperson teilt die Studierenden spezifischen
können. Diese Blended Learning-Szenarien können Expert*innengruppen zu, in denen kleinere Arbeits-
auch im Sinne des Inverted Classroom umgesetzt pakete des zu behandelnden Themas bearbeitet
werden. Während diese Maßnahmen von der Lehr- werden. Anschließend teilen die Expert*innen die
person umgesetzt werden, übernehmen beim Peer- erarbeiteten Inhalte und Ergebnisse mit anderen
to-Peer-Feedback die Studierenden selbst Verant- Studierenden (s. a. Gruppenpuzzle).
wortung füreinander und unterstützen sich gegen-
Die Lehrperson kann die Freiheitsgrade der Studie-
seitig (s. Kapitel 4.2.2).
renden zunächst reduzieren, um das Lehr- und Lern-
b) Maßnahmen zur Vereinfachung des Forschungspro- format zu vereinfachen. Beispielsweise können be-
zesses wurden bereits oben vorgestellt. Um Zeit zu stimmte Themengebiete oder Forschungsmethoden
gewinnen greift die Lehrperson steuernd ein und vorgegeben werden (s. a. Kapitel 3.2 & 4.1).
macht z. B. Vorgaben hinsichtlich der Wahl des
Die Lehrperson kann die Lehrveranstaltung stärker
Themas oder der Wahl der Forschungsmethode
anleiten, um besser abschätzen zu können, was
(s. Kapitel 3.2 & 4.1).
während des Semesters auf sie zukommen wird und
welche Themen und Fragen aufkommen könnten.
3.5 Vorwissen und Fähigkeiten Die Lehrperson kann Puffersitzungen in den Veran-
staltungsverlauf einplanen, falls die Veranstaltung
der Dozierenden oder Teile des Prozesses unerwarteter Weise mehr
Lehrende, die das Lehr- und Lernformat des Forschen- Zeit in Anspruch nehmen.
den Lernens erstmalig umsetzen, sollten sich gründlich
in die spezifischen Aspekte Forschenden Lernens ein-
arbeiten. Darunter fällt die Auseinandersetzung mit der
Didaktik des Forschenden Lernens, mit den For-
schungsstandards der jeweiligen Disziplin und dem
3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären Rahmenbedingungen ____ 173.6 Prüfungsformen den und sich auf die Lernziele beziehen. Da Forschen-
des Lernen leider kein sehr konventionell angewandtes
Die zu verwendende Prüfungsform für eine Lehrveran- Format ist, können Studierende über die Prüfungsrele-
staltung wird in der Modulbeschreibung und der Fach- vanz von Inhalten verunsichert sein. Daher sollten die
prüfungsordnung festgelegt und sollte dem didakti- Studierenden gleich zu Beginn der Lehrveranstaltung
schen Konzept des Constructive Alignments folgend über die Aspekte der Prüfung informiert werden. Die-
(vgl. Biggs, o. D.) zu den Lernzielen der Veranstaltung ser Hinweis ist besonders für die Lehrveranstaltungen
und ihrer inhaltlichen Ausgestaltung passen. Beim For- bedeutsam, die eine Klausur als Prüfungsformat vorse-
schenden Lernen beschäftigen sich die Studierenden hen. Handelt es sich bei der Prüfungsleistung um eine
mit unterschiedlichsten Forschungsfragen, gestalten Multiple Choice Klausur, können hier Forschungssitua-
den Forschungsprozess, präsentieren die Ergebnisse tionen simuliert werden, in denen Studierende Ent-
ihrer Forschung und reflektieren/hinterfragen das eigene scheidungen hinsichtlich des wissenschaftlich korrek-
Vorgehen (dabei sollten Fehler als Lerngelegenheiten ten Verfahrens mit der Situation treffen müssen oder
begriffen werden). Die Prüfung sollte folglich mindes- entscheiden, wie mit Methoden oder Messfehlern um-
tens drei Aspekte berücksichtigen: den Forschungspro- gegangen werden kann. Bei Prüfungsleistungen mit
zess, das Forschungsergebnis und die Reflexionsleis- offenen Fragen könnte beispielsweise das Beschreiben
tung. Eine Annäherung an diesen Anspruch ist prinzi- des eigenen Forschungsprozesses mit anschließender
piell mittels aller gängigen Prüfungsformen möglich. Interpretation und Reflexion gefordert werden. Bei bei-
Dennoch mag in einigen Fällen eine Anpassung der den Formen gilt, dass der von Studierenden durchlau-
Prüfungsform an die Lernziele des Forschenden Ler- fene Forschungsprozess thematisiert werden sollte,
nens sinnvoll erscheinen, um einen direkteren Zugang statt ausschließlich theoretische Inhalte anzusprechen.
zu den gezeigten Kompetenzen zu erhalten. Abbildung Zur Sicherung der Gleichbehandlung der Studierenden
6 gibt einen Überblick über mögliche Prüfungsformen. muss in allen Fällen gewährleistet werden, dass alle
Studierende die gleichen Lernchancen bezüglich der
Auch gilt es zu berücksichtigen, dass die Kriterien der
prüfungsrelevanten Inhalte erhalten. Dies ist mitunter
Bewertung so transparent wie möglich gehalten wer-
Abbildung 6:
Mögliche Prüfungsformen im Lehr- und
Lernformat des Forschenden Lernens
18 ____ 3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären Rahmenbedingungennur eingeschränkt der Fall, wenn Studierende in Exper- z. B. mit öffentlich zugänglichen Materialien arbeiten.
tengruppen einzelne Kompetenzen vertiefen. Gleiche Bestimmte kostenpflichtige Software kann teilweise
Lernchancen bestehen v. a. bezüglich solcher Inhalte, durch Freeware oder Alternativen ersetzt, manche For-
die beispielsweise in „Inputphasen“ für alle Studieren- schungsfragen auch rein theoretisch entwickelt und
den behandelt wurden. Denkbar wäre auch, dass Stu- bearbeitet werden. Eine weitere Möglichkeit besteht
dierende denselben Forschungsprozess durchlaufen, darin, dass Dozierende ihre Lehrveranstaltung auf eine
d. h., dass die Freiheitsgrade insofern eingeschränkt gewisse Anzahl von Personen beschränken, sodass
werden, als dass alle Studierende dasselbe Thema, die alle Studierenden die Chance haben, die vorhandene
gleiche Forschungsfrage oder -methode usw. in der Ausstattung angemessen nutzen zu können. Themen
Lehrveranstaltung bearbeiten (s. Kapitel 4.1). könnten unter den Studierenden aufgeteilt werden,
sodass nicht alle gleichzeitig ein bestimmtes Gerät o. ä.
3.7 Materielle Ressourcen beanspruchen, sondern im Rotationsverfahren Geräte
nutzen. Darüber hinaus könnten Ressourcen gemein-
In den meisten Fällen stehen für Forschendes Lernen sam mit anderen Instituten oder Universitäten genutzt
nur die Ressourcen zur Verfügung, die für eine frontale werden: Kooperationen stellen eine Möglichkeit dar,
Lehrveranstaltung benötigt werden. Doch ohne die Forschungsfelder zu untersuchen, die Studierende mit
passenden Hilfsmittel ergibt sich für Studierende even- den Mitteln des eigenen Instituts nicht verfolgen könn-
tuell ein schwierigerer Zugang zum Forschungsfeld. ten. Für manche Fachbereiche bietet es sich an, Dritt-
Eventuell mangelt es an den benötigten Apparaturen, mittel, z. B. über Lehrpreise oder Sponsoren einzuwer-
Rohstoffen, Software etc., um Studierenden das ben. Studierende können in diese Phase der Mittel-
Forschen zu ermöglichen. Die möglichen Folgen zeigt einwerbung einbezogen werden (s. Infobox). In einem
Abbildung 7. begrenzten Ausmaß ist es vielleicht möglich, dass die
Ein Forschungsfeld zu erkunden muss nicht unbedingt Studierenden verhältnismäßig günstige Anschaffun-
mit hohen finanziellen Ausgaben verbunden sein. Oft gen selbst tätigen oder eigene Ressourcen (PC, Dru-
kann man auch die Anschaffung von Materialen umge- cker...) einbinden (sofern dies nicht gegen Daten-
hen, indem Studierende ihr Forschungsanliegen kos- schutzrichtlinien verstößt).
tengünstig bis -neutral gestalten. Studierende können
Abbildung 7:
Auswirkung geringer materieller
Ressourcen auf die Lehrveranstaltung
3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären Rahmenbedingungen ____ 19Die Forschungssituation real gestalten – das Einwerben von Mitteln
Falls ein Budget für die Lehrveranstaltung zur Verfügung steht, können Lehrende dieses in ihre Veran-
staltungskonzeption integrieren und reale Forschungsförderung simulieren. Die Mittelverteilung liegt
dann bei der Lehrperson und die Studierenden können diese Mittel und Ressourcen bei der Lehrperson
einwerben. Dabei stellen die Dozierenden einen fixen Betrag für alle Studierenden zur Verfügung und
die Studierenden(gruppen) werben diese durch „Forschungsanträge“ ein. Die Dozierenden bewilligen
diese Mittel oder lehnen sie ab und bitten um Neueinreichung bzw. kürzen das Budget. Somit wären die
Studierenden in die Budgetplanung involviert und hätten zudem noch die Möglichkeit, sich in eine weit-
aus realistischere Simulation eines Forschungsprozesses zu begeben.
3.8 Verwertbarkeit der Ergebnisse Bereits bei der Planung der Lehrveranstaltung sollte
ein Forschungsdesiderat durch die Lehrperson iden-
Ein großer Anreiz für das Durchlaufen eines For- tifiziert werden. Dieses sollte praktische und/oder
schungsprozesses kann die Verwertung der Ergeb- theoretische Relevanz haben, sodass eine Publi-
nisse nach Forschungsende sein, z. B. in Form einer zierbarkeit des Forschungsprojektes nicht per se ge-
Publikation. Dies kann die Motivation sowohl der Leh- fährdet wird.
renden als auch der Studierenden stark erhöhen. Es
Das Forschungsfeld sollte den Interessen der Studie-
sollte dabei aber stets bedacht werden, dass es sich um
renden gerecht werden, sodass diese motiviert sind,
eine Lehrveranstaltung handelt und somit nicht das
sich mit diesem über einen längeren Zeitraum aus-
Ergebnis im Vordergrund steht, sondern das studenti-
einanderzusetzen.
sche Lernen. Das Ergebnis der Forschung und das Ler-
nen der Studierenden schließen sich zwar nicht gegen- Bereits zu Beginn der Lehrveranstaltung sollten rea-
seitig aus, doch stehen sie in einem Spannungsverhält- listische (Leistungs-)Erwartungen an die Studieren-
nis zueinander. Das Ziel der Verwertbarkeit der For- den kommuniziert werden. Dabei sollte Verlässlichkeit
schungsergebnisse der Studierenden hat Einfluss auf und Verbindlichkeit von den Studierenden eingefor-
die Lehrveranstaltung (s. Abbildung 8). Dabei sollten dert werden.
Lehrende folgende Punkte beachten:
Abbildung 8:
„Verwertbarkeit der Ergebnisse“ und die
Auswirkungen auf die Lehrveranstaltung
20 ____ 3 Lösungsvorschläge zum Umgang mit universitären RahmenbedingungenSie können auch lesen