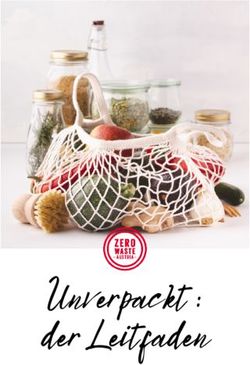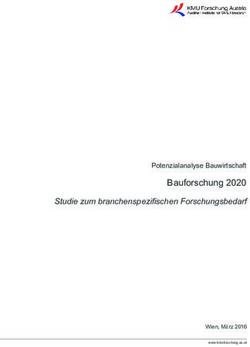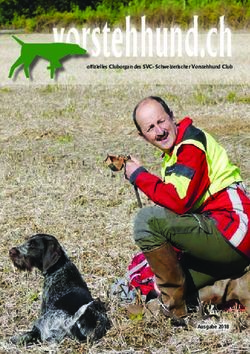Requirements Management - Mit SAP Solution Manager 7.1 - Robin Schönwald André Borrmann
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vorwort In einer Umfrage der Deutschsprachigen SAP-Anwender-
gruppe e.V. (DSAG) wurde gefragt, was die Gründe für
das Scheitern von SAP-Projekten seien. 78 % der Umfra-
geteilnehmer nannten „Unklare Anforderungen“, weitere
74 % „Sich ändernde Anforderungen“.
Unklare Anforderungen und ungenügendes Anforderungsmanagement sind
mit die größten Kostentreiber in IT-Projekten. Nach einer Umfrage der Fach-
hochschule St. Gallen sind 75 % der befragten Unternehmen nicht zufrieden
mit ihrem Requirements Engineering, aber nur ein Drittel geht diese Proble-
me aktiv an.
Dabei verursachen gerade Fehler in den frühen Projektphasen die größten
Folgekosten. Laut einer Studie zu „Testbarkeitsfaktoren und Testaufwand“
haben Anforderungen den größten Einfluss auf die Testkosten. Der Aufwand
für ein professionelles Requirements Engineering zahlt sich im Projektverlauf
doppelt und dreifach aus.
Für den SAP Solution Manager gibt es mit dem Change Request Manage-
ment die Möglichkeit, Änderungen an bestehenden Lösungen aufzunehmen,
zu dokumentieren und nachvollziehbar zu transportieren. Allerdings fehlten
bisher geeignete Werkzeuge, um Anforderungen bei Neuimplementierungen
zu verwalten oder einen vom Change Request Management unabhängigen
iiAnforderungsprozess zu etablieren. Mit der Erweiterung Require- Ziele bei der Entwicklung der Lösung
ments Management for SAP Solution Manager 7.1 (oder kurz: „Re-
quirements Management Add-On“) schließen wir diese Lücke.
Dieses interaktive iBooks-Textbuch beschreibt die Funktionswei-
se der Lösung und kann als Benutzerhandbuch verwendet wer-
den. Weiterhin zeigt es den Prozess der Anforderungsanalyse für
SAP-Projekte und stellt den Zusammenhang zu den anderen Pro-
zessen im Rahmen des Application Lifecycle Management her.
Auf jeden Fall soll es Ihnen helfen, Anforderungen für SAP-Lösun-
gen besser zu analysieren, zu dokumentieren und zu verwalten.
Viel Erfolg!
Interview mit dem Entwicklungsleiter des Requirements Management
Add-On
Robin Schönwald
Business Development Manager
SAP Consulting, Business Technology
Berlin 2012
iiiDanksagung Das Entwicklungsteam
André Borrmann
Petra Heidler
Adina Süß
Tobias Fickinger
Fachliche Expertise
Eric Siegeris
Frank Holzkamp
Bernd Honsa
Weiterer Dank geht an
Studentinnen des Studiengangs Informatik und Wirtschaft der HTW Berlin
Frau Prof. Dr. Juliane Siegeris
ivÜber dieses Buch Sie können das iBook als Anwenderhandbuch für die Lösung „Require-
ments Management for SAP Solution Manager 7.1“ verwenden. Interaktive
Elemente helfen, die Funktionsweise zu erklären und komplexe Zusammen-
hänge zu veranschaulichen. Weiterhin finden Sie Informationen zur Anforde-
rungsanalyse und den weiteren Prozessen im Application Lifecycle Manage-
ment.
In Kapitel 1 „Einführung“ werden einige Begriffe definiert und es wird erklärt,
warum es mithilfe einer Anforderungsanalyse und eines professionellen Anfor-
derungsmanagements einfacher ist, Projekte im geplanten Budget- und Zeit-
rahmen durchzuführen. Weiterhin werden die wichtigsten Aktivitäten der An-
forderungsanalyse skizziert und die Aufgaben des Anforderungsmanagers
beschrieben.
In Kapitel 2 „Application Lifecycle Management“ möchten wir Ihnen zeigen,
wie sich Anforderungen in die weiteren Prozesse im Lebenszyklus einer Lö-
sung einbetten und wie der SAP Solution Manager Sie dabei unterstützen
kann.
Wenn Sie direkt mit der Beratungslösung „Requirements Management for
SAP Solution Manager 7.1“ loslegen wollen, dann starten Sie mit Kapitel 3.
Wir stellen Ihnen die Funktionen vor, erklären die Bedienelemente und wer-
den Ihnen einige Tipps und Tricks zeigen. Der letzte Abschnitt des Kapitels
„Konfiguration des Systems“ ist eher technisch gehalten und erklärt, wie Sie
die Lösung anpassen können.
vAuswertungen und interaktive Reports können über das Require- ben wird, wie Fachkonzepte und Pflichtenhefte im Rahmen des
ments Management Cockpit erstellt werden. Wie Sie das Cockpit Anforderungsmanagement-Prozesses erstellt und mit Anforderun-
bedienen und was die einzelnen Auswertungen bedeuten, finden gen verknüpft werden.
Sie in Kapitel 4.
Das Kapitel „Konfiguration des Systems“ wurde um Beschreibun-
Falls Sie noch nie ein iBooks-Lehrbuch gelesen haben, dann fin- gen zur Anpassung des Genehmigungsworkflows und zur Aktivie-
rung der Volltextsuche ergänzt.
den Sie im Kapitel 5 „iBooks lesen“ einige Hinweise, die bei der
grundlegenden Bedienung von iBooks-Lehrbüchern hilfreich sind.
Im Anhang finden Sie weiterführende Informationen und Kontakt-
daten. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Ihr Feedback.
Das ist neu in der Version 3.0
Im April 2013 wurde das Requirements Management for SAP So-
lution Manager 7.1 in der Version 3.0 ausgeliefert.
In dieser Version gab es folgende neue Funktionen:
• Upload von Anforderungen aus MS Excel
• Massenupdates - Gleichzeitiges Ändern mehrerer Anforderun-
gen
• Umfangreiche neue Auswertungen und Reports mit dem
Requirements Management Cockpit
• Scorecard - Schneller Überblick im Startbildschirm
Das Anwenderhandbuch wurde um entsprechende Kapitel zur Be-
schreibung der neuen Funktionen ergänzt. Weiterhin wurde das
Kapitel „Projekte dokumentieren“ hinzugefügt, in dem beschrie-
viKapitel 1 Einführung Komplexe IT-Projekte haben das Ziel, neue Lösungen zu realisieren und die Anforderungen von Kunden und Anwender umzusetzen. In diesem Kapitel wird beschrieben, was Anforderungen sind und welche Vorteile die strukturierte Verwaltung von Anforderungen im Projektalltag mit sich bringt.
Abschnitt 1
Anforderungen
IN DIESEM ABSCHNITT Warum sind Anforderungen wichtig?
1. Warum sind Anforderungen wichtig? Die Standish Group veröffentlicht jedes Jahr das sogenannte Chaos Manifesto, in
2. GAP-Analyse
dem IT-Manager über den Erfolg ihrer IT-Projekte befragt werden. Eine Frage be-
trifft die Gründe, warum Projekte beeinträchtigt oder abgebrochen werden.
3. Anforderungsanalytiker
4. Funktionale Anforderungen Über 50 % aller genannten Gründe haben direkt oder indirekt etwas mit Anforde-
rungen zu tun. Ganz oben auf der Liste stehen „Unvollständige Anforderungen“
5. Nicht-funktionale Anforderungen
und „Keine Einbeziehung von Anwendern“. Anforderungen sind der Schlüssel, um
ein Projekt durchzuführen und erfolgreich zu beenden.
Diagramm 1.1 Warum Projekte scheitern
Unvollständige Anforderungen
11 % 14 % Keine Einbeziehung von Anwendern
5% Zu wenig Ressourcen
7% Unrealistische Erwartungen
14 %
Sich ändernde Anforderungen
8% Zu wenig Planung
Unnötige Funktionen
9% 12 % Mangelhaftes IT-Management
Technologische Unkenntnis
10 % 11 %
Andere Gründe
Über 50 % aller Gründe, warum Projekte scheitern, betreffen Anforderungen.
Quelle: The Standish Group Report, http://www.projectsmart.co.uk/docs/chaos-report.pdf
8Dabei sind die Kosten zur Etablierung eines professionellen Requi- GAP-Analyse
rements Engineering gering im Vergleich zu den Kosten, die ohne Vielleicht sind Sie schon einmal über den Begriff GAP-Analyse
dieses in späteren Projektphasen verursacht werden. Die Präsen- gestolpert. Eine GAP-Analyse ist eigentlich eine Methode zur Iden-
tation „Kosten von Defects“ illustriert, welche Kosten ein Defect in tifizierung strategischer und operativer Lücken durch die Analyse
den einzelnen Projektphasen verursacht. Wobei ein Defect hier zwischen Ist- und Sollvorgabe.
nicht nur als Fehler in einem Software-Produkt zu verstehen ist,
Im SAP-Umfeld beruht eine GAP-Analyse auf der Idee, dass eine
sondern auch ungenügend formulierte Anforderungen umfasst.
Standard-Software eingeführt wird und nur noch die Lücke zwi-
Nach der bereits im Vorwort zitierten Studie der DSAG gehören schen der vorhandenen und der vom Kunden oder Anwender ge-
unklare und sich ändernde Anforderungen auch in SAP-Projekten forderten Funktionalität geschlossen werden muss.
zu den größten Projektrisiken. Ein GAP ist also eine Anforderung, die nicht im Standard-
Funktionsumfang einer SAP-Lösung abgebildet wird und
Halten wir fest: Anforderungen sind ein entscheidender Faktor da-
dementsprechend die Kosten für die Realisierung einer Lösung
für, ob Ihre Projekte erfolgreich sind und ob der Budgetrahmen
signifikant beeinflussen kann. Eine vollständige GAP-Analyse
eingehalten werden kann.
kann zwar relativ aufwändig sein, ist aber unverzichtbar, um die
Gesamtkosten für eine Lösung verlässlich schätzen zu können.
Wir empfehlen, bei der Neueinführung von SAP-Lösungen diese
Präsentation 1.1 Kosten Abbildung 1.1 zunächst wie im Standard vorgesehen zu installieren. Im zweiten
von Defects Projektrisiken
Schritt wird mit Fachexperten und späteren Anwendern am Sys-
Wozu Anforderungsmanagement in SAP-Projekten?
tem diskutiert, welche zusätzlichen Anforderungen es gibt. Diese
Die größten Projektrisiken in SAP-Projekten
werden dann im Requirements Management Add-On erfasst.
Damit vermeidet man, dass Anforderungen aufgenommen wer-
Zu wenig Zeit in der
Risikomanagement
Zu wenig Know-how über
Ungenügendes
Planungsphase
Anforderungen
Anforderungen
Sich ändernde
SAP-Technologie
Mitarbeiter
überlastet
Unklare
Nicht gut
geplant
den, die bereits im Standard vorhanden sind und reduziert so die
Menge der zu verwaltenden Anforderungen.
63 %
67 %
74 %
75 %
78 %
78 %
78 %
© 2011 SAP AG. All rights reserved. Quelle: DSAG – Deutsche SAP Anwendergruppe, Mai 2005 1
Klicken Sie auf die Präsentation, Nach einer DSAG-Umfrage zu
um die Animation zu starten Projektrisiken
9Anforderungsanalytiker Nicht-funktionale Anforderungen
Ein Anforderungsanalytiker muss einerseits die Anforderungen Nicht-funktionale Anforderungen beschreiben Eigenschaften oder
des Fachbereichs verstehen, diese gleichzeitig aber so aufberei- Qualitätsmerkmale des zu entwickelnden Systems und werden
ten und dokumentieren, dass die IT etwas damit anfangen kann. bei der Spezifikation von neuen Lösungen gerne vergessen. Oft
Umso verwunderlicher, dass es so gut wie keine formale Ausbil- beschreiben nicht-funktionale Anforderungen Einschränkungen
dung hierzu gibt. oder Vorgaben, die ein System erfüllen muss:
Immerhin gibt es seit 2006 das International Requirements Engi- • „Der Entwicklungsprozess muss explizit definiert und mit dem
neering Board, kurz IREB, das es sich „zum Ziel gesetzt [hat], ein ISO 9000 Standard konform sein.“
Zertifizierungsmodell mit Lehrplänen und Prüfungen bereitzustel-
len und damit die Standardisierung der Aus- und Weiterbildung im • „Das Subsystem Y soll mind. 20 Transaktionen pro Sekunde be-
wältigen können.“
Requirements Engineering zu fördern“.
Nicht-funktionale Anforderungen wirken sich häufig auf die gesam-
IREB bietet eine Zertifizierung zum „Certified Professional for Re-
te Architektur einer Lösung aus, während funktionale Anforderun-
quirements Engineering“ in den drei Stufen Foundation, Advan-
gen eher „lokale“ Auswirkungen haben.
ced und Expert an. Das kann hilfreich sein, um die Qualifikation
der eigenen Mitarbeiter in diesem Bereich zu erhöhen. Deshalb sollte man bei einer Neueinführung darauf achten, dass
auch die nicht-funktionalen Anforderungen vollständig erfasst wer-
Funktionale Anforderungen
den und prüfen, wie deren Umsetzung nachgewiesen werden
Funktionale Anforderungen legen fest, was das Produkt tun soll. kann.
Deshalb sind die meisten Anforderungen funktionale Anforderun-
gen, zum Beispiel: Anforderungen priorisieren
Nach einer Studie werden 45 % der realisierten Anforderungen im
• „Das System muss die Möglichkeit bieten, Business Partner an-
Produktivbetrieb gar nicht genutzt. Das mag sich von Anwendung
zulegen, zu verändern und zu löschen.“
zu Anwendung unterscheiden, deckt sich aber im Großen und
• „Das System soll die Möglichkeit bieten, Rabatte in Abhängig- Ganzen mit unseren Erfahrungen.
keit eines Produkts zu definieren.“
Weiterhin gilt das sogenannte Pareto-Prinzip: 80 % der Anwen-
der nutzen normalerweise 20 % der Funktionen. Um herauszufin-
10den, welche Anforderungen wirklich wichtig sind, müssen Anforde- Wenn Sie den Business Blueprint im SAP Solution Manager ge-
rungen priorisiert werden. Bei der Priorisierung sollten folgende pflegt haben, dann können Sie mithilfe des Solution Documenta-
Aspekte berücksichtigt werden: tion Assistent ermitteln, wie häufig Transaktionen genutzt wer-
den.
• Nutzen aus Sicht der Anwender
• Wichtigkeit aus Sicht des Auftraggebers/Sponsors
• Aufwand aus Sicht der Entwickler
• Risiko aus Sicht des Architekten
Diagramm 1.2 Im Betrieb genutzte Anforderungen
Immer
7%
Häufig
13 %
Niemals
45 %
Manchmal
16 %
Selten
19 %
Quelle: Johnson, J., „Keynote speech XP 2002“, Sardinia, Italy
11Abschnitt 2
Anforderungsanalyse
IN DIESEM KAPITEL Die Anforderungsanalyse unterteilt sich grob in die vier Aktivitäten Stakeholder-Ana-
1. Stakeholder-Analyse
lyse durchführen, Anforderungen sammeln, Anforderungen dokumentieren und An-
forderungen verifizieren. Im Folgenden soll der Anforderungsanalyse-Prozess nä-
2. Anforderungen sammeln her betrachtet werden.
3. Anforderungen strukturieren
Stakeholder-Analyse
4. Anforderungen dokumentieren
Stakeholder sind die Informationslieferanten für Ziele, Anforderungen und Randbe-
5. Anforderungen spezifizieren dingungen an eine Lösung oder ein zu entwickelndes Produkt. Das Ziel der Stake-
6. Test und Abnahme
holder-Analyse ist es, alle Faktoren zu erfassen, die das Projekt beeinflussen kön-
nen.
Bei der Einführung von SAP-Lösungen beantwortet die Stakeholder-Analyse auch
die Frage, wer eigentlich Anforderungen an die Lösung hat. Und das sind eben
nicht nur die Anwender und der Fachbereich, sondern auch der SAP-Basisbetrieb,
die Verantwortlichen der Systeme, zu denen es Schnittstellen geben soll, der Sup-
port usw. Auch politische Faktoren sind nicht zu unterschätzen: Wer ist der Projekt-
sponsor, wie sind die organisatorischen Auswirkungen, muss der Betriebsrat einge-
bunden werden?
Bei der Stakeholder-Analyse werden nicht nur Stakeholder identifiziert, sondern es
wird auch dokumentiert, wie hoch ihr Interesse an der Lösung beziehungsweise ihr
Einfluss auf die Lösung ist und welche Einstellung sie zum Projekt haben (positiv,
12negativ oder neutral). Aus diesen Informationen kann eine Einbin- Cases). Dies fördert die Teamarbeit und das gemeinsame
dungsstrategie erarbeitet werden. Verständnis bestimmter Aspekte einer Lösung.
Anforderungen sammeln • Kreativtechniken wie ein Brainstorming oder Mindmaps können
helfen, Denkblockaden zu lösen.
Die Stakeholder-Analyse ist eine gute Möglichkeit, um mit der
Identifizierung von Anforderungen zu beginnen. Danach gibt es
Anforderungen strukturieren
mehrere Methoden, um Anforderungen aufzunehmen:
Bei einer ganz neuen Lösung sind Kategorien hilfreich, um Anfor-
• Das Interview wird gewöhnlich in einem Vieraugen- derungen zu strukturieren. Die Multi-Level-Kategorien des
gespräch geführt. Dabei können Gedanken Requirements Management Add-On stellen eine Mög-
und Ideen relativ frei entwickelt werden, al- lichkeit dar, Anforderungen zu kategorisieren.
lerdings ist diese Methode bei vielen Sta-
SAP-Lösungen werden im Kontext von Ge-
keholdern sehr aufwändig.
schäftsprozessen strukturiert. Die Standard-
• Bei der Fragebogenmethode können Prozesse sind im Business Process Reposito-
die Antworten vieler Stakeholder ausge- ry des SAP Solution Manager hinterlegt.
wertet werden. Bei Multiple-Choice-Fra-
Es wird empfohlen, bei jedem Projekt zunächst
gen sind die möglichen Antworten je-
die zu realisierenden Geschäftsprozesse im Busi-
doch vorgegeben.
ness Blueprint zu definieren und Informationen im
• Bei der Inventurmethode werden vorhandene Kontext von Geschäftsprozessen zu strukturieren.
Unterlagen ausgewertet. Dies ist insbesondere bei Das können Dokumente und Lösungsbeschreibungen
der Ablösung von Altsystemen hilfreich. sein, aber auch Testfälle und Anforderungen. Das Requirements
Management Add-On ermöglicht es, Anforderungen mit dem Busi-
• Die Beobachtungsmethode hilft, Ist-Prozesse zu analysieren ness Blueprint zu verknüpfen.
und Schwachstellen aufzudecken.
Anforderungen spezifizieren
• Bei einem Anforderungsworkshop entwickeln mehrere Beteilig-
Natürliche Sprache ist unser wichtigstes Hilfsmittel, um Anforde-
te (zum Beispiel Anwender, Architekten, Fachexperten, Produkt-
rungen zu beschreiben. Natürliche Sprache kann aber auch unge-
manager) zusammen die wichtigsten Anwendungsfälle (Use
13nau oder mehrdeutig sein. Deshalb ist es hilfreich, Anforderungs- Anforderungen enthalten häufig Aspekte, bei denen sich eine Be-
spezifikationen zu formalisieren: schreibung mit natürlicher Sprache nur bedingt eignet. In Ab-
schnitt 3 werden grafische Modellierungstechniken betrachtet, die
„A142: Wenn der Lichtschalter gedrückt wird, soll das Licht ange-
eine natürlichsprachliche Beschreibung ergänzen können.
hen.“
Glossar
Diese Anforderung ist ein Satz mit folgenden Eigenschaften:
Mit einem Glossar der wichtigsten Begriffe kann die Kommunikati-
• Besteht aus einer einzelnen logischen Aussage on innerhalb eines Projektes und die Spezifikation von Anforderun-
gen entscheidend verbessert werden. In unseren Projekten hat
• Beinhaltet ein Schlüsselwort (MUSS, SOLLTE, WIRD)
sich oft genug herausgestellt: Unter scheinbar eindeutigen Begrif-
• Beinhaltet eine Ursache und eine Wirkung fen verstehen Anwender teilweise etwas völlig anderes.
• Ist klar formuliert und verständlich Ein Glossar kann ganz einfach eine Excel-Liste sein, besser ist a-
ber ein Wiki, bei dem die Anwender Begriffe eingeben oder bear-
• Kann durch eine eindeutige ID nachverfolgt werden beiten können.
• Ist testbar Auch die mit Sprachschablonen formulierten Anforderungen sind
nur dann eindeutig, wenn die verwendeten Fachbegriffe in einem
Mit Hilfe der in Abbildung 1.2 abgebildeten Sprachschablone
Glossar definiert werden.
kann die unzweideutige Spezifikation von Anforderungen verbes-
sert werden. Anforderungen verifizieren
Spezifiziert ein Anforderungsanalytiker eine Anforderung genauer
oder reichert sie durch grafische Modelle an, muss diese Spezifi-
Abbildung 1.2 Sprachschablone für Anforderungen
kation durch den Anforderer oder den Fachbereich verifiziert wer-
den, bevor die Anforderung zur Umsetzung freigegeben wird. Ob
die Anforderung dann korrekt umgesetzt wurde, wird durch den
Abnahmetest nachgewiesen.
14Test und Abnahme Ein Auftraggeber hingegen möchte einen Nachweis haben, dass
Wurde eine Anforderung vollständig spezifiziert und genehmigt, die beauftragten Leistungen (seine Anforderungen) auch erbracht
kann die Umsetzung beauftragt werden. Manchmal werden Anfor- wurden.
derungen bereits durch den SAP-Standard abgedeckt. An dieser Stelle zahlt es sich aus, wenn ein Werkzeug für das An-
In jedem Fall muss ein Nachweis erfolgen, dass die Anforderung forderungsmanagement eine Nachverfolgbarkeit (engl. Traceabili-
entsprechend der Spezifikation ty) von Anforderungen zur Umsetzung und zum Test ermöglicht.
umgesetzt wurde und in dem Pro- Im Requirements Manage-
Film 1.1 Testen und Anforderungen ment Add-On können Sie
duktivsystem korrekt funktioniert.
Anforderungen mit
An dieser Stelle soll nicht auf den Change Requests ver-
gesamten Testprozess eingegan- knüpfen, um den Status
gen werden, sondern nur auf den bei der Realisierung nach-
letzten Schritt: den Abnahmetest zuverfolgen. Weiterhin
(auch User Acceptance Test ge- können Anforderungen
nannt oder kurz UAT). Um nachzu- mit Testplänen und Test-
weisen, dass alle Anforderungen paketen verknüpft wer-
getestet und abgenommen wur- den.
den, muss man sie mit Testfällen
in Beziehung setzen. Der Anforderungsmana-
ger hat so die Möglich-
Ein Projektleiter interessiert sich keit, direkt den Teststatus
im Projektverlauf dafür, wie viele eines Testpakets zu verfol-
Anforderungen realisiert wurden, Bernd Honsa, Principal Testmanagement Consultant der SAP gen, mit dem eine Anfor-
welche getestet und welche abge- derung verknüpft ist. Wei-
nommen wurden. Anhand einer Trendanalyse kann er herausfin- terhin kann er direkt in das Testpaket oder den Testplan navigie-
den, ob das Projekt zum geplanten Zeitpunkt fertiggestellt werden ren, um sich Details anzusehen oder weitere Auswertungsmöglich-
kann. Anforderungen eignen sich übrigens sehr gut, um den Fort- keiten des SAP Solution Manager für den Testbereich zu nutzen.
schritt eines Projektes objektiv nachzuweisen.
15Abschnitt 3
Grafische Modellierung
IN DIESEM KAPITEL Grafische Modellierung
1. Geschäftsprozesse im SAP Solution Neben der Spezifikation von Anforderungen mit natürlicher Sprache werden Anfor-
Manager derungen auch in Form grafischer Modelle abgebildet. Bei bestimmten Aspekten
2. UML - die Unified Modling Language sind grafische Modelle wesentlich effizienter. Wenn Sie schon einmal versucht ha-
ben, einen Prozess in natürlicher Sprache zu beschreiben, wissen Sie, was wir mei-
3. Anwendungsfälle
nen.
4. Grafisches Prototyping
Geschäftsprozesse werden in mehreren Abstraktionsstufen modelliert. Der SAP So-
lution Manager verwendet die folgenden Stufen:
• Geschäftsszenario: Bündelt mehrere Geschäftsprozes-
se zu einem übergeordnetem Szenario, zum Beispiel Be-
schaffung und Bezahlung.
• Geschäftsprozess: Ein Geschäftsprozess beschreibt ei-
ne Folge von logisch zusammenhängenden Einzeltätig-
keiten, die schrittweise ausgeführt werden, um ein ge-
schäftliches oder betriebliches Ziel zu erreichen (Bei-
spiel: Bestellanforderungsprozess).
• Geschäftsprozessschritt: Ein Geschäftsprozessschritt
wird in SAP-Systemen durch eine oder mehrere Transak-
tionen im System abgebildet (Beispiel: Bestellanforderung
erstellen).
16Um Geschäftsprozessmodelle grafisch darzustellen, gibt es meh- spielsweise aus Klassendiagrammen Quellcode für objektorientier-
rere Möglichkeiten. Mit ARIS wurde die eEPK als Notation für die te Programmiersprachen generieren.
Dokumentation von SAP-Geschäftsprozessen populär, SAP Solu-
Für die Anforderungsanalyse haben sich folgende Diagrammty-
tion Manager 7.1 nutzt die BPMN im Business Process Blueprin-
pen als hilfreich erwiesen: Use Case Diagramm, Aktivitätsdia-
ting für die grafische Modellierung.
gramm, Fachbereichsmodell und Zustandsübergangsdiagramm.
UML
Anwendungsfälle
Die Unified Modeling Language ist eine eher technisch orientierte
Anwendungsfälle (engl. Use Cases) beschreiben Interaktionen mit
Modellierungssprache, die in Teilen auch für die technische Spezi-
einem zu entwickelnden Software-System aus Sicht eines Anwen-
fikation verwendet wird. Die meisten UML-Werkzeuge können bei-
ders (dem Akteur) auf einem hohen abstrakten Niveau.
Abbildung 1.3 Business Process Blueprinting Abbildung 1.4 UML-Modelle
Ein Use Case Diagramm ist eine sehr einfache Visualisierung der Use
Cases mit den dazugehörigen Akteuren.
Mit SAP Solution Manager 7.1 können grafische Prozessmodelle in
der BPMN-Notation erstellt werden.
17Anwendungsfälle sind gut geeignet, um Anforderungen zu bün- Hier bietet es sich an, einen grafischen Prototypen zu erstellen,
deln und in einen gemeinsamen Kontext zu stellen. Da die Interak- um den Anwendern ein Gefühl für die Benutzerführung und der
tion immer vom Akteur ausgeht, sind Anwendungsfälle eine hilfrei- Funktionalität der späteren Lösung zu vermitteln. Anforderungen
che Methode, um den Blick von der Funktionalität auf das zu rich- können bei dieser Methode wesentlich früher und genauer defi-
ten, was ein Anwender eigentlich mit dem System machen will. niert werden, sodass die Systemeinführung erfahrungsgemäß
Im Allgemeinen sind Anwendungsfälle aber nicht detailliert genug, deutlich reibungsloser funktioniert. Als Werkzeug kann beispiels-
um sie direkt umzusetzen. Deshalb werden sie durch weitere Be- weise MS Visio oder ein spezielles Prototyping-Werkzeug mit vor-
schreibungen oder mit anderen UML-Diagrammen erweitert. definierten SAP-Inhalten wie iRise eingesetzt werden.
Im Anforderungsmanagement können Anwendungsfälle verwen-
det werden, um detaillierte Anforderungen in einen gemeinsamen
Kontext zu stellen. Dazu nutzt man die Anforderungsbeziehung
„wird erweitert von“ oder „ist enthalten in“. Abbildung 1.5 Grafisches Prototyping mit iRise
Grafisches Prototyping
Die Spezifikation von Anforderungen für bereits bestehende Soft-
ware-Lösungen ist noch relativ einfach. Die Einführung neuer Soft-
ware-Lösungen ist ungleich komplexer, da die späteren Anwender
noch nicht wissen, wie das zukünftige System aussehen oder
funktionieren wird. Eine Spezifikation in Form von Geschäftspro-
zessen oder UML-Diagrammen ist in vielen Fällen einfach zu kom-
plex.
Fachbereichsexperten wissen normalerweise nicht, was sie wol-
len, bevor sie es gesehen und ausprobiert haben. Das kann dazu
führen, dass die wirklich wichtigen Anforderungen erst sehr spät
im Projektverlauf sichtbar werden – mit verheerenden Folgen für
die geplanten Meilensteine und das Projektbudget.
18Abschnitt 4
Anforderungen verwalten
IN DIESEM KAPITEL In einigen Projekten hat der Anforderungsmanager die Aufgabe, die Anforderungs-
1. Die Aufgaben des Anforderungsmanagers
analyse durchzuführen und die Anforderungen zu verwalten. In größeren Projekten
hingegen ist er ausschließlich mit dem Verwalten von Anforderungen beauftragt.
2. Anforderungen erfassen Die Anforderungsanalyse wurde bereits beschrieben, sodass wir uns in diesem Ab-
3. Status und Prozessphasen schnitt auf die Verwaltung von Anforderungen konzentrieren. Wir beschreiben an
dieser Stelle auch tendenziell komplexere Projekte. Es kann deshalb sein, dass die
4. Redundanzen vermeiden
vorgeschlagene Vorgehensweise möglicherweise für Ihr Projekt angepasst werden
muss. Wir gehen zudem davon aus, dass Sie das Werkzeug Requirements Manage-
ment for SAP Solution Manager 7.1 für die Verwaltung von Anforderungen verwen-
den.
Die Aufgaben des Anforderungsmanagers
Der Anforderungsmanager sorgt dafür, dass alle Anforderungen vollständig, konsis-
tent und strukturiert vorliegen. Er ist für den Genehmigungsworkflow zuständig
und erstellt Auswertungen und Trendanalysen für den Projektleiter.
Weitere Aufgaben sind
• das Versionieren und Überwachen von Änderungen,
• das Herstellen der Nachverfolgbarkeit und
• das Reduzieren von Redundanzen.
19Alle Aufgaben setzen ein profundes fachliches und technisches zu ergänzen. Bei komplexen Anforderungen muss zusätzlich eine
Wissen über das Projekt und das zu realisierende System voraus. Anforderungsanalyse durchgeführt werden und die Spezifikation
Einerseits muss ein Anforderungsmanager in der Lage sein, eine ergänzt beziehungsweise erstellt werden. In diesem Fall delegiert
Anforderung in den Kontext eines Geschäftsprozesses einzuord- der Anforderungsmanager die Aufgabe an einen Anforderungsana-
nen, andererseits muss er einschätzen können, ob die Spezifikati- lytiker, falls er sie nicht selbst übernimmt.
on für eine Realisierung ausreichend ist.
Über ein Rechtekonzept und Benutzerrollen kann festgelegt wer-
Anforderungen erfassen den, wer Anforderungen ansehen, wer sie erstellen und wer wel-
Es gibt prinzipiell drei Möglichkeiten, um Anforderungen zu erfas- chen Status ändern kann.
sen:
Status und Prozessphasen
1. Der Anforderungsmanager sammelt alle Anforderungen und Die Abbildung -.- zeigt ein mögliches Zustands-Übergangsmodell
legt sie selbst im Werkzeug an. für eine Anforderung. Zunächst ist eine Anforderung im Status
„Neu“ und durchläuft mehrere Zustände, bevor sie freigegeben
2. Ein eingeschränkter Personenkreis (zum Beispiel alle Anforde-
rungsanalytiker) darf Anforderungen anlegen.
Abbildung 1.6 Zustands-Übergangsmodell
3. Jeder darf Anforderungen anlegen.
Bei der Variante 1 achtet der Anforderungsmanager direkt bei der
Erstellung einer Anforderung darauf, dass alle Anforderungsattri-
bute vollständig gepflegt sind und die Anforderung vollständig
und korrekt beschrieben ist.
Bei der zweiten Variante überprüft der Anforderungsmanager, ob
alle Einträge korrekt sind. Ist dies der Fall, wird der Status der An-
forderung in „geprüft“ geändert.
Bei der dritten Variante werden erfahrungsgemäß nur die wichtigs-
ten Attribute eingepflegt. Der Anforderungsmanager versucht in Eine Anforderung kann mehrere Zustände annehmen, die durch Aktionen verändert
diesem Fall, die Anforderungsbeschreibung so weit wie möglich werden können
20und umgesetzt oder abgelehnt wird. Ein Status wird nicht direkt, Redundanzen vermeiden
sondern über eine Aktion geändert. Über die Änderungshistorie Mehrfach vorkommende Anforderungen, die denselben Inhalt ha-
kann der Anforderungsmanager nachvollziehen, wer eine Anforde- ben (sogenannte Doubletten) verursachen unnötigen Mehrauf-
rung wann geändert hat. wand. Der Anforderungsmanager hat die Aufgabe, Doubletten zu
Der Anforderungsmanager ist dafür zuständig, dass eine Anforde- identifizieren.
rung zügig freigegeben wird. Verbleibt eine Anforderung über eine Es gibt drei Funktionen, die den Anforderungsmanager hierbei un-
längere Zeit in einem Status, fragt der Anforderungsmanager terstützen:
nach und versucht, den Vorgang zu beschleunigen.
1. Mit der Volltextsuche kann nach Texteinträgen gesucht werden.
Nachverfolgbarkeit herstellen
2. Mit der Verknüpfung zum Business Blueprint kann der Anforde-
Häufig sind Anforderungen in anderen Dokumenten beschrieben,
rungsmanager prüfen, ob es ähnliche Anforderungen im glei-
beispielsweise in Fachkonzepten. Der Anforderungsmanager ist
chen Geschäftsprozess gibt.
dafür zuständig, dass man von diesen Dokumenten auf die Anfor-
derung im Werkzeug referenzieren kann, beispielsweise durch An- 3. Über die Multi-Level-Kategorien können Anforderungen einem
gabe der Anforderungs-ID. Das Dokument oder ein Ausschnitt da- Kontext zugeordnet werden.
von kann als Anlage zu einer Anforderung hinterlegt werden.
Kostenschätzung
Ein paar Möglichkeiten zur Generierung von Dokumenten und zur
Neben der Priorität einer Anforderung sind die geschätzten Kos-
Referenzierung von Anforderungen werden im Abschnitt „Projekte
ten für die Realisierung ein entscheidender Faktor, ob und wann
dokumentieren“ beschrieben.
eine Anforderung umgesetzt wird. Der Anforderungsmanager hat
Funktionale Anforderungen werden mit einem Geschäftsprozess die Aufgabe, die Aufwände der an der Umsetzung beteiligten Per-
oder Geschäftsprozessschritt im Business Blueprint verknüpft. sonen zusammenzutragen beziehungsweise zu erfragen und im
Weiterhin kann der Anforderungsmanager oder der Testmanager Feld „Aufwandsschätzung“ zu hinterlegen.
eine Anforderung mit einem Testplan oder Testpaket verknüpfen.
Eine vollständige Beschreibung der Funktionsweise des Require-
Eine Verknüpfung zu einem Change wird automatisch angelegt, ments Management for SAP Solution Manager 7.1 und der Attribu-
wenn die Aktion „Änderungsantrag anlegen“ ausgeführt wird. te einer Anforderung finden Sie in Kapitel 3.
21Kapitel 2 Application Lifecycle Management Mit Application Lifecycle Management werden die Entwicklung und der Betrieb von Applikationen effizi- ent und geschäftsorientiert gestaltet. Die für ein ganzheitliches Application Lifecycle Ma- nagement entwickelten Prozesse, Best Practices, Werkzeuge und Services der SAP helfen Ihnen, Ihre IT-Organisation effizient und nachhaltig zu optimie- ren.
Abschnitt 1
Was ist ALM?
Anforderungsmanagement ist nur ein Baustein (wenn auch ein Das Prozessmodell der SAP (ASAP) für die Realisierung von IT-
sehr wichtiger) bei der Realisierung von IT-Lösungen. Oft kann je- Lösungen wurde erweitert, um die Application-Management-Pha-
doch das geplante IT-Budget nicht für die Entwicklung neuer Lö- sen umfassend abzubilden. Dabei werden beispielsweise Anfor-
sungen genutzt werden, da ein Großteil des Tagesgeschäfts für derungen aus den späteren Phasen des IT-Betriebs in frühen Pha-
Support, Wartung und Fehlerbehebung an der Applikationsland-
schaft aufgewendet wird. Mit der richtigen ALM-Strategie kön-
nen diese Aufwände nachhaltig reduziert werden.
Die Kernidee des Application Lifecycle Managements ist die
ganzheitliche Betrachtung von IT-Lösungen über den gesamten
Software-Lebenszyklus. In der Praxis wird besonderen Wert auf
die Verbesserung der Prozesse und der Kommunikation
zwischen der Software-Erstellung und dem Betrieb von IT-
Lösungen gelegt. Die ALM-Strategie der SAP orientiert sich
dabei an den ITIL®-Prozessen, bei denen die Phasen der
Software-Entwicklung mit den Phasen des Service-
Managements kombiniert werden.
Das IT Service Management in SAP Solution Manager wurde
nach ITIL V.3 zertifiziert und erhielt die PinkVERIFY 2011
Zertifizierung für alle 15 Prozesse.
Abbildung 2.1 Integriertes ALM und IT Service Management
23sen der Entwicklung berücksichtigt. Agile Bestandteile schaffen
die Voraussetzungen dafür, dass mit kurzen Release-Zyklen unter Abbildung 2.2 Success Story der PSEG Service
frühzeitiger Einbeziehung von Anwenderfeedback entwickelt wer- Corporation
den kann.
In den organisatorischen Best Practices steckt die Erfahrung un-
zähliger erfolgreicher SAP-Projekte. Diese umfassen vordefinierte,
wiederverwendbare und individuell anpassbare Geschäftsprozess-
modelle, Templates, Checklisten und Methoden. PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP
INCREASING SAP® SOLUTION
PERFORMANCE AND RELIABILITY WITH
Das ALM-Service-Portfolio, die Schulungen und der Support wur- APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT
den angepasst und erweitert, damit eine ALM-Strategie bei SAP- QUICK FACTS
“We’ve realized a 50% average reduction Company Implementation Highlights
Kunden schnell, effizient und kostengünstig realisiert werden in CPU and database workloads
t Name: Public Service Enterprise Group
(PSEG)
t Leveraged SAP Enterprise Support to
regain stability across SAP software
and a 70% average response time t Headquarters: Newark, New Jersey landscape
kann.
t Industry: Utilities t Brought in SAP MaxAttention to develop
improvement of critical processes.” t Products and services: Energy generation, an ALM road map and equip PSEG’s
electricity transmission, and electricity internal IT team and partners to regain
Stephen Roche, IT Director, SAP Center of
and gas distribution self-sufficient management of the SAP
Excellence, PSEG Services Corporation
t Revenue: US$11.8 billion (2010) software landscape
t Employees: 10,000
Why SAP
Application Lifecycle Management ist mehr als nur ein weiterer IT- t Web site: www.pseg.com
Challenges and Opportunities
t Extensive investment in SAP software to
run core operations
t Address critical performance and reliability t Trusted partner with the business process
Trend: Mit ALM kann die gesamte IT eines Unternehmens nachhal- issues arising from an increasingly
complex SAP® software landscape
t Increase visibility into and control over
and technical optimization expertise to
bring about swift change
t Ability to provide an exceptional quality
process performance bottlenecks and manager to accelerate PSEG’s ALM
tig optimiert und signifikante Einsparungen erzielt werden. dependencies
t Quickly identify and address root causes
journey
Benefits
of problems
t Control explosive database growth t Cleared customer relationship management
data backlog 40% faster than planned and
Objectives reduced the cost of operations by 0.5 FTE
t Implement an application lifecycle manage- per day
ment (ALM) solution that delivers built-in t Defined efficient governance process for
best practices recommended by SAP rollouts of changes, reducing risk and
t Leverage the SAP Solution Manager lowering cost of operations 10%
application management solution to t Achieved nearly 100% uptime without
“Durch die Einführung von Application-Lifecycle- automate ALM processes
SAP Solutions and Services
increasing operational resources
t Developed plan for a 20% database
footprint reduction
t SAP Enterprise Support services t Achieved a 50% average reduction in
Management-Konzepten sind wir in der Lage, mehr mit t SAP MaxAttention™ services
t SAP Solution Manager
CPU and database workloads
t Gained 70% improvement in average
response time for critical processes
weniger Aufwand zu leisten. Die Werkzeuge und Methoden Existing Environment
Extensive SAP software landscape that
includes over 10 solutions
des SAP Solution Manager sowie die Services im Rahmen
SAP Customer Success Story
von SAP MaxAttention sind ausschlaggebend für diesen
Utilities
Erfolg.”
Enzo Bertolini, Group CIO, Ferrero
24Abschnitt 2
Werkzeuge und Services
SAP Solution Manager Das SAP-ALM-Serviceportfolio
Um eine ALM-Strategie erfolgreich umsetzen zu können, wird ein Bei der Einführung von Application Lifecycle Management kön-
Werkzeug benötigt, in dem alle ALM-Prozesse – von der Anforde- nen Sie mit den ALM-Services der SAP vom Know-how der SAP
rungsdefinition bis hin zum Betrieb einer IT-Lösung – übergrei- aus vielen anderen Projekten profitieren.
fend abgebildet werden können.
Die ALM-Services der SAP bestehen aus fertigen Leistungspake-
Das alles leistet der SAP Solution Manager. Die aktuelle Version ten und Beratungslösungen, die überwiegend zum Festpreis an-
des SAP Solution Manager ist eine einheitliche Plattform, die ins- geboten werden.
besondere für die Anforderungen des Application Lifecycle Mana-
Vier Beispiele für ALM Services:
gement weiterentwickelt wurde.
1. Das strategische ALM Assessment ist der erste Schritt für
Hier ein paar Highlights der Version 7.1:
eine erfolgreiche Umsetzung einer ALM-Strategie. Es schafft
• Abdeckung aller Aspekte des IT Service Management und des Transparenz über den aktuellen Stand der Umsetzung im Un-
Application Lifecycle Management ternehmen und zeigt konkrete Optimierungspotentiale für jede
• ITIL®-verifizierte IT-Service- und Support-Prozesse Phase des Application Managements.
• Grafische Modellierung von Geschäftsprozessen 2. Das Test Management Cockpit erweitert die Standard-Funkti-
• Testautomations-Framework onalität zur Generierung von Berichten über alle Testphasen
hinweg. Kennzahlen helfen dabei, die Softwarequalität zu ver-
• Integration von Quality Gates in das Change Request Manage-
bessern, Engpässe im Testprozess zu identifizieren und die
ment
Zeit für die Testplanung und -durchführung effektiv zu nutzen.
• Optimiertes End-to-End Monitoring und Alerting
253. Das Change Request Management im SAP Solution Mana- ALM-Prozesse
ger kann an nahezu jede Kundenanforderung angepasst wer- Das ALM Serviceportfolio deckt alle Bereiche des Application Life-
den. Meistens benötigt man jedoch einfach einen funktionieren- cycle Management ab. Im Einzelnen sind das:
den, erprobten Prozess mit fertigen Komponenten wie bei-
spielsweise die integrierte Aufwandserfassung, die automati- • Solution Documentation
sche Benachrichtigung aller Prozessbeteiligten bei Statuswech-
• Solution Implementation
seln oder eine schnelle Bearbeitung von häufigen Änderungen.
Das alles und noch mehr bieten die ChaRM Add-On Packages. • Template Management
4. Die Bereitstellung von Testdaten ist einer der großen Kosten- • Test Management
treiber im Bereich Testen. Mit dem Test Data Migration Server
• Change Control Management
(SAP TDMS) können Testdaten von Produktivsystemen in Test-
systeme übertragen werden. Gleichzeitig wird die Größe der • IT Service Management
Testdaten reduziert und sensible Daten werden anonymisiert.
• Technical Operation
Im Rahmen des Services wird SAP TDMS installiert und konfi-
guriert. Die benötigten Systeme werden angeschlossen, ein • Business Process Operations
vollständiger Testlauf wird durchgeführt und die Testergebnisse
werden analysiert. Der dazugehörige Know-how-Transfer ver- • Maintenance Management
setzt die Mitarbeiter in die Lage, sofort loszulegen und die Lö-
• Upgrade Management und
sung auf andere Systeme zu übertragen.
• Custom Code Management
„Durch die Einführung eines zentralen Monitorings aller Weitere Informationen:
Systeme und Geschäftsprozesse konnte DuPont eine jährliche IDC White Paper, „Running and Optimizing the Business of IT:
Einsparung von über 11 Millionen US $ erzielen.“ The SAP Best Practices Approach“
DuPont, SAP Customer Success Story
26Kapitel 3 Requirements Management Mit der Lösung Requirements Management for SAP Solution Manager 7.1 können Anforderungen erfasst, verwaltet, Abhängigkeiten definiert und ausgewertet werden. In diesem Kapitel werden die Funktionen der Lösung detailliert beschrieben.
Abschnitt 1
Das Requirements Management Add-On
IN DIESEM ABSCHNITT Der SAP Solution Manager ist eine offene Plattform, die über Adapter und
1. Erweiterungen für den SAP Solution Schnittstellen erweitert werden kann. So gibt es beispielsweise eine Schnittstelle zu
Manager ARIS für die Prozessmodellierung und einen Adapter für das SAP Quality Center
2. Ziele bei der Entwicklung des by HP.
Requirements Management Add-On
Add-Ons sind Erweiterungen, die direkt in den SAP Solution Manager integriert
3. Die Benutzeroberfläche
sind. Das Requirements Management Add-On ist eine Erweiterung, um Anforderun-
4. Die Anwendung personalisieren gen zu verwalten und auszuwerten.
Viele spezialisierte Werkzeuge für Anforderungsmanagement zeichnen sich durch
einen hohen Funktionsumfang aus. Das kann jedoch dazu führen, dass die Bedie-
nung komplex und schwer erlernbar wird. In der Praxis werden erfahrungsgemäß
nur einige der vorhandenen Funktionen intensiv genutzt.
Bei der Entwicklung des Requirements Management Add-On gab es drei primäre
Ziele:
1. Fokussierung auf die wichtigsten, in der Praxis wirklich notwendigen Funktionen
2. Einfache Bedienung und leicht erlernbare Benutzeroberfläche
3. Umfassende Integration mit den Prozessen im SAP Solution Manager
28Webbasierte Benutzeroberfläche
Film 3.1 Arbeitsbereich anpassen
Seit SAP Solution Manager Release 7.1 gibt es eine neue, webba-
sierte Benutzeroberfläche (WebUI), auf der die gesamte Benutzer-
führung für das IT Service Management basiert.
WebUI hat mehrere Vorteile: Die Bedienung folgt bekannten Web-
Standards. Dadurch reduziert sich die Einarbeitungszeit und die
Akzeptanz bei Anwendern ohne SAP Erfahrung steigt. Weiterhin
kann das Layout angepasst und personalisiert werden, wie die Ab-
bildung 3.1 zeigt. Somit ist es sehr einfach, ein Corporate Layout
Abbildung 3.1 Benutzeroberfläche personalisieren
Einen Zuordnungsblock verschieben
zu definieren, häufig benötigte Web-Links auf der Startseite anzu-
zeigen oder die Navigationsleiste an eigene Vorstellungen anzu-
passen.
Der Arbeitsbereich ist in sogenannte Zuordnungsblöcke (engl. As-
signment Blocks) unterteilt. Das Layout des Arbeitsbereichs kann
Mit der WebUI des SAP Solution Managers ab Version 7.1 kann die ohne Programmierung oder Customizing Aufwand angepasst
Benutzeroberfläche personalisiert werden
werden – einfach per Drag&Drop (Film 3.1).
29Arbeitsbereich personalisieren initial aufgeklappt sein sollen und welche Felder beziehungsweise
Über die Schaltfläche „Personalisieren“ können Benutzerinformati- Zuordnungsblöcke angezeigt werden.
onen angepasst, das Kennwort geändert, das Layout geändert
Ergebnisse exportieren
und Präferenzen festgelegt werden.
Über die Schaltfläche können Ergebnisse in das .csv-Format
Zuordnungsblöcke anpassen exportiert und in einer Tabellenkalkulation weiterverarbeitet wer-
Über die Schaltfläche können einzelne Zuordnungsblöcke an- den.
gepasst werden. Man kann einstellen, ob die Zuordnungsblöcke
Abbildung 3.2 Arbeitsbereich anpassen und personalisieren
Der Arbeitsbereich innerhalb der WebUI kann individuell angepasst werden.
30Abschnitt 2
Anforderungen erstellen
IN DIESEM KAPITEL Startbildschirm und Scorecard
1. Startbildschirm und Scorecard Von dem Startbildschirm (Abbildung 3.3) aus kann man Anforderungen suchen,
Massenupdates durchführen, Anforderungen anlegen oder das Reporting
2. Allgemeine Attribute
(Dashboard) aufrufen.
3. Kategorien
Darunter ist eine sogenannte Scorecard sichtbar. Hier sieht man die Priorität und
4. Release-Management
den Status der Anforderungen, geordnet nach der Service-ID oder Projekten.
5. Verknüpfungen
Die Service-ID kann
6. Change Management Abbildung 3.3 Startbildschirm mit Scorecard
völlig frei verwendet
werden, beispielswei-
se für Systeme
(CRM, ERP), Projek-
te oder Lösungen.
Im ersten Schritt soll
eine Anforderung
erstellt und die Attri-
bute einer Anforde-
rung erklärt werden.
31Allgemeine Attribute Interaktiv 3.1 Anforderung erstellen
Eine Anforderung hat immer eine eindeutige ID und eine Beschrei-
bung. Daneben gibt es noch weitere Attribute, die optional oder
obligatorisch sind (welche das sind, kann über globale Einstellun- Aktionen
gen definiert werden). Wählen Sie einen sprechenden Namen für
Prozessphasen
eine Anforderung, aber fassen Sie sich kurz – Sie können zu einer
Anforderung zusätzliche Texte eingeben oder sie mit weiteren Do-
kumenten verknüpfen. Allgemeine Daten
Beteiligte Personen Kategorien
Kommunikation ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Require- Status
ments Engineering. Deswegen sollte vermerkt werden, wer die An-
forderung gestellt hat (Anforderer). Häufig sind Anforderungen
Zusätzliche Informatio-
noch nicht ausreichend spezifiziert, um sie direkt umzusetzen o-
nen
der für die Realisierung zu genehmigen.
Der Anforderungsanalytiker hat die Aufgabe, fehlende Informatio-
1 2 3 4 5 6
nen zu sammeln, sinnvoll aufzubereiten und zu dokumentieren. Er
sollte einerseits die Anforderung fachlich verstehen, aber auch ei-
Möchte man weitere Personen (zum Beispiel weitere Beteiligte o-
ne mögliche technische Umsetzung überschauen. Der Anforde-
rungsanalytiker wird deswegen oft als „die Schnittstelle zwischen der Stakeholder) einer Anforderung zuordnen, so kann man diese
dem Business und der IT“ bezeichnet. Der Anforderungsmanager in dem Abschnitt „Beteiligte Personen“ hinzufügen.
hingegen ist für die Verwaltung der Anforderung verantwortlich. Er
Status und Priorität
ändert den Status einer Anforderung, definiert Abhängigkeiten o-
Der Status einer Anforderung wird nicht direkt, sondern nur über
der teilt sie einem Release zu.
definierte Aktionen geändert. Hat eine Anforderung den Status
„Neu“, dann gibt es die Aktionen „Anforderung prüfen“ oder „An-
32Film 3.2 Status einer Anforderung Abbildung 3.4 Anforderungen einordnen
Service ID
Mit der Service ID können Anforderungen in kundenindividuelle
Kategorien eingeteilt werden, zum Beispiel nach Systemen (CRM,
ERP), Projekttypen, Fachbereiche oder Lösungen.
Bei der Installation sollte unternehmensweit definiert werden, wie
dieser Wert genutzt wird und ggf. das Attribut umbenannt wer-
Der Status einer Anforderung wird durch eine Aktion geändert den.
forderung zurückstellen“. Der Status wird hierbei auf „Prüfung“ be- Die Service ID wird verwendet, um die Anforderungen für die
ziehungsweise „Zurückgestellt“ geändert. Dieses sogenannte Zu- Scorecard im Startbildschirm zu ordnen.
stands-Übergangsmodell kann global angepasst werden. In dem
Release-Management
Zuordnungsblock „Prozessphasen“ sieht man den aktuellen Sta-
In vielen Projekten werden Anforderungen in der Reihenfolge ihres
tus sowie die möglichen Zustände in einer linearen Ansicht (das
Erstellungsdatums abgearbeitet. Oft ist es jedoch die bessere
ist übersichtlicher als das komplette Zustands-Übergangs-Dia-
Strategie, die wichtigsten Anforderungen zuerst zu realisieren. Bei
gramm).
sehr vielen Anforderungen wird es zudem notwendig sein, diese
Wie wichtig eine Anforderung ist, kann über die Priorität dokumen- verschiedenen Releases oder Iterationen zuzuordnen.
tiert werden.
Das Requirements Management Add-On beinhaltet eine einfache
Release-Verwaltung. Hiermit kann eine Anforderung einem be-
stimmten Release beziehungsweise einer Iteration zugeordnet
33• Anforderungen für bestimmte Module oder Aufgaben zu finden
Abbildung 3.5 Multi-Level Kategorisierung
• zugehörige Einträge in Wissensdatenbanken zu identifizieren.
Es können bis zu zehn Ebenen definiert werden, die frei ange-
passt werden können.
Texte und Textvorlagen
Texte bieten die Möglichkeit, eine Anforderung genauer zu be-
schreiben oder sie mit Kommentaren zu versehen. Wird zum Bei-
spiel eine Anforderung zurückgewiesen, ist es üblich, den Grund
zu dokumentieren („Ist technisch nicht möglich“, „Doublette“). Un-
ter „Text hinzufügen“ kann ein Textabschnitt hinterlegt werden.
werden. So ist es einfach, alle Anforderungen für ein bestimmtes
Release zu suchen und zur Implementierung freizugeben.
Projekte Abbildung 3.6 Textvorlagen definieren und verwenden
Dieses Attribut referenziert auf ein Projekt im SAP Solution Mana-
ger und wird in dem Abschnitt Projekte genauer erklärt.
Kategorien
Aus dem Problem- und Incident-Management im SAP Solution
Manager kommt die Idee, Anforderungen über Multi-Level-Katego-
rien einem Kontext zuzuordnen.
Kategorien helfen,
Als zweite Textvorlage wurde ein Standardtext definiert, um die
• Anforderungen in Kategorien zu strukturieren Ablehnung einer Doublette zu dokumentieren.
• ähnliche Anforderungen oder Doubletten zu finden
34Textabschnitt einfügt. Das geht wesentlich schneller, als den Text
Abbildung 3.7 Textabschnitte einfügen
immer wieder zu tippen. Weiterhin wird immer derselbe Text ver-
wendet, was die Suche nach bestimmten Textbausteinen erleich-
tert. In der Abbildung 3.6 wird dieses Beispiel illustriert.
Anlagen
Bei komplexen Anforderungen reicht die Spezifikation über einfa-
Die Beschreibung der Anforderung ist im Standard ein Muss-Feld.
che Texte nicht mehr aus. Diagramme, Präsentationen, Dokumen-
Weitere Texte können verwendet werden, um bspw. den Grund einer te oder URLs – alles kann über Anlagen einer Anforderung zuge-
Anforderung oder die Begründung für eine Änderung zu dokumentieren.
ordnet werden.
Der SAP Solution Manager hat Funktionen, die man ansonsten
Der Textabschnitt „Beschreibung der Anforderung“ ist im Stan-
nur in Dokumentenmanagementsystemen findet, beispielswei-
dard ein Muss-Feld.
se die Versionierung und Attributierung von Dokumenten. Aus die-
Textvorlagen sind enorm hilfreich, um sem Grund werden in vielen Projekten alle relevanten Dokumente
Anforderungen einheitlich und aussa- im Business Blueprint abgelegt (Reiter „Proj. Documentation“).
gekräftig zu dokumentieren und gleich-
zeitig den Aufwand für die Dateneinga-
Abbildung 3.8 Dokumente hochladen
be möglichst gering zu halten.
Das folgende Beispiel soll die Verwendung von Textvorlagen ver-
deutlichen: Findet eine Anforderungsmanagerin eine Anforderung,
die in dieser Form bereits im System aufgenommen wurde, dann
wird sie diese Anforderung als Doublette ablehnen. Als Textab-
schnitt wählt sie „Grund der Ablehnung“. Um die Ablehnung als
Doublette zu begründen und zu dokumentieren, hat die Anforde-
Dokumente können aus Solution Manager Projekten oder als Datei
rungsmanagerin eine Textvorlage definiert, die sie einfach in den
geladen werden.
35Anlagen können Dokumente sein, die bereits im SAP Solution Ma- Beteiligte Personen
nager vorhanden sind oder als Datei hochgeladen werden. Zu einer Anforderung gehören viele beteiligte Personen. Dabei
kann es sich um von einer Anforderung direkt oder indirekt betrof-
Werden Dokumente aus SAP-Solution-Manager-Projekten gela-
fene Personen (Stakeholder) handeln oder Mitarbeiter, die sich im
den, können diese entweder kopiert oder nur verlinkt werden („An-
Rahmen der Realisierung mit der Anforderung beschäftigen (Tes-
hängen als Link“). Bei der zweiten Variante wird lediglich eine Re-
ter, Anforderungsmanager, Test Manager).
ferenz erzeugt, die immer auf die aktuellste Version des Doku-
ments zeigt. Über das Attributfeld „Beteiligte Personen“ können diese einer An-
forderung zugeordnet werden.
Werden Daten aus dem Dateisystem hochgeladen, werden sie im-
mer in das Repository des Solution Manager kopiert. Ein Klick auf Projekte
ein angehängtes Dokument öffnet dieses im Browser oder lädt es
Wird eine Anforderung umgesetzt, dann kann im Allgemeinen die-
herunter.
se Anforderung einem bestimmten Geschäftsprozess zugeordnet
werden.
Im Business Blueprint werden die Geschäftsprozesse für Imple-
Abbildung 3.9 Projekt Dokumentation mentierungsprojekte abgebildet. Das dient einerseits zur Doku-
mentation, ermöglicht aber auch in späteren Projektphasen über
die Angabe von Transaktionen eine direkte Verbindung zum reali-
sierten System.
SAP empfiehlt, alle projektrelevanten Informationen im Kontext
des Business Blueprint zu strukturieren. Dazu gehören beispiels-
weise Dokumente (Solution Documentation), Testfälle, Incidents
oder Anforderungen. Das erleichtert nicht nur das Auffinden zu-
sammengehöriger Informationen, sondern ist auch eine Vorausset-
zung für weitere Funktionen im Business Blueprint (siehe dazu
Funktionen zum Dokumentenmanagement in SAP Solution Manager Präsentation 3.1).
36Sie können auch lesen