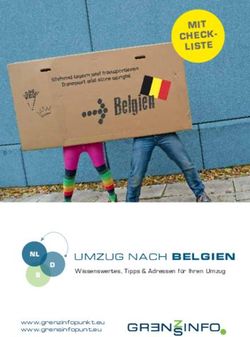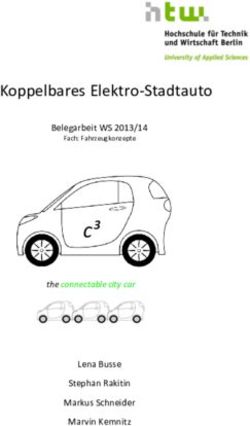RECHTLICHE STELLUNG DES GUTSCHEINS IN ÖSTERREICH - JKU ePUB
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
RECHTLICHE
Eingereicht von
Ulrich Parzer
STELLUNG DES
Angefertigt am
Institut für
Unternehmensrecht
GUTSCHEINS IN Beurteiler
Assoz. Univ.-Prof. Dr.
ÖSTERREICH
Thomas Wolkerstorfer, LL.B.
Juni 2021
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Magister der Rechtswissenschaften
im Diplomstudium
Rechtswissenschaften
JOHANNES KEPLER
UNIVERSITÄT LINZ
Altenberger Straße 69
4040 Linz, Österreich
www.jku.at
DVR 0093696EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument identisch. Linz, 01.06.2021 Unterschrift 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 2/50
Inhaltsverzeichnis
I. EINLEITUNG ..............................................................................................................................................7
II. WAS IST EIN GUTSCHEIN? ..........................................................................................................................8
A. BEGRIFFSDEFINITION ................................................................................................................................................8
B. GUTSCHEIN ALS URKUNDE .........................................................................................................................................9
1. Vorliegen einer Gedankenerklärung............................................................................................................ 11
2. Schriftliche Verkörperung der Erklärung ..................................................................................................... 11
3. Abgabe zu Beweiszwecken im Rechtsverkehr ............................................................................................. 11
4.
Erkennbarkeit des Ausstellers...................................................................................................................... 12
5.
Fazit ............................................................................................................................................................. 12
C. GUTSCHEIN ALS WERTPAPIER .................................................................................................................................. 13
1. Was ist ein Wertpapier? .............................................................................................................................. 13
a) Österreichischer Wertpapierbegriff .......................................................................................................................... 14
(1) Der „weite“ Wertpapierbegriff ........................................................................................................................ 15
(a) Urkunde ........................................................................................................................................................... 16
(b) Privates Recht ............................................................................................................................................. 16
(c) Innehabung ...................................................................................................................................................... 16
(2) Der „enge“ Wertpapierbegriff ......................................................................................................................... 16
b) Schweizer Wertpapierbegriff..................................................................................................................................... 16
2.
Ergebnis ....................................................................................................................................................... 17
3.
Entmaterialisierung ..................................................................................................................................... 18
D. RECHTSNATUR EINES GUTSCHEINS ........................................................................................................................... 18
1. Allgemeines ................................................................................................................................................. 18
2. Rechtsnatur am Beispiel des Werbegutscheins ........................................................................................... 19
3. Rechtsnatur am Beispiel des Umtauschgutscheins ..................................................................................... 21
4. Rechtsnatur am Beispiel des Geschenkgutscheins ...................................................................................... 22
5. Ergebnis ....................................................................................................................................................... 23
III. WELCHE ARTEN VON GUTSCHEINEN GIBT ES? ....................................................................................... 24
A. ALLGEMEINE UNTERTEILUNG .................................................................................................................................. 24
1. Wertgutschein ............................................................................................................................................. 24
2. Waren– oder Dienstleistungsgutschein....................................................................................................... 24
3. Werbegutschein (Unterform) ...................................................................................................................... 25
4. Geschenkgutschein (Unterform) ................................................................................................................. 25
5. Umtauschgutschein (Unterform) ................................................................................................................ 25
B. MWSTSYSTRL-UNTERTEILUNG ............................................................................................................................... 26
1. Einzweck-Gutscheine ................................................................................................................................... 26
2. Mehrzweck-Gutscheine ............................................................................................................................... 26
E. FAZIT .................................................................................................................................................................. 26
IV. ABGRENZUNG ZUM COUPONING ......................................................................................................... 28
A. BEGRIFFLICHKEITEN ............................................................................................................................................... 28
1. Der Coupon .................................................................................................................................................. 28
2.
Das Couponing............................................................................................................................................. 28
3.
Unterschied.................................................................................................................................................. 29
B. SITUATION IN ÖSTERREICH...................................................................................................................................... 29
1. Allgemeines ................................................................................................................................................. 29
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 3/502.
Coupon Arten............................................................................................................................................... 30
C. PROBLEMATIK DER GRÖBLICHEN BENACHTEILIGUNG .................................................................................................... 30
1. Allgemeines ................................................................................................................................................. 30
2. Inhaltskontrolle gem § 879 Abs 3 ABGB ...................................................................................................... 31
a) Nebenbestimmung in AGB oder Vertragsformblättern ............................................................................................ 31
b) Gröbliche Benachteiligung des Unterworfenen ........................................................................................................ 31
c) Folge........................................................................................................................................................................... 32
d) Exkurs: Verbraucherschutz gem § 6 KSchG ............................................................................................................... 32
3. Preis als sachliche Rechtfertigung ............................................................................................................... 33
4. Lösungsansatz: Tarifwahlsystem................................................................................................................. 34
V. GÜLTIGKEITSDAUER EINES GUTSCHEINS ................................................................................................... 36
A. ALLGEMEINE VERJÄHRUNGSFRIST (VERFALL) .............................................................................................................. 36
B. VORAUSSETZUNGEN DER VERJÄHRUNG ..................................................................................................................... 36
1. Vorliegen eines verjährbaren Rechts ........................................................................................................... 36
2. Ablauf der Verjährungsfrist ......................................................................................................................... 37
3. Nichtausübung des Rechts innerhalb der Verjährungsfrist ......................................................................... 37
4. Fazit ............................................................................................................................................................. 37
C. BEGRENZUNGEN DER VERTRAGSFREIHEIT................................................................................................................... 38
D. 10 OB 106/18P .................................................................................................................................................. 38
1. Sachverhalt .................................................................................................................................................. 38
2. Klagebegehren............................................................................................................................................. 39
3. Einwendung der Beklagten.......................................................................................................................... 39
4. Beurteilung des Erstgerichts ........................................................................................................................ 40
5. Beurteilung des Berufungsgerichts.............................................................................................................. 40
6. Abschließende rechtliche Beurteilung des OGH .......................................................................................... 41
a) Verfallsklauseln .......................................................................................................................................................... 41
b) Status der Beklagten als Vermittlerin und deren Haftbarkeit ................................................................................... 41
c) Gültigkeitsdauer......................................................................................................................................................... 41
d) Leistungs- und Wertgutscheine ................................................................................................................................. 42
e) Umtauschmöglichkeit ................................................................................................................................................ 42
7. Zusammenfassung....................................................................................................................................... 42
VI. HAFTUNG (GUTSCHEINE IM INSOLVENZVERFAHREN) ............................................................................ 44
1. Grundlegendes............................................................................................................................................. 44
a) Aussonderungsrechte ................................................................................................................................................ 44
b) Absonderungsrechte ................................................................................................................................................. 45
c) Masseforderungen .................................................................................................................................................... 45
d) Insolvenzforderungen ................................................................................................................................................ 45
2. Eindeutige gesetzliche Regelung ................................................................................................................. 45
3. Lösungsvorschlag ........................................................................................................................................ 46
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 4/50Abkürzungsverzeichnis ABGB Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch ABl Amtsblatt Abs Absatz AFS Abgaben-, Finanz- und Steuerrecht Art Artikel AGB Allgemeine Geschäftsbedingungen ASVG Allgemeines Sozialversicherungsgesetz AT Allgemeiner Teil at austria B2B Business to Business B2C Business to Consumer BMF Bundesministerium für Finanzen BörseG Börsegesetz bspw beispielsweise BWG Bankwesengesetz bzgl bezüglich bzw beziehungsweise CoViD Corona-Virus-Disease DepG Depotgesetz DevG Devisengesetz etc et cetera EU Europäische Union EuGH Europäischer Gerichtshof f folgende ff fortfolgende GebG Gebührengesetz gem gemäß GesRÄG Gesellschaftsrecht-Änderungsgesetz GGG Gerichtsgebührengesetz grds grundsätzlich H Heft hA herrschende Ansicht hM herrschende Meinung Hrsg Herausgeber iHv in Höhe von idF in der Fassung 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 5/50
insb insbesondere iSd im Sinne des KFG Kraftfahrgesetz Kfz Kraftfahrzeug KMG Kapitalmarktgesetz KSchG Konsumentenschutzgesetz lit litera / Literatur MAR Marktmissbrauchsverordnung mE meines Erachtens mMn meiner Meinung nach MwstSystRL Mehrwertsteuersystemrichtlinie oä oder ähnliche OGH Oberster Gerichtshof OR Obligationenrecht ÖJZ Österreichische-Juristen-Zeitung REWE Revisionsverband der Westkauf-Genossenschaften RL Richtlinie Rn Randnummer Rsp Rechtsprechung Rz Randziffer sog sogenannt/e StGB Strafgesetzbuch SWK Steuer- und Wirtschaftskartei ua und andere uä und ähnliche UGB Unternehmensgesetzbuch USB Universal Serial Bus USt Umsatzsteuer uvm und viele mehr VbR Verbraucherrecht vgl vergleiche VwGH Verwaltungsgerichtshof WAG Wertpapieraufsichtsgesetz WK Wiener Kommentar www world wide web Z Ziffer zB zum Beispiel ZR Zivilrecht 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 6/50
I. Einleitung In dieser von Konsum geprägten Zeit erfreuen sich Gutscheine in allen Varianten immer größerer Beliebtheit, ganz gleich, ob es sich hierbei um Wertgutscheine in bestimmter Höhe, Waren- bzw Dienstleistungsgutscheine oder um eine gänzlich andere Form von Gutscheinen handelt. Hinter diesem grundsätzlich rein wirtschaftlichen Aspekt steht natürlich auch die Verpflichtung des Gesetzgebers zur entsprechenden Regelung, um einen reibungslosen wirtschaftlichen und auch rechtlichen Verkehr zu gewährleisten. Hierbei werden einige Problemfelder aufgeworfen, welche in dieser Arbeit Beachtung finden sollen. An erster Stelle soll natürlich die Frage geklärt werden, worum es sich bei einem Gutschein überhaupt handelt und welche Rechtsnatur er in Österreich innehat. Im Zuge dessen soll auch das deutsche und das schweizerische Recht in diese Überlegungen einfließen. Anschließend werden in dieser Arbeit die verschiedenen Arten von Gutscheinen genannt, welche einerseits relevant für das allgemeine Verständnis dieser Arbeit, insbesondere aber für die Darstellung der Rechtsnatur, sind. Der Vollständigkeit halber findet sich im Anschluss daran ein Kapitel über das Couponing in Österreich, welches sich am amerikanischen Vorbild orientiert, wenngleich es bei uns bloß in abgeschwächter Form zum Tragen kommt. Das Beispiel des Couponings wurde deshalb gewählt, um die Problematik der gröblichen Benachteiligung näher zu beleuchten. Das vorletzte Kapitel soll der Frage der Gültigkeitsdauer auf den Grund gehen, da es hierzu 2019 eine entsprechende Entscheidung des OGH gab. Eben dieses Urteil soll im Zuge dieser Arbeit beleuchtet werden und die gegenwärtige Rechtslage verdeutlichen. Das letzte und abschließende Kapitel dieser Arbeit bildet die Haftungsproblematik, jedoch begrenzt auf das Insolvenzverfahren. Diese Begrenzung ergibt sich einerseits aus dem vermehrten Interesse an Gutscheinen, während der gegenwärtigen CoViD-19-Pandemie, andererseits soll auch der Rahmen dieser Arbeit nicht gesprengt werden. Anstoß zu dieser Arbeit hat die besagte Pandemie gegeben, da sich mir unter anderem die Frage gestellt hat, welche Problemfelder sich bei der Insolvenz eines Unternehmens hinsichtlich noch ausstehender Gutscheine ergeben; ob es bereits eine einheitliche Regelung gibt, und ob es gegebenenfalls sinnvoll wäre, eine solche bzw eine Sonderregelung für die Corona-Krise zu schaffen. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 7/50
II. Was ist ein Gutschein?
A. Begriffsdefinition
Der Begriff des Gutscheins ist in Österreich nicht legaldefiniert. Es wird oft nicht unterschieden,
um welche Art von Gutschein es sich handelt. Die unterschiedlichen Arten von Gutscheinen
werden zum Teil synonym gebraucht.1 Die Gutscheine lassen sich primär unter entgeltliche
Kaufgutscheine – also jene die gegen sofortigen Erhalt der Gegenleistung ausgestellt werden –
und in unentgeltliche Gratisgutscheine – also jene die aus Eigeninteresse an einen bestimmten
Kundenkreis verteilt werden – subsumieren. Die entgeltlichen Gutscheine unterteilen sich noch
weiter in die Gruppe der Wert- und in die Gruppe der Waren-/ Dienstleistungsgutscheine.2
Bei einem Gutschein handelt es sich um eine Urkunde – siehe B. – welche einer in Vorleistung
gehenden Person ausgestellt wird. Mit der Ausstellung geht ein Versprechen des emittierenden
Unternehmens einher, zu einem späteren Zeitpunkt eine Leistung zu erbringen. Diese Urkunde
beinhaltet das Versprechen zur Erfüllung der Leistung bei bloßer Vorlage eben dieser, wobei
allerdings auch auf die Einlösungsfrist zu achten ist.3
Eine Definition des Gutscheins findet sich in der Richtlinie (EU) 2016/1065 4, welche den
Gutschein als „ein Instrument, bei dem die Verpflichtung besteht, es als Gegenleistung oder Teil
einer solchen für eine:
- Lieferung von Gegenständen oder Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen und bei
dem die
- zu liefernden Gegenstände oder zu erbringenden Dienstleistungen oder
- Identität der möglichen Lieferer oder Dienstleistungserbringer
entweder auf dem Instrument selbst oder in damit zusammenhängenden Unterlagen,
einschließlich der Bedingungen für die Nutzung des Instruments, angegeben sind.“ 5 definiert.
Insbesondere Beachtung finden muss hierbei der sechste Punkt der Präambel dieser Richtlinie:
„Um eindeutig zu bestimmen, was einen Gutschein für mehrwertsteuerliche Zwecke ausmacht,
und um Gutscheine von Zahlungsinstrumenten zu unterscheiden, müssen Gutscheine – die
gegenständlich sein oder eine elektronische Form haben können – definiert werden, so dass
ihre wesentlichen Merkmale und insbesondere die Art des durch einen Gutschein verkörperten
1
Weber, Gutschein (Stand 03.10.2020, lexis Briefings in lexis360.at).
2 Hopfgartner/Pülzl, Steuerliche und bilanzielle Behandlung von Gutscheinen, AFS 2016, 42.
3 Hopfgartner/Pülzl, AFS 2016, 42.
4 RL 2016/1065/EG des Rates vom 27. Juni 2016 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der
Behandlung von Gutscheinen, ABl L 177/9, 1.
5 Art 30a MwStSystRL.
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 8/50Rechts und der Pflicht, ihn als Gegenleistung für die Lieferung von Gegenständen oder die Erbringung von Dienstleistungen anzunehmen, erfasst werden.“6 Es wird gesondert darauf hingewiesen, dass es sich bei Gutscheinen sowohl um elektronische als auch um gegenständliche Instrumente handeln kann. Die Richtlinie verzichtet auf die Vorschreibung einer Form des Gutscheins und vermeidet mit der Formulierung „Instrument“ eine Festlegung auf bestimmte inhaltliche Merkmale.7 Hieraus ergibt sich bereits ein wichtiger Aspekt bei der Begriffsdefinition des Gutscheins. Es muss sich gemäß dieser RL nicht um ein gegenständliches Exemplar handeln, also auch Gutscheine in elektronischer Form behalten ihre Gültigkeit und können im Rechtsverkehr Verwendung finden.8 Den Gutscheinen ist es darüber hinaus auch einheitlich gemein, dass üblicherweise eine zeitliche Differenz zwischen Verpflichtungsbegründung – also dem Erwerb des Gutscheins – und der tatsächlichen Leistungserfüllung – also dem Erhalt der auf dem Gutschein verzeichneten Leistung – liegt. Diese zeitliche Differenz folgt einerseits daraus, dass es bei jeder Erstellung eines Gutscheins auch zu einer Erstellung einer Gutscheinurkunde kommt.9 Andererseits würde es wohl den Zweck des Gutscheins verfehlen, wenn man diesen prompt nach Ausstellung auch einlöst, da hier der Vorleistungscharakter verloren ginge. Man stelle sich vor, in einem Restaurant einen Gutschein zu erwerben und diesen auch sofort einzulösen. Die Ausstellung einer Gutscheinurkunde wäre sinnlos, da dieselbe Leistung auch ohne die Vorleistung erhalten hätte werden können. B. Gutschein als Urkunde Auf die Frage, worum es sich bei einer Urkunde konkret handelt, gibt das ABGB mangels einer Legaldefinition keine Auskunft. Folglich muss in anderen Rechtsquellen nach einem Mittel zur Begriffsbestimmung gesucht werden. Hilfestellung gibt hierbei das BMF in einem Erlass zum Gebührengesetz – konkret zum § 15 Abs 2 GebG –, welches die Urkunde als jede Art von Schrift versteht, in welcher – wenn auch formlos – das Zustandekommen eines Rechtsverhältnisses festgehalten ist. Darüber hinaus muss diese auch geeignet sein, als Beweis für ein zustandegekommenes Rechtsgeschäft zu 6 RL 2016/1065/EG des Rates vom 27. Juni 2016 zur Änderung der Richtlinie 2006/112/EG hinsichtlich der Behandlung von Gutscheinen, ABl L 177/9, 1. 7 Bendlinger/Bieber, Vertrieb von Mehrzweckgutscheinen, SWK 34/2019, 1492. 8 Vgl Bundesministerium für Finanzen, FINDOK 25527, Rz 507. 9 Hopfgartner/Pülzl, AFS 2016, 42. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 9/50
fungieren und auch die Voraussetzung der Schriftlichkeit iSd Unterschriftlichkeit erfüllen.
Mangelt es an der Unterfertigung liegt keine Urkunde vor.10
Grundsätzlich eignet sich jede körperliche, bewegliche Sache als Urkunde (zB Bierdeckel,
Servietten, oä). Für manche existieren hingegen standardisierte Formulare, wie etwa beim
Wechsel. Eine solche Vorgehensweise ist, insbesondere bei Wertpapieren die bestimmte
Formerfordernisse erfüllen müssen, sinnvoll.11
„Der gezogene Wechsel enthält:
1. die Bezeichnung als Wechsel im Texte der Urkunde, und zwar in der Sprache, in der sie
ausgestellt ist;
2. die unbedingte Anweisung, eine bestimmte Geldsumme zu zahlen;
3. den Namen dessen, der zahlen soll (Bezogener);
4. die Angabe der Verfallzeit;
5. die Angabe des Zahlungsortes;
6. den Namen dessen, an den oder an dessen Order gezahlt werden soll;
7. die Angabe des Tages und des Ortes der Ausstellung;
8. die Unterschrift des Ausstellers.“12
Die oben genannten Voraussetzungen müssen sich alle auf der Urkunde finden lassen,
ansonsten handelt es sich nicht um einen gezogenen Wechsel.
Eine Legaldefinition lässt sich außerdem im § 74 Abs 1 Z 7 StGB finden, welcher die Urkunde
als eine Schrift definiert, die errichtet wurde, um ein Recht oder ein Rechtsverhältnis zu
begründen, abzuändern, aufzuheben oder zu beweisen. Diese Legaldefinition enthält aber nicht
alle Merkmale, die eine Urkunde ausmachen. Vollständigerweise handelt es sich hierbei um
folgende 4 Merkmale:
Vorliegen einer Gedankenerklärung
Schriftliche Verkörperung dieser Erklärung
Abgabe zu Beweiszwecken im Rechtsverkehr
Erkennbarkeit des Ausstellers
welche eine Urkunde kennzeichnen.13 Darüber hinaus werden im strafrechtlichen Sinne auch
nur Absichtsurkunden als Urkunden bezeichnet und nicht jene, die durch Zufall entstanden sind.
10 Bundesministerium für Finanzen, FINDOK 25527, Rz 428.
11 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht (2020), 9.
12 Art 1 Wechselgesetz
13 Tipold in Leukauf/Steininger (Hrsg), StGB Update 2020 § 7 Rz 30.
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 10/50Zufallsurkunden sind all jene Urkunden, die nicht errichtet wurden, um rechtserhebliche Umstände zu beweisen.14 1. Vorliegen einer Gedankenerklärung Unter dem Vorliegen einer Gedankenerklärung versteht man die Abgrenzung zu bloßen Beweiszeichen, wie etwa Etiketten oder Fahrgestellnummern, welche im Gegensatz zu einer Urkunde keinen eigenständigen geistigen Inhalt aufweisen, sondern nur auf gewisse Eigenschaften einer Sache hinweisen.15 Essentiell sind somit die Perpetuierungsfunktion, sowie die Rechtserheblichkeit – also die Beweisfunktion – der Urkunde. Insbesondere kein eigenständiger Gedankeninhalt liegt vor, wenn es sich um bloße Entwürfe, Vordrucke oder Blanketten handelt. Mautvignetten stellen keine Urkunden dar, da diese vorerst keinen autonomen Gedankeninhalt aufweisen, da dieser erst mit Aufkleben auf ein bestimmtes Fahrzeug entsteht. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei Kfz-Kennzeichen, sowie bei Kfz- Begutachtungsplaketten sehr wohl um Urkunden, obwohl es ihnen ebenso wie der Mautvignette an einer autonomen Gedankenerklärung mangelt. Dies liegt daran, dass § 57a Abs 5 KFG bestimmte Zeichen ex lege als Urkunden bezeichnet.16 2. Schriftliche Verkörperung der Erklärung Die schriftliche Verkörperung einer Urkunde setzt insb voraus, dass der Gedankeninhalt lesbar wird. Unerheblich ist dabei, in welcher Sprache die Urkunde erstellt wird. Darüber hinaus ist es irrelevant, ob es sich bei der Schrift um eine Handschrift oder um eine Verschriftlichung unter Zuhilfenahme von technischen Hilfsmitteln, wie etwa eines Computers oder auch einer Schreibmaschine, handelt. Ebenso unwichtig ist der Belag, auf dem die Urkunde verschriftlicht wird. Möglich sind Papier und Karton, aber auch genauso Steintafeln, nicht jedoch mangels Schriftlichkeit entstandene Gedankeninhalte, wie etwa Video- oder Tonaufnahmen.17 3. Abgabe zu Beweiszwecken im Rechtsverkehr Wie bereits oben angesprochen sind nur Absichtsurkunden rechtserheblich, also jene Urkunden denen unabhängig vom Beweiswillen des Ausstellers die Rechtserheblichkeit als Merkmal anhaftet. Die Schrift muss errichtet worden sein, um ein Rechtsverhältnis zu begründen, abzuändern, aufzuheben oder zu beweisen.18 Ist dies nicht der Fall, würde es sich um eine Zufallsurkunde handeln, die aber für die Begrifflichkeit des Gutscheins wenig Bedeutung hat, da 14 Tipold in Leukauf/Steininger, StGB Update 2020 § 7 Rz 31. 15 Jerabek/Reindl-Krauskopf/Ropper/Schroll in Höpfel/Ratz (Hrsg), WK2 StGB (2017) § 74 Rz 47. 16 Hinterhofer/Rosbaud, Strafrecht Besonderer Teil II6 (2016) 217f. 17 Jerabek/Reindl-Krauskopf/Ropper/Schroll in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 74 Rz 48; Hinterhofer/Rosbaud, Strafrecht Besonderer Teil II6, 219. 18 Jerabek/Reindl-Krauskopf/Ropper/Schroll in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 74 Rz 49. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 11/50
es kaum denkbar ist, dass ein Gutschein erstellt wird, ohne dass man dem Vorleistenden die
Befugnis einräumen möchte, damit seine Leistung zu erhalten.
Um Urkunden handelt es sich folglich bei der E-Card, da diese als elektronischer Krankenschein
iSd § 31a ASVG fungiert, und bei der „grünen“ Versicherungskarte der Haftpflichtversicherung,
weil diese als international anerkannter Nachweis gilt, dass ein Fahrzeug versichert ist. Eben
nicht um Urkunden handelt es sich bei der Kfz-Haftpflichtversicherungskarte, da diese bloß als
19
reine Merkhilfe dient und nicht über den Bestand einer Versicherung aufklärt.
4. Erkennbarkeit des Ausstellers
Als letztes Merkmal muss der Gutschein noch die Erkennbarkeit des Ausstellers beinhalten, also
entweder den Aussteller explizit bezeichnen oder aber zumindest erkennbar machen. Zur
entsprechenden Individualisierung der Urkunde ist es nicht notwendig, dass der Aussteller auch
derjenige ist, der die Urkunde unterfertigt. Auch das bloße Versehen mit einem Firmenstempel
reicht für die Erkennbarkeit des Ausstellers aus.20 Ziel dieses Merkmals ist die Rückführbarkeit
der Urkunde auf den geistigen Urheber, welcher sowohl eine natürliche als auch eine juristische
Person sein kann. Sonderfall ist beispielsweise die gemeinsame Urkunde, welche mehrere
Aussteller hat (zB europäischer Unfallbericht). Besondere Relevanz hat die Erkennbarkeit des
Ausstellers bei Urkunden, wo der Erklärende nicht derjenige ist, der die Urkunde auch
geschrieben hat. In solchen Fällen – etwa wegen mangelnder Schreibkenntnisse, oder bei
Bedienung einer Schreibhilfe – gilt immer der Erklärende als Aussteller und nie der Schreiber.
21
Selbiges gilt für die Fälle der (echten) Stellvertretung.
In den meisten Fällen wird es der Fall sein, dass ein Unternehmen Gutscheine ausstellt und
nicht eine natürliche Person, weshalb es durchaus sinnvoll ist die juristischen Personen in den
Kreis der Aussteller miteinzubeziehen. Ebenfalls zu beachten ist, dass es vor allem für die Fälle
der Vermittlung von Gutscheinen wichtig ist, dass diese den Erklärenden binden sollen, also das
emittierende Unternehmen und nicht den Vermittler.
5. Fazit
Zusammengefasst erfüllt ein Gutschein sowohl die Kriterien des Urkundenbegriffs aus dem
GebG als auch jene des StGB und ist somit als Urkunde zu qualifizieren. Einzig und allein
hinsichtlich der Unterschriftlichkeit besteht noch Aufklärungsbedarf, da nicht auf allen gängigen
Gutscheinen, die im Wirtschaftsverkehr Gebrauch finden, auch eine Unterschrift vorhanden ist.
Diese Unterschrift kann jedoch gem § 18 GebG durch eine in anderer technischer Weise ersetzt
19 Hinterhofer/Rosbaud, Strafrecht Besonderer Teil II6, 220.
20 Jerabek/Reindl-Krauskopf/Ropper/Schroll in Höpfel/Ratz, WK2 StGB § 74 Rz 50.
21 Hinterhofer/Rosbaud, Strafrecht Besonderer Teil II6, 221.
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 12/50werden, was bei massenproduzierten Gutscheinen natürlich sinnvoll ist. Unter „in technischer Weise“ versteht man beispielsweise den Aufdruck einer Namensstampiglie, den Aufdruck des Firmenwortlauts (VwGH 17.2.2000, 99/16/0027), oder aber auch die Vervielfältigung einer Unterschrift mittels eines Telefax. Außerdem muss eine solche auf technischem Weg hergestellte Unterschrift nicht die Wesenszüge einer handschriftlichen Unterschrift haben.22 Insgesamt macht es auch aus meiner Sicht sehr viel Sinn, den Gutschein als Urkunde zu verstehen, da dieser tatsächlich sämtliche Merkmale aus den oben genannten Gesetzen erfüllt. Mit der Erstellung eines Gutscheins wird die Gedankenerklärung des Ausstellers verschriftlicht. Wie bereits oben erläutert, ist hier weder eine gegenständliche Verkörperung – es reicht auch eine elektronische aus – noch eine Unterschrift im herkömmlichen Sinn – es reicht ein auf technischem Weg aufgebrachter Firmenname oder eine Stampiglie – notwendig. Hieraus kann sich auch bereits die Erkennbarkeit des Ausstellers ergeben, dies muss aber nicht immer der Fall sein. Ist beispielsweise ein Vermittler zwischengeschalten, welcher nicht bloß für die Einbringlichkeit der Leistung haftet, sondern für die Leistung selbst, ist der Vermittler selbst auch Aussteller. Dass ein Gutschein zu Beweiszwecken im Rechtsverkehr gebraucht wird, ergibt sich daraus, dass man ohne den Gutschein keine Leistung erhält, da der Besitz des Gutscheins die Gewähr dafür ist, dass man die Vorleistung erbracht hat. C. Gutschein als Wertpapier Da bereits die Inhaberschaft des Gutscheins ausreicht, um die verbriefte Leistung zu erhalten, stellt sich die Frage, ob ein Gutschein nicht auch ein Wertpapier, insb ein Inhaberpapier sein kann. 1. Was ist ein Wertpapier? Ebenso wie beim Gutschein gibt es in Österreich – sowie auch in Deutschland – keine Legaldefinition des Begriffs des Wertpapiers. Folglich müssen erneut verschiedene Quellen herangezogen werden, um diesen Begriff zu definieren. Der Vorteil eines Wertpapieres liegt in seiner Verbriefung. Auch wenn es anfänglich nicht praktikabel erscheint ein Recht zu verbriefen und danach auf diese Urkunde angewiesen zu sein, hat es dennoch einige Vorteile. In erster Linie hat es für den Schuldner den Vorteil, dass er genau weiß an wen er zu leisten hat. Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da ein Schuldner nur schuldbefreiend leisten kann, wenn er an den Gläubiger leistet. Denkt man beispielsweise an die Garderobe eines Theaters, ist es mitunter oft schwierig den richtigen Gläubiger ausfindig 22 Bundesministerium für Finanzen, FINDOK 25527, Rz 505. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 13/50
zu machen. Mit der Verwendung des Abholscheins schützt man sowohl den Gläubiger vor
Rechtsmissbrauch – da nur der Inhaber des Abholscheins das Recht geltend machen kann –,
als auch den Schuldner, da dieser somit die Gewissheit hat, schuldbefreiend zu leisten.23
a) Österreichischer Wertpapierbegriff
Grundsätzlich kann man festhalten, dass es sich bei einem Wertpapier stets um eine Urkunde,
nicht aber bei jeder Urkunde um ein Wertpapier handelt. Man findet zwar in diversen Gesetzen
den Begriff des Wertpapiers, jedoch wird dieser in unterschiedlichsten Zusammenhängen
erwähnt und nicht definiert.24
Beispiel: § 1 Abs 1 Z 6 DevG definiert, worum es sich bei inländischen Wertpapieren handelt,
nämlich um „Wertpapiere, die von einem Inländer ausgestellt worden sind, sowie Zins-,
Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine von solchen Wertpapieren.“
Der Gesetzgeber definiert hier zwar die inländischen Wertpapiere, verabsäumt es jedoch in
weiterer Folge zu definieren, worum es sich bei einem Wertpapier überhaupt handelt, sondern
spricht nur über die Besonderheit eines „inländischen“ Wertpapiers.
Beispiel: Art 3 MAR bezeichnet Wertpapiere als:
Aktien und andere Wertpapiere, die Aktien entsprechen;
Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel oder
Verbriefte Schuldtitel, die in Aktien oder andere Wertpapiere, die Aktien entsprechen,
umgewandelt bzw gegen diese eingetauscht werden können.25
Beispiel: Auch in § 224 UGB wird der Begriff „Wertpapier“ vom Gesetzgeber verwendet,
welcher allerdings abermals keine Legaldefinition vornimmt.
Bei einem Wertpapier im Sinne des § 224 UGB handelt es sich um ein verbrieftes und
festverzinsliches oder mit Gewinn- und/oder Substanzbeteiligungsansprüchen versehene
Kapitalmarktpapiere. Genannt werden hier Anleihen, Pfandbriefe,
26
Wandelschuldverschreibungen, Aktien, Obligationen und Genussscheine.
Beispiel: Der EuGH vertritt die Ansicht, dass der Wertpapierbegriff durch folgende 3 Merkmale
gekennzeichnet ist:
23 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 5.
24 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6 (2011), 4.
25 Ketzerin/Gruber, BörseG 2018/MAR II Art 3 MAR.
26 Hofians in Straube/Ratka/Rauter, UGB II/RLG3 § 224.
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 14/50Der strittige Gegenstand bildet Eigentumsrechte an beweglichen oder unbeweglichen
Gegenständen, oder gewährt ein mit diesen Rechten im Zusammenhang stehendes Recht
Die strittigen Umsätze mit diesen Gegenständen sind ihrer Art nach Finanzgeschäfte
Es bestehen bei Nichtanwendung der Befreiung Schwierigkeiten in der Bestimmung der
Bemessungsgrundlage und der Höhe der abzugsfähigen Steuern.27
Unschwer zu erkennen ist bei dieser Definition, dass es sich wohl auch hier bloß um eine
gesetzesinterne Regelung handeln soll, da der EuGH hierbei explizit über die
Befreiungsbestimmungen für Umsätze mit Wertpapieren spricht. Folglich eignet sich auch diese
Definition nicht als allgemeingültige Begriffsbestimmung.
Die vorangegangenen Beispiele sollen aufzeigen, dass der Gesetzgeber den Begriff des
Wertpapiers zwar regelmäßig verwendet, jedoch keine Legaldefinition festlegt. In einigen
Gesetzen – wie etwa dem DepG, dem KMG oder dem WAG – nennt der Gesetzgeber zwar
explizit Urkunden, die als Wertpapiere gelten sollen, jedoch beschränkt er die Anwendbarkeit
mittels der Formulierung „im Sinne dieses Bundesgesetzes“ auf das jeweilige Gesetz.28
Daraus folgt, dass aus diesen Definitionen auf keine Allgemeingültigkeit für den
Wertpapierbegriff geschlossen werden darf, da der Gesetzgeber die entsprechenden
Definitionen explizit auf die Anwendung eines Gesetzes beschränkt.
Aus Ermangelung einer allgemeingültigen Definition des Wertpapierbegriffs durch den
Gesetzgeber, blieb es schlussendlich der Lehre vorbehalten, eine Definition zu schaffen, die für
die Rechtswissenschaften allgemeine Anwendbarkeit schafft. Es entwickelten sich der „weite“
und der „enge“ Wertpapierbegriff.29
(1) Der „weite“ Wertpapierbegriff
Darunter versteht man die auf den Schweizer Heinrich Brunner zurückgehende Definition, der
den Begriff des Wertpapieres in „Die Wertpapiere“ prägte, welche in „Endemanns Handbuch des
deutschen Handels-, See- und Wechselrechts, Band II“ publiziert wurde.30
„Ein Wertpapier ist eine Urkunde, in der ein Privatrecht in der Weise verbrieft ist, dass zur
Geltendmachung des Rechts die Innehabung der Urkunde erforderlich ist.“31
27 EuGH 12.6.2014, C-461/12.
28 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 4.
29 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 4.
30 Vgl Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 8.
31 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 4f.
01. Juni 2021 PARZER Ulrich 15/50Aus dieser Definition ergeben sich 3 wesentliche Merkmale eines Wertpapiers: (a) Urkunde Es muss sich bei einem Wertpapier stets um eine Urkunde handeln, da die Verbriefung eines Rechts in einer körperlichen Sache Voraussetzung ist.32 (b) Privates Recht Es muss explizit ein privates Recht verbrieft sein und kein öffentlich-rechtliches, was zum Ausschluss von bspw Geburtsurkunden, Führerscheinen und Gewerbescheinen führt.33 (c) Innehabung Für die Rechtsausübung muss die Innehabung der Urkunde erforderlich sein. Es muss also das Recht insoweit mit der Urkunde verbunden sein, als ohne diese die Ausübung des Rechts nicht möglich ist.34 (2) Der „enge“ Wertpapierbegriff Im Wertpapierrecht unterscheidet man zwischen Inhaber-, Order- und Rektapapieren. Die Inhaber- und Orderpapiere können nach den sachenrechtlichen Grundsätzen übertragen werden, was eine Voraussetzung für die Subsumtion unter den engen Wertpapierbegriff nach Ulmer und Raiser darstellt. Da die Rektapapiere bloß mittels Zession übertragen werden können, fallen diese nicht unter den engen Wertpapierbegriff, sehr wohl aber unter den weiten.35 b) Schweizer Wertpapierbegriff In der Schweiz gibt es im Gegensatz zum restlichen deutschsprachigen Raum eine Legaldefinition des Wertpapiers in Art 965 OR. Diese lautet: „Wertpapier ist jede Urkunde, mit der ein Recht derart verknüpft ist, dass es ohne die Urkunde weder geltend gemacht noch auf andere übertragen werden kann.“ Diese Definition ist dem weiten Wertpapierbegriff recht ähnlich, jedoch spricht das OR hier nicht explizit von einem „privaten“ Recht, sondern bloß von einem allgemeinen. Hiermit wäre hinsichtlich der Gültigkeit als Wertpapier auch der Raum für die öffentlichen Rechte eröffnet. Dieser Gedanke macht jedoch mE wenig Sinn, da dies sehr weit vom allgemeinen und insbesondere vom wirtschaftlichen Begriff des Wertpapiers abweicht, wenn man bspw den Führerschein und eine Aktie unter dieselbe Definition bringt. 32 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 9. 33 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 9. 34 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 9. 35 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 6. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 16/50
2. Ergebnis Hinsichtlich der Definitionsbildung überlässt es der Gesetzgeber der Lehre, einen allgemeingültigen Wertpapierbegriff zu bilden, was diese unter Zuhilfenahme der Definition des Schweizers Heinrich Brunner aus dem Jahre 1882 auch getan hat. Es wird zwischen dem engen und dem weiten Wertpapierbegriff unterschieden, welche sich aber bloß in der Zuordnung der Rektapapiere unterscheiden.36 Hinsichtlich der Subsumtion des Gutscheins unter den Begriff des Wertpapiers ist diese Unterscheidung unerheblich, da die generelle Wertpapierdefinition nach Brunner dieselbe bleibt. Ein Gutschein ist – wie bereits oben erläutert – jedenfalls als eine Urkunde anzusehen. Probleme bereitet jedoch die Verbriefung eines privaten Rechts, da mit der Ausstellung eines Gutscheines zwar eine Urkunde erstellt wird, jedoch diese nicht als Verbriefung des privaten Rechts selbst, sondern bloß als eine Legitimationsurkunde anzusehen ist.37 Der Zweck der Legitimationsurkunde ist es, dem Schuldner die Überprüfung der Berechtigung des Vorlegers zu erleichtern. Der Inhaber der Urkunde gilt als legitimiert zur In-Empfangnahme der Leistung und der Schuldner kann an diesen schuldbefreiend leisten. Folglich unterscheidet sich die Legitimationsurkunde – und somit auch der Gutschein – von einer Beweisurkunde – bspw einer Quittung – durch die Liberationsfunktion zugunsten des Schuldners.38 Es handelt sich bei einem Gutschein deshalb nicht um ein Wertpapier, da der Nachweis auf den Anspruch auf eine Leistung auch auf andere Weise erbracht werden kann. Siehe II.D.3. Die Abgrenzung, ob es sich um eine Beweis- bzw um eine Legitimationsurkunde oder um ein Wertpapier handelt, hängt – abgesehen von einer natürlich vorgehenden gesetzlichen Regelung, wie etwa der Bezeichnung eines Sparbuchs als Wertpapier gem § 32 Abs 2 BWG – davon ab, welche Wirkung damit verbunden sein soll: Es ist der Wille des Ausstellers maßgeblich. Soll bloß mit der Urkunde und mit nichts sonst eine Leistung erhalten werden können, handelt es sich um ein Wertpapier. Soll die Leistung auch noch auf andere Weise erlangt werden können, handelt es sich um eine einfache Legitimationsurkunde. Ist der Wille des Ausstellers nicht eindeutig, gilt die Verkehrsauffassung. Bei ausdrücklicher Erklärung des Ausstellers kann es sich folglich bei einem Gutschein sehr wohl um ein Wertpapier handeln, da es hierzu keine gesetzliche Regelung gibt und die Verkehrsauffassung nicht zur Anwendung kommt.39 36 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 4ff. 37 Vgl Melhardt/Tumpel, UStG 2011, § 6, Rn 239 38 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 6f. 39 Grünwald/Schummer, Wertpapierrecht6, 7. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 17/50
Die allgemeine Verkehrsauffassung wird es bei Gutscheinen mE nach sein, dass bei dessen Verlust die Leistung auch durch Vorlage der Quittung oder einer anderen Form des Nachweises des Rechts erfolgen muss. 3. Entmaterialisierung Die Entmaterialisierung bezeichnet den Vorgang einer Tendenz zu unverbrieften Rechten. Dieser Trend folgt einerseits aus der Schwierigkeit der Verwahrung von solchen Rechten, andererseits aus der Problematik, die sich aus deren Geltendmachung ergibt. Soll ein verbrieftes Recht geltend gemacht werden, müsste man für jedes Recht separat den entsprechenden Lagerraum aufsuchen und die Urkunde hervorholen. Die Verwahrung gestaltet sich deshalb als so schwierig, da man die verbrieften Rechte sowohl vor menschlicher als auch natürlicher Einflussnahme schützen muss. Hierunter versteht man bspw Diebstahl, Missbrauch, Brand- oder auch Wasserschäden etc. Dieses sog „Massenproblem der Effekten“ wird durch Buchungen auf Wertpapierkonten gelöst. Folglich ist die Übertragung durch bloße Buchungsvorgänge möglich. Darüber hinaus sind Wertpapierinhaber, seit dem GesRÄG 2011 dazu verpflichtet, ihre Wertpapiere durch ein Kreditinstitut verwahren zu lassen.40 D. Rechtsnatur eines Gutscheins In diesem Kapitel soll – wie bereits der Titel vermuten lässt – die Rechtsnatur des Gutscheins erläutert werden. Wie bereits erwähnt, lässt das österreichische Recht eine Definition missen. Deshalb soll diese Arbeit – und im speziellen das folgende Kapitel – mögliche Ansätze zu diesem Thema ansprechen und auch auf ihre Anwendbarkeit prüfen. 1. Allgemeines Bei der Beurteilung der Rechtsnatur von Gutscheinen macht es zuallererst Sinn, typische Grundformen herauszustellen. Wenig zielführend ist hierbei die Bearbeitung von Waren- und Geldgutscheinen, da diese kaum rechtliche Unterscheidungen aufweisen. Es ist am zweckmäßigsten, die beiden Gruppen der Werbegutscheine einerseits und jene der Umtausch- und Geschenkgutscheine andererseits zu betrachten. Hintergrund dafür ist, dass bei Geschenkgutscheinen der Kunde erst zum Vertragsschluss gelockt werden soll, wohingegen bei Umtausch- und Geschenkgutscheinen bereits ein Grundgeschäft zugrunde liegt und somit der der Kunde bereits – von sich aus – zu einem Vertragsschluss bereit war.41 Hinsichtlich der Erläuterungen der diversen Gutscheinformen siehe III. 40 Koller/Wolkerstorfer, Wertpapierrecht, 11f. 41 Eccher, ÖJZ 1974, 337. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 18/50
2. Rechtsnatur am Beispiel des Werbegutscheins Zuallererst ist zu klären, was der Vorteil des Gutscheininhabers ist, also ob ihm Rechtsansprüche zustehen und auch wie weit diese gehen. Die sog Rabatt- und Zugabenankündigungen sind vom Abschluss des Hauptgeschäfts abhängig und lassen sich daher nicht davon trennen. Ohne das Hauptgeschäft besteht offensichtlich kein Anspruch auf eine, wie auch immer, geartete Zusatzleistung oder einen Rabatt. Insb bei der Rabattankündigung soll für den Kunden kein Geldanspruch bestehen, da der Gutscheininhaber kein Geld zurückbekommt, sondern von Beginn an einen günstigeren Preis erhält. Auch bei der Zugabe ändert sich hieran nichts, da diese eine einheitliche Gegenleistung zum Kaufpreis bildet und bereits in diesen einkalkuliert ist. Eine sog echte Berechtigung auf die verbundene Begünstigung läge nur dann vor, wenn der Gutschein an sich bereits einen annahmefähigen Antrag zum Geschäft darstellen würde, da dies den Inhaber dazu ermächtigen würde, den Vertrag durch einen einseitigen Akt zu vervollkommnen. Da Werbegutscheine aber meistens an einen unbestimmten Personenkreis ausgestellt werden, fehlt es meist am Bindungswillen des Ausstellers. Folglich handelt es sich bloß um eine invitatio ad offerendum, was dazu führt, dass der Gutscheininhaber den Vertrag eben nicht einseitig perfekt machen kann. 42 Exkurs: „invitatio ad offerendum“ Ein Angebot muss einen Bindungswillen des Anbietenden beinhalten, wobei eine bloße Einladung zu einer Verhandlung nicht ausreicht. Unter einer invitatio ad offerendum versteht man eine unverbindliche Aufforderung des Anbieters zur Stellung eines Angebots seitens des Empfängers (im Zuge dieser Arbeit der Gutscheininhaber).43 Insbesondere bei Werbeangeboten im Internet kann von einer invitatio ad offerendum ausgegangen werden, da sich sonst der Anbieter einem unverhältnismäßig hohen Risiko aussetzt, sollte die Ware, die er anbietet, nicht mehr vorrätig sein. Ab diesem Zeitpunkt wäre er Schadenersatzpflichten ausgesetzt.44 Bei postalisch ausgesendeten Gutscheinen ist der Personenkreis nicht mehr unbestimmt, da der Aussteller genau weiß, wie viele Gutscheine er versendet. In diesem Fall schafft die Formulierung „solange der Vorrat reicht“ Abhilfe, um das Risiko des Ausstellers zu mindern. Denkbar wäre in diesen Fällen auch eine Auslobung im Sinne einer Zusage einer Belohnung gem § 860 ABGB. Wie bereits oben erwähnt handelt es sich allerdings nicht um eine zusätzliche Leistung, sondern um eine mit dem Hauptgeschäft verbundene. Es liegt daher keine Belohnungszusage vor, da die Erbringung der Leistung im Belieben des Auslobenden liegt und nicht in jenem des Gutscheininhabers. Um eine Auslobung handelt es sich jedenfalls immer dann, wenn eine Ankündigung des Auslobenden vorliegt, gegen Rücksendung eines als 42 Eccher, ÖJZ 1974, 337f. 43 Vgl Riedler, ZR I AT6, 133. 44 Wiebe in Kletečka/Schauer, ABGB-ON1.03 § 861 (Stand 1.1.2018, rdb.at). 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 19/50
Gutschein bezeichneten Papiers eine unentgeltliche Leistung zu erbringen. Insb zu beachten ist, dass es sich um ein Geschäft handeln muss, das möglicherweise erst in ferner Zukunft liegt und eine davon unabhängige Leistung – die Belohnung – trotzdem erbracht werden soll.45 Exkurs: „Auslobung“ Bei einer Auslobung handelt es sich um ein einseitiges und entgeltliches Rechtsgeschäft. 46 Die Verbindlichkeit entsteht erst mit der öffentlichen Bekanntgabe des Auslobenden an einen unbestimmten Personenkreis, welcher aber durchaus näher bestimmt werden kann. Inhalt dieser Bekanntgabe ist eine Belohnung für eine Leistung oder einen Erfolg, welche über alle gängigen Medien, wie etwa Tageszeitungen, Plakate oder Websites im Internet angekündigt wird. Keine Auslobung liegt bei Zusagen an bestimmte Personen iSd § 861 ABGB vor. 47 Die deutsche Lehre und Rsp haben bereits eine eindeutige Antwort auf die Frage der Rechtsnatur von Gutscheinen. Diese werden als kleine oder unvollkommene Inhaberpapiere qualifiziert (§ 807 BGB). Die Bezeichnung „klein“ bzw „unvollkommen“ kommt daher, dass einerseits die Unterschrift des Ausstellers nicht erforderlich ist, und andererseits durch die meist unvollständigen Angaben über den Inhalt bzgl der Leistung. In Österreich fehlt eine solche dem § 807 BGB entsprechende Regelung, wobei aber entsprechende Parallelen gezogen werden können. Auch die in Österreich ausgegebenen Urkunden weisen die oben angesprochene unvollständige Form auf. Darüber hinaus soll dem Inhaber ein schuldrechtlicher Anspruch gewährt werden, wobei die Leistung an jeden Inhaber schuldbefreiende Wirkung hat. Relevant ist zusätzlich, dass die Innehabung des Papieres zwar notwendig ist, aber im Gegensatz zu den „vollkommenen“ Inhaberpapieren auch ausreichend ist, um die Leistung zu erhalten. Grds würde es sich aufgrund dieser gewünschten Rechtsscheinwirkungen um ein echtes Inhaberschuldversprechen handeln, diesem mangelt es jedoch an der vollständigen Form, insb an der Unterschriftlichkeit. Die Unterordnung der äußeren Form dieser Gutscheine unter Marken, Karten und ähnliche Zeichen bereitet auch in Österreich keine Schwierigkeiten, da diese unterschiedlichen Rechtscharakter – und vor allem auch Wertpapiercharakter – tragen können. Man muss daher zu dem Schluss gelangen, dass auch das österreichische Recht – wenn auch nicht ausdrücklich – ebenso wie das deutsche, kleine Inhaberverpflichtungszeichen kennt. Sogar die angepassten Konsequenzen der Eigenarten entsprechender Marken, Karten und ähnlichen Zeichen im deutschen Recht, lassen sich in Österreich ziehen. Eine Kraftloserklärung scheidet gem § 2 KEG aus. Da keine Vorlegungsfristen für Wertpapiere bestehen, bedarf es keiner gesonderten Herausnahme dieser Papiere. Schlussendlich besteht 45 Eccher, ÖJZ 1974, 337f. 46 Vgl OGH 02.07.2008, 7 Ob 17/08p. 47 Riedler in Schwimann/Kodek (Hrsg), ABGB Praxiskommentar5 (2019) § 860 Rz 1. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 20/50
auch keine staatliche Genehmigungspflicht, da diese wegen des geringen Wertes dieser Papiere nicht sinnvoll ist.48 3. Rechtsnatur am Beispiel des Umtauschgutscheins Wesentlich für diesen Ansatz ist, dass es keine wie auch immer geartete Barablöse des Gutscheins geben darf. Bloß eine Neuausstellung des Gutscheins in Höhe des Differenzbetrages soll möglich sein, sollte bspw der Wert eines Gutscheins beim Einkauf unterschritten werden. Denkbar sind zwei Ansätze über die rechtsgeschäftliche Konstruktion: Erstens könnte ein Güteraustauschvertrag vorliegen, der bereits zum Vertragsschluss endgültig ist. Damit würde ein mit dem Gutschein verbriefter Anspruch auf die Ware entstehen. Die Abwicklung es Vertrages würde sich in der Warenauswahl erschöpfen und eine neuerliche Einigung ist nicht notwendig. Für diese Konstruktion spricht unter anderem deren Einfachheit, aber auch die endgültige Bindung an den Vertrag. Der Aussteller muss eine Ware herausgeben, der Inhaber kann kein Geld mehr zurückfordern. Die zweite Variante ist erheblich komplizierter, da es hierbei zum Erwerb eines Zahlungs- bzw Tauschmittels kommt, welches dann in einem zweiten Rechtsgeschäft gegen die Ware eingetauscht werden muss. Fraglich ist hierbei, ob diese Variante sinnvoll ist, da man in der Warenauswahl wohl nur sehr schwer einen eigenen Vertrag sehen kann. Liegt ausreichende Bestimmtheit des Warenanspruchs vor – bspw Auswahl aus dem Kaufhaussortiment – spricht nichts gegen die Anwendung der ersten Konstruktion. Ein schuldrechtlicher Anspruch bedarf allerdings einer entsprechenden Bestimmtheit – bzw einer Bestimmbarkeit – iSd § 1056 ABGB. 49 In der Regel legen die Parteien gemeinsam die zu erbringenden Leistungen fest. Dies gilt sowohl für ein etwaiges Entgelt, als auch für eine Austauschleistung. Für den Fall, dass sich die Parteien nicht einigen, kann die Leistung entweder durch eine Person außerhalb des Vertragsverhältnisses bestimmt werden – bzw auch durch mehrere gem § 1057 ABGB – oder aber, eine Partei entscheidet allein und ohne Einverständnis des Vertragspartners.50 Für von solchen Rechtsgeschäften abweichende Verträge normiert das ABGB keine vom Kaufrecht abweichenden Bestimmungen. Dem Ermessen hinsichtlich der Schuld müssen jedoch objektive Schranken gesetzt werden, um eine Ausuferung zu verhindern. Es ist nicht notwendig, dass die Parteien über alle Möglichkeiten absprechen, sondern es genügt, wenn eine entsprechende Abgrenzung vorgenommen wird. Bspw sei hier das Warenangebot eines bestimmten Verkäufers genannt. Der Vorauszahlungskauf aus schweizerischem Recht stützt diese These. Kern dieses Rechtsgeschäfts ist es, dass eine Zahlung in Raten vor Bezug der Leistung geleistet wird, und die Gegenleistung mit dem Zeitpunkt des Wahlrechts zusammenfällt.51 Hierzu hat das 48 Eccher, ÖJZ 1974, 338f. 49 Eccher, ÖJZ 1974, 339f. 50 Schwartze in Fenyves/Kerschner/Vonkilch (Hrsg), Klang3 (2019) § 1056 Rz 2. 51 Eccher, ÖJZ 1974, 339f. 01. Juni 2021 PARZER Ulrich 21/50
Sie können auch lesen