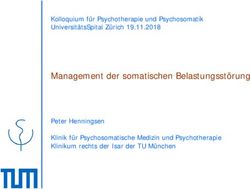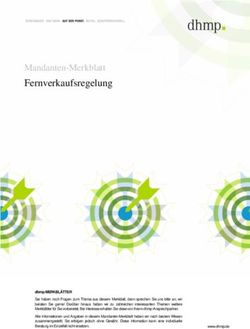Gesundheitsgespräch - Bayerischer ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gesundheitsgespräch Chronische Schmerzen Sendedatum: 23.02.2022 Experte: Dr. med Andreas Winkelmann, Leiter Interdisziplinären Schmerzambulanz, Leiter Physikalische und Rehabilitative Medizin, Muskuloskelettales Universitätszentrum München – MUM, Campus Innenstadt, LMU Klinikum München Autorin: Katrin Bohlmann Chronische Schmerzen schränken das Leben ein. Wer unter chronischen Schmerzen leidet, ist nicht nur körperlich, sondern auch psychisch stark belastet. Stress, Anspannung, Angst, aber auch Depressionen, Schlafmangel und Magen-Darmreizungen gehören dazu. Die Folge: Die Betroffenen ziehen sich zurück, haben weniger soziale Kontakte, bewegen sich weniger, bleiben zu Hause. Ein Teufelskreis. Chronische Schmerzen können verschiedene Ursachen haben: schwere Unfälle mit Nervenschädigungen, Erkrankungen wie Krebs, Arthrose und Fibromyalgie, traumatische Erlebnisse wie Gewalt und Missbrauch sowie Stress und Burnout. Dem Text liegt ein Gespräch mit Dr. med. Andreas Winkelmann zugrunde, Leiter Interdisziplinären Schmerzambulanz, Leiter Physikalische und Rehabilitative Medizin, Muskuloskelettales Universitätszentrum München – MUM, Campus Innenstadt, LMU Klinikum München Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich! © Bayerischer Rundfunk 2022 Bayern 2-Hörerservice Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258 service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 1
Was sind chronische Schmerzen?
Chronische Schmerzen entstehen oft aus akuten Beschwerden. Sie bestehen
weiter, auch wenn die Ursache längst behoben ist. Anhaltende Schmerzreize
lassen die Nervenzellen immer empfindlicher auf die Reize reagieren,
infolgedessen sinkt die Schmerzschwelle. Die Nerven leiten die Informationen,
die Sinnesreize, an die entsprechenden Gehirnareale weiter. Diese
wiederholten Schmerzreize hinterlassen "Schmerzspuren", die sich zu
einem Schmerzgedächtnis entwickeln.
Chronische Schmerzen sind Schmerzen, die über einen längeren Zeitraum
anhalten und die Betroffenen auch im Alltag limitieren. Per Definition wird ein
chronischer Schmerz nach seinem Zeitrahmen erfasst: ab drei Monate. Länger
als sechs Monate ist es zum Beispiel definiert bei einer chronischen
Schmerzstörung mit körperlichen und psychischen Faktoren, die dann die
Chronifizierung aufrechterhalten. Dabei geht es vor allem um das Leid. Da kann
dann auch ein Schmerz mit einer vielleicht nur mäßigen Stärke eine große
Belastung darstellen. Chronische Schmerzen folgen also anderen
Gesetzmäßigkeiten als akute Schmerzen.
"Wenn beim akuten Schmerz zum Beispiel der Zahnarzt tief hineinbohrt in den
Zahn, dann ist der Schmerz furchtbar stark. Aber ich weiß: Wenn der Bohrer
aus ist, dann ist der Schmerz auch vorbei. Der ganz starke Schmerz ist zeitlich
begrenzt und dadurch auch leichter zu ertragen als ein chronischer Schmerz."
Dr. Andreas Winkelmann
Rücken- und Kopfschmerzen: klassische chronische Schmerzen
Oft ist der Bewegungsapparat erkrankt, meist der Rücken. Dabei muss geklärt
werden, ob es eine spezifische Ursache gibt und welche Strukturen
verantwortlich sind. Klassische chronische Schmerzen sind auch die
Kopfschmerzen: zum Beispiel eine Migräne. Man unterscheidet zwischen
chronischem oder episodischem Spannungskopfschmerz.
Ursachen für chronische Schmerzen?
Chronische Schmerzen können aus Belastungssituationen entstehen, zum
Beispiel durch einen Unfall, also ein körperliches Trauma. Ursache kann auch
ein psychisches Trauma sein wie Gewalt und Missbrauch, das dann länger
Spannung verursacht. Möglicherweise ist alles wieder verheilt, aber im Kopf, im
Schmerzgedächtnis, sitzt noch der Schmerz und damit auch das Leid.
Chronische Schmerzen können durch eine Vielzahl von Faktoren begünstigt
werden:
Stress
Anhaltende Anspannung
Burnout
Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden.
Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich!
© Bayerischer Rundfunk 2022
Bayern 2-Hörerservice
Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258
service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 2 Familiäre Konflikte
Angststörungen
psychische Erkrankungen
Krankheitsbedingte Auslöser von chronischen Schmerzen:
Tumorschmerzen – die mit starken Medikamenten, aber auch
durch Bestrahlung (der Knochen) gut gelindert werden können
Fibromyalgie – eine immer noch rätselhafte Schmerz-
Überempfindlichkeit des ganzen Körpers
Arthrose – Veränderung der Gelenke, zum Beispiel der Knie-
oder Hüftgelenke
Chronische Polyarthritis – das entzündliche Rheuma, eine
Autoimmunerkrankung, die ebenfalls die Gelenke befällt, aber
auch Auswirkungen im gesamten Körper haben kann
Fibromyalgie: die chronische Schmerzerkrankung
Schmerzen im ganzen Körper – permanent oder phasenweise, über Jahre: das
verursacht die Fibromyalgie, auch Fibromyalgiesyndrom genannt. Fibromyalgie
bedeutet Faser-Muskel-Schmerz. Das ist das Hauptsymptom der Erkrankung.
Die chronische Schmerzerkrankung äußert sich in verschiedenen
Körperregionen: auf der Haut, in den Muskeln und Gelenken. Die Schmerzen
fühlen sich oft wie Muskelzerrung oder ein heftiger Muskelkater an. Sie sind
meist unberechenbar und können jeden Tag anders sein. Dazu kommen
typische Beschwerden wie Schlafstörungen, Erschöpfung und
Konzentrationsprobleme.
Fibromyalgie ähnelt dem Rheuma und betrifft vor allem Frauen. Die
Wissenschaft vermutet, dass Fibromyalgie durch mehrere Faktoren ausgelöst
wird: genetisch bedingt, aber auch durch körperliche und psychische
Belastungen, die zu Veränderungen in der Schmerzverarbeitung führen.
Auch wenn die Fibromyalgie schon seit mehr als 30 Jahren als Erkrankung
anerkannt ist, wird den Betroffenen häufig immer noch vorgeworfen, sie würden
sich ihre Beschwerden einbilden. Das erhöht die psychische Belastung. In der
Schmerzambulanz helfen Ärzte und das gesamte Team mit verschiedenen
Behandlungen und Anleitungen, um die Beschwerden deutlich zu verbessern.
Die multimodale Therapie
Zu einer guten und wirksamen Therapie von chronischen Schmerzen gehört ein
multimodales Konzept. Das bedeutet: eine umfassende Diagnostik und eine
interdisziplinäre Therapie. Grundlage der multimodalen Schmerztherapie ist das
Verständnis von chronischem Schmerz als eigenständige Krankheit. Unter
multimodaler Schmerztherapie versteht man eine fachübergreifende und
Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden.
Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich!
© Bayerischer Rundfunk 2022
Bayern 2-Hörerservice
Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258
service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 3methodenübergreifende Behandlung von Patientinnen und Patienten mit chronischen Schmerzen. In einem "Schmerzassessment" werden die Patienten nach ihren Beschwerden abgefragt und untersucht. Die Therapiebausteine werden aufeinander abgestimmt und finden im Rahmen einer ambulanten, teilstationären oder vollstationären Krankenhausbehandlung gleichzeitig statt. Es werden also nicht wie sonst einzelne Verfahren seriell eingesetzt. Dabei werden verschiedene somatische, also körperbezogene, und psychologische Therapieformen nach vorgegebenem Behandlungsplan und im Rahmen des therapeutischen Teams abgesprochen und Therapieziele mit gemeinsamer Kontrolle bereitgestellt. Bei einer solchen individuell auf den einzelnen Patienten abgestimmten Behandlung wirken zum Beispiel spezialisierte Ärztinnen und Ärzte, Physiotherapeuten, Sporttherapeuten, Ergotherapeuten und Psychologen zusammen. "Wir packen die Erkrankung an der Wurzel. Und wenn wir eine Ursache wissen, können wir diese behandeln und damit auch die Beschwerden damit deutlich verbessern. Im günstigsten Fall heilen." Dr. Andreas Winkelmann Bewegung ist das A und O Multimodal bedeutet dabei, dass alle Bereiche abgedeckt sind, das heißt mindestens ein körperlich aktivierendes Verfahren, kombiniert mit mindestens einem psychotherapeutischen, ebenfalls aktivierenden Verfahren. Dazu gehören: Wie kann ich wieder zur Ruhe kommen? Wie kann ich mit Bewegung etwas erreichen oder Freude an der Bewegung (zurück-)erlangen? Dafür gibt es verschiedene Übungen: Physiotherapie, Haltungsschulung, meditative Bewegungstherapien wie Tai Chi, Qigong oder Yoga oder einfach spielend bewegen, vielleicht mit Musik. Die Psyche spielt eine entscheidende Rolle Bei dem psychotherapeutischen Verfahren ist es wichtig, den Zusammenhang zwischen Schmerz und Stress und dann vermehrter Anspannung zu erkennen. Dabei sollen die Patienten lernen, in sich hineinzuhorchen, zu analysieren und wie sie genau aus diesem Teufelskreis herauskommen. Welche Möglichkeiten, Ressourcen und Kraftquellen können sie dafür einsetzen? Das kann bei jedem etwas anderes sein. Ziel der multimodalen Therapie Das erste Ziel ist, die Funktion zu verbessern und die Schmerzen zu minimieren. Dann ist die Anleitung zur Selbsthilfe wichtig, um dadurch zu mehr Lebensqualität zu kommen, im Alltag zu funktionieren und möglichst beschwerdefrei aktiv zu sein. Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich! © Bayerischer Rundfunk 2022 Bayern 2-Hörerservice Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258 service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 4
"Wichtig ist, dass der Patient merkt, dass er es selbst in der Hand hat und dass er Erfahrungen machen kann: Was hilft mir? Was kann ich in welchen Situationen einsetzen? Und wenn Sie etwas selber schaffen, dann haben sie Unabhängigkeit, Selbständigkeit. Und dann ist es leichter, die Verantwortung zu übernehmen." Dr. Andreas Winkelmann Hilfe zur Selbsthilfe: Arzt und Patient besprechen dafür eine Vereinbarung für ein erfolgreiches Training. Dabei legen sie realistische Ziele in einer bestimmten Zeit fest. Wieviel Minuten will der Patient jeden Tag bewusst für sich etwas Gutes tun? Es muss nicht am Stück sein, die Minuten können am Tag eingeteilt werden. Die "Therapie" sollte spielend jeden Tag zu schaffen sein und nicht eine große Hürde aufbauen. Auch mit zwei Minuten kann man anfangen. "Ich frage dann auch fast täglich ab: Was haben Sie für sich tun können? Was haben Sie vielleicht von dem Erlernten einsetzen können? Was haben Sie vielleicht Neues entdeckt - selbständig, unabhängig auch von uns Ärzten und Therapeuten?" Dr. Andreas Winkelmann Ziel: Patient hat den Schmerz im Griff und nicht umgekehrt Beim chronischen Schmerz ist es oft so, dass der Schmerz den Patienten im Griff hat. Durch eine multimediale Behandlung und Therapie soll das umgedreht werden: der Patient soll den Schmerz im Griff haben. Denn weniger Leid bedeutet mehr Lebensqualität. Medikamente Medikamente können stabilisierend oder schmerzlindernd wirken. In erster Linie geht es darum, das Leid zu minimieren. Dabei müssen bestehende Begleiterkrankungen berücksichtigt werden. Beispiel Fibromyalgiesyndrom mit einer Depression: Da gibt es nach Leitlinie das Medikament Duloxetin zur Behandlung von Depression oder Angststörungen. Es ist antriebssteigernd, gibt Energie, lässt den Patienten auch besser schlafen und reduziert zugleich den Schmerz. Die Dosis startet gering und steigert sich langsam. Wenn die Nebenwirkungen abnehmen, dann kommt man in einen therapeutischen Bereich und somit in ein besseres Befinden. Die Patienten leiden dann weniger unter den Beschwerden. Gibt es keine Begleiterkrankung einer depressiven Störung, sondern "nur" einen chronischen Schmerz, dann kann das Medikament Amitriptylin helfen. Das wird oft zusätzlich zu anderen Schmerzmedikamenten gegeben und wurde für chronischen Schmerz zugelassen. Ursprünglich wurde es als Antidepressivum entwickelt, es kommt also aus der Klasse der trizyklischen Antidepressiva und wirkt dämpfend. Deswegen wird das Medikament abends Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich! © Bayerischer Rundfunk 2022 Bayern 2-Hörerservice Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258 service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 5
eingesetzt, so dass man besser einschlafen kann und der Schmerz einem nicht so viel ausmacht. Es ist aber kein "Painkiller". Aber: Man muss eine Dosis finden, die passt, es muss einigermaßen verträglich sein und es darf keine Kontraindikationen geben. Je nach Dosis unterscheidet man, wann es für Schmerz eingesetzt wird und wann auch für das psychiatrische Setting. Bei rein chronischen Schmerzen versucht man, die Beschwerden einzudämmen. Dafür gibt es nach der WHO ein Stufenschema. Ein einfaches Medikament ist Paracetamol. Beim Kreuzschmerz hilft das vermutlich nicht mehr. Dafür könnte man episodisch - also nicht als Dauertherapie - Ibuprofen oder Diclofenac Voltaren einsetzen, um wieder Aktivitäten aufnehmen zu können. Beim Fibromyalgiesyndrom sollten diese Medikamente nicht genommen werden, da man in klinischen Studien keinen Nutzen oder Vorteile gegenüber Placebo gesehen hat. Grenzen der Therapie: Ist der Schmerz heilbar? Im besten Fall sollte das Ziel der Schmerztherapie sein, die Beschwerden zu lindern. Je nach Ursache ist der Schmerz heilbar. "Da stellt sich die Frage: Wie wird denn Heilung definiert? Ist Heilung, wenn wir nicht mehr darunter leiden oder ist heilen, wenn ich tatsächlich keinen Schmerz mehr spüre? Wir sind bei der Heilung, wenn der Patient sagt: Mir macht der Schmerz nichts mehr aus." Dr. Andreas Winkelmann Beim Rheuma zum Beispiel kann man für sich erkennen: Die Erkrankung ist stabilisiert, damit ist es gut. Beim Fibromyalgiesyndrom kann man sagen: Irgendwo tut es immer weh. Hier ist es wichtig, nicht immer gegen sich selbst zu kämpfe, sondern es zu schaffen, für sich zu akzeptieren: 'Ja, ich habe diese Erkrankung.' Das Leben mit dem Schmerz: Tipps Viele Betroffene leiden jahrelang unter den Schmerzen, rennen von Arzt zu Arzt, bis ihnen endlich geholfen wird. Deswegen: schnell Hilfe holen, hartnäckig bleiben und offen sein für Neues. Es gibt viele Möglichkeiten, die helfen können. Wenn man etwas Neues gewinnt, etwas ausprobiert, dann hat man auch etwas fürs Leben gewonnen, das lange zusätzlich helfen kann. "Große Offenheit. Das wünsche ich allen für möglichst Wohlbefinden und auch Lebensqualität." Dr. Andreas Winkelmann Prävention Um Schmerzen vorzubeugen hilft in erster Linie Bewegung. Für alle Schmerz- Erkrankungen gilt: Bewegung tut gut. Es gilt, die geeignete Bewegung zu Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich! © Bayerischer Rundfunk 2022 Bayern 2-Hörerservice Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258 service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 6
finden, die zur Leistungsfähigkeit führt und zu den Präferenzen, was Sie gerne an Bewegung machen, was Sie einsetzen können und wollen. Diejenigen, die vielleicht Bewegungsmuffel sind, sollten sich motivieren. Sie merken schnell, dass ihnen regelmäßige Bewegung guttut. Die täglichen Ziele muss jeder realistisch selbst setzen. Ausdauer ist etwas, das jeder auch im Alltag braucht, um über den Tag gut hinwegzukommen und um den Kreislauf insgesamt zu aktivieren. Bewegung ist außerdem wichtig für die Konzentration, für die Kopfarbeit. Der Weg zur Schmerzambulanz In der Regel wird ein Überweisungsschein für die Schmerzambulanz gewünscht. In jeder Region in Bayern gibt es Schmerzkliniken. Online erfährt man die Sprechstunden-Zeiten. Oft muss man vorher einen Fragenbogen ausfüllen. Der ist entweder auf der Homepage hinterlegt oder er wird zugeschickt. Das ist sozusagen die Eintrittskarte. Der Fragebogen wird zunächst vom Klinik-Team angesehen, danach wird überlegt, in welcher Sprechstunde die Patientin oder der Patient am besten aufgehoben ist. Oft gibt es zusätzlich einen Austausch mit dem zuvor behandelnden Arzt. Dieses Manuskript wird ohne Endkorrektur versandt und darf nur zum privaten Gebrauch verwendet werden. Jede andere Verwendung oder Veröffentlichung ist nur in Absprache mit dem Bayerischen Rundfunk möglich! © Bayerischer Rundfunk 2022 Bayern 2-Hörerservice Bayerischer Rundfunk, 80300 München; Service-Nr.: 0800 / 5900 222 Fax: 089/5900-46258 service@bayern2.de; www.bayern2.de Seite 7
Sie können auch lesen