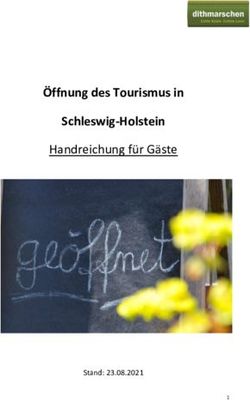Harnwegs-infektionen im Pflegewohnheim - ggz.graz.at Fortbildung für hausärztliche Dienste der Pflegewohnheime GGZ - GGZ Graz
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Harnwegs-
infektionen im
Pflegewohnheim
Fortbildung für hausärztliche Dienste
der Pflegewohnheime GGZ
18.05.2021
ggz.graz.at
Christoph OrtnerThemen
Geriatrische Aspekte von Infektionen
Prävention von Harnwegsinfektionen
Diagnostik und Therapie von Harnwegsinfektionen
Vorstellung Aktion Antibiotika im Pflegewohnheim
Richtige Einnahme von Antibiotika
Diskussion
2Vortragende Univ. Prof. PD. Dr. Uwe Langsenlehner
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt (GGZ)
Leiter des Geriatrischen Konsiliardienstes
Assoz. Prof. PD. Dr. Ines Zollner-Schwetz
Sektion für Infektiologie
Universitätsklinik für Innere Medizin
Medizinische Universität Graz
Christian Pux
akademischer Experte in der Krankenhaushygiene
Hygienefachkraft GGZ
Michael Uhlmann
akademischer Experte in der Krankenhaushygiene
Hygienefachkraft GGZ
3Relevanz von Infektionen
Über 65- jährige Menschen haben ein 2,5-fach höheres Risiko
ca. 1/3 der Betroffenen verstirbt an Infektionskrankheiten.
hauptsächlich Infektionen der Atemwege und der Harnwege.
4Ursachen der erhöhten Infektanfälligkeit beim
älteren Menschen
Geschwächte zelluläre und humorale Immunabwehr (Imunseneszenz)
Physiologische Funktionsdefizite ( Schluckakt, Hustenreflex, Durchblutung, Wundheilung)
Katheter (v.a. Harnblase, venöse Zugänge)
Chronische Erkrankungen, die die Immunabwehr beeinträchtigen (DM, Karzinome, RA)
Medikamente (Immunsuppressiva, PPI, H2-Blocker)
Hygieneprobleme
Unter- oder Mangelernährung
Dehydratation
5Immunseneszenz
Geringere Zahl zirkulierender B-Lymphozyten
Verminderte Proliferation von B-Lymphozyten in LK-Keimzentren
verminderte Funktionalität von dendritischen Zellen (geringere AK-Antwort bei Impfungen)
Schlechte Antigenpräsentation
T-Zelldysfunktion durch Thymusinvolution
Verminderte T-Lymphozytenproduktion und –proliferation
Leins, H, Mulaw, M et al.: Aged murine hematopoietic stem cells drive aging-associated immune
remodeling, Blood 2018, 132:565-576; DOI: https://doi.org/10.1182/blood-2018-02-831065
Vermehrt zirkulierende Th-1 durch CD8+ T-Zellen (chronische Inflammation)
Geringgradig erhöhte Produktion bestimmter Zytokine (IL-6, TNF-α, sIL-2R)
Castle SC, ClinInfDis 2000; 31:578-585; Krabbe KS et al., Experimental Gerontology2004; 39:687
6Ursachen der erhöhten Infektanfälligkeit beim
älteren Menschen
Geschwächte zelluläre und humorale Immunabwehr (Imunseneszenz)
Physiologische Funktionsdefizite ( Schluckakt, Hustenreflex, Durchblutung, Wundheilung)
Katheter (v.a. Harnblase, venöse Zugänge)
Chronische Erkrankungen, die die Immunabwehr beeinträchtigen (DM, Karzinome, RA)
Medikamente (Immunsuppressiva, PPI, H2-Blocker)
Hygieneprobleme
Unter- oder Mangelernährung
Dehydratation
7Verminderte Immunantwort – Erhöhtes Risiko für
schwer verlaufende Infektionen
Diabetes: Neutrophilenfunktionsdefekt (bekapselte Bakterien)
Nieren- u. Herzinsuffizienz: reduzierte Neutrophilenfunktion, verminderte Immunzellproliferation
Leberinsuffizienz u. COPD: Komplementmangel, verminderte Immunzellproliferation
Eisenüberladung
Karzinome: Immundefizienz, Chemotherapie, IgG-Mangel
Chron. Infektionen : HIV, HCV?, HSV, CMV??
Autoimmunkrankheiten: Angeborener Komplementmangel (SLE), immunsuppressive Therapeutika
8Was ist das Bedrohliche bei Infektionen im höherem
Lebensalter
Anfänglich stiller Verlauf
Atypisches klinisches Erscheinungsbild
Späte und erschwerte Diagnose
Schwerer Krankheitsverlauf
Quelle: ONMEDA
Komplikationen
Komorbiditäten Verhältnis von Bakterien zu körpereigenen
Zellen
Zunahme der Mortalität Bakterien : körpereigene Zellen 10:1
Bakteriengene : menschliche Gene ≥ 200:1
Gewicht der Bakterien beim Erwachsenen ca. 2,5 kg
nach: The Human Microbiome Project, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, www.bcm.edu/molvir/microbiome
9Geändertes Fieberverhalten im höheren Alter
„the older the colder“
Bis zu einem Drittel der Menschen über 65 Jahre haben bei einer akuten Infektion kein Fieber.
Die Basaltemperatur ist bei älteren Patienten um 0,6-0,8°C niedriger.
Funktionsverlust peripherer Temperaturregulationsabläufe.
Reduzierte Zytokinroduktion ( IL-6, TNF- α , Interferon ).
Desensibilisierung hypothalamischer Zytokinrezeptoren (chronische Inflammation).
Antipyretisch wirksame Begleitmedikation ( vor allem NSAR, Paracetamol u. Metamizol ).
10Was ist das Bedrohliche bei Infektionen im höherem
Lebensalter
Anfänglich stiller Verlauf
Atypisches klinisches Erscheinungsbild
Späte und erschwerte Diagnose
Schwerer Krankheitsverlauf
Quelle: ONMEDA
Komplikationen
Komorbiditäten Verhältnis von Bakterien zu körpereigenen
Zellen
Zunahme der Mortalität Bakterien : körpereigene Zellen 10:1
Bakteriengene : menschliche Gene ≥ 200:1
Gewicht der Bakterien beim Erwachsenen ca. 2,5 kg
nach: The Human Microbiome Project, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, www.bcm.edu/molvir/microbiome
11Wann ist bei einem alten Menschen an einen
Harnwegsinfekt zu denken?
Ungeklärte Funktions- und/oder Verhaltensänderungen:
Besonders plötzliche Verwirrtheit
Psychomotorische Unruhe oder Lethargie
Harninkontinenz
Schwindel, Stürze
Tachypnoe, Tachykardie
Appetitlosigkeit, Gewichtsabnahme
Dehydratation
12Was ist das Bedrohliche bei Infektionen im höherem
Lebensalter
Anfänglich stiller Verlauf
Atypisches klinisches Erscheinungsbild
Späte und erschwerte Diagnose
Schwerer Krankheitsverlauf
Quelle: ONMEDA
Komplikationen
Komorbiditäten Verhältnis von Bakterien zu körpereigenen
Zellen
Zunahme der Mortalität Bakterien : körpereigene Zellen 10:1
Bakteriengene : menschliche Gene ≥ 200:1
Gewicht der Bakterien beim Erwachsenen ca. 2,5 kg
nach: The Human Microbiome Project, Baylor College of Medicine, Houston, Texas, www.bcm.edu/molvir/microbiome
13„Inflammaging“
Ein chronisch niederschwelliger systemischer Entzündungszustand
Höhere Empfindlichkeit des Organismus reduzierte kompensatorische Organreserven
Erhöhte Morbitität und Letalität
14Take home message
Eine plötzlich auftretende Funktionsstörung bei einem
alten Menschen ist vorrangig
als ein Alarmsymptom (Infektzeichen)
zu werten und erfordert
eine gründliche diagnostische Abklärung.
15Prävention von Harnwegsinfektionen
• Basishygiene
• Prävention von Katheter bedingten Harnwegsinfektionen
• Prävention von Nicht-Katheter bedingten Harnwegs-
infektionen
16Basishygiene
• Händehygiene
Händedesinfektion
reflektiertes Tragen von Schutzhandschuhen
• situative Verwendung von Schutzausrüstung (z. B. Schutzkleidung)
• Desinfektion von Medizinprodukten / Untersuchungsinstrumenten
• direkte Entsorgung von potentiell infektiösen Materialien
17 Händedesinfektion
Die hygienische Händedesinfektion gilt weltweit als die
wirksamste Einzelmaßnahme zur Prophylaxe nosokomialer
Infektionen und der Ausbreitung multiresistenter Erreger.
AWMF. (2016). Händedesinfektion und Händehygiene
18Händedesinfektion
19 reflektiertes Tragen von Handschuhen
Der Handschuh-Wechsel erfolgt in Korrelation
zu den
5 Indikationen der Händedesinfektion!
20Prävention von Katheter bedingten Harnwegsinfektionen Literatur Robert Koch-Institut : Prävention und Kontrolle Katheter-assoziierter Harnwegsinfektionen (2015) AWMF: Die Harndrainage (2015)
Prävention von Katheter bedingten Harnwegsinfektionen
Blasenverweilkatheter dürfen nur nach strenger Indikationsstellung
gelegt werden und sind frühest möglich wieder zu entfernen.
Die Durchführung der Katheterisierung muss unter aseptischen
Bedingungen erfolgen.
Eine Diskonnektion des Systems ist zu vermeiden (Desinfektion der
Konnektionsstellen falls nicht vermeidbar)
Der Auffangbeutel muss immer freihängend ohne Bodenkontakt unter
Blasenniveau positioniert sein.
22 Der Auffangbeutel ist rechtzeitig zu leeren, bevor der Harn mit der
Rückflusssperre in Kontakt kommt. (Nach der Harnentleerung muss der
Ablassstutzen mit einem Desinfektionsmittel desinfiziert werden.)
Die Reinigung des Genitales erfolgt mit Trinkwasser und Seifenlotion
ohne antiseptische Zusätze im Rahmen der normalen täglichen
Körperpflege (Beachtung der hygienischen Aspekte).
Gewinnung von Harnproben zur mikrobiologischen Diagnostik
Der Katheterwechsel erfolgt individuell nach ärztlicher
Indikationsstellung (insbesondere jedoch bei Infektion).
23Beispiele für Hygienerichtlinien
Institut für Krankenhaushygiene und Mikrobiologie Graz, KAGes
https://www.krankenhaushygiene.at/fileadmin/media/ikm/FRL_PDF/14_Harnkatheterismus_2017_05.pdf
Univ. Klinik für Krankenhaushygiene und Infektionskontrolle, Medizinische
Universität Wien, AKH Wien
https://www.meduniwien.ac.at/orgs/fileadmin/krankenhaushygiene/HygMappe/Richtlinien/019_Transurethrale_Harnableitung
_vs03.pdf
https://www.meduniwien.ac.at/orgs/fileadmin/krankenhaushygiene/HygMappe/Richtlinien/020_Suprapubische_Harnableitung
_vs03.pdf
24Prävention von Nicht-Katheter bedingten Harnwegsinfektionen
hygienische Aspekte der Köperpflege berücksichtigen,
z. B. Waschhandschuh-
und Handtuchwechsel
vor der Genitalpflege
25AKTION ANTIBIOTIKA IM PWH
DIAGNOSTIK UND THERAPIE VON
HARNWEGSINFEKTIONEN
Assoz. Prof. Priv. Doz. Dr. Ines Zollner-Schwetz
Klinische Abteilung für Infektiologie
Universitätsklinik für Innere Medizin
Medizinische Universität GrazHintergrund
Risiko von Infektionen bei
Bewohner*innen von PWH
Alterungsprozess des Menschen führt
zur vielen Veränderungen, die Risiko
für Infektionen erhöhen, z.B.
Immunoseneszenz
in Gemeinschaftseinrichtungen
zusätzliche Faktoren:
Gemeinschaftsalltag
Notwendige pflegerische Maßnahmen
Robert Koch-Institut. (2012). Herausforderungen durch Infektionen und
mehrfachresistente Bakterien bei alten Menschen in HeimenInfektionen in Langzeitpflegeeinrichtungen Harnwegsinfektionen (30%) Atemwegsinfektionen (30%) Hautinfektionen (20%) Euro Surveill. 2018 Nov 15; 23(46): 1800516: https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.
Häufigkeit nosokomialer
Infektionen europaweit
Nosokomiale Infektionen in
Langzeitpflegeeinrichtungen in EU
4,4 Millionen/Jahr
129,940 an einem Tag
Antibiotika Resistenzen
31.6% in Krankenhäusern und
28.0% in PWH
Euro Surveill. 2018 Nov 15; 23(46): 1800516:
https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.Todesfälle durch MRE in Europa
Je mehr eine antimikrobielle Substanz verwendet wird,
desto mehr Resistenzen entstehen auf diese Substanz.
Goossens H, Lancet, 2005Maßnahmen gegen multiresistente Erreger (MRE) Infektionsprävention Reduktion von Antibiotika in Tierzucht Entwicklung neuer Antibiotika Antibiotic Stewardship Programme (ASP)
Was ist Antibiotic Stewardship? Ein Bündel von Programmen mit dem Ziel, die Qualität der Verordnung von Antiinfektiva kontinuierlich zu verbessern. Ziele: Beste klinische Behandlungsergebnisse Wenig Toxizität für die Patient*innen Geringe Resistenzentwicklung Moderate Kosten
ASP Methoden Weiterbildung Therapieempfehlungen Geriatrischer & infektiologischer Konsiliardienst für Fragen Antibiotika-Listen ….
Unsere Studie: Aktion Antibiotika im Pflegewohnheim
Kooperationspartner
Christian Pux
Michael Uhlmann
Klin. Abt. für Infektiologie
Univ. Doz. Dr. Uwe Langsenlehner
Leiter Geriatrischer KonsiliardienstVorarbeiten
Prospektive Erfassung von Infektionen
in 4 Pflegewohnheimen der GGZ
Inzidenzrate 2.1 per 1,000 resident days
(Literatur: 3.6 -7 per 1,000 resident days)
252 Infektionen in 12 Monaten
124 Harnwegsinfektionen
43 untere Atemwegsinfektionen
König E, Antibiotics, in pressAntibiotikatherapie bei HWI in PWH der GGZ 2018 8/124 HWIs Harnkulturen durchgeführt
Ziel der Studie
BeiVerdacht auf Harnwegsinfekten bei
Bewohner*innen in PWH
Diagnose umsichtig stellen
Harnkultur sinnvoll einsetzen
Antibiotika verantwortungsvoll verwenden
Anzahl der „passenden“ Therapien erhöhen
Anzahl
der adäquat abgenommenen
Harnkulturen erhöhenStudiendesgin
Interventionsgruppe Kontrollgruppe
4 PWH der GGZ Volkshilfe Bärnbach
360 Betten Volkshilfe
Deutschlandsberg
BezirksPWH Voitsberg
Sonnenhof Fehring
Ca.320 BettenMethoden Datenerfassung vor Ort in die Online Datenerfassung Beschwerden Diagnostische Schritte AB Therapie (Dosis, Dauer) Evaluierung der AB Therapie durch 2 unabhängige, geblindete Infektiologen (passend/ nicht passend)
Aufwandsentschädigung von 25€ pro vollständig dokumentierter HWI Episode
Ablauf der Studie
Wann Phase Was
Mai-Juni 2021 Intervention Daten erfassen &
Fortbildungen etc.
Juli 2021- ca. Beobachtung Daten erfassen
Ende 2021
Mindestens 150 Harnwegsepisoden pro Gruppe notwendigInterventionsbündel
Homepage
Für Hausärzte GeKo Für Pflege
• Erstellung von Leitlinien • Leitlinien auf • 2 Treffen mit PDL, STL, HL
• Übermittlung Leitlinien Homepage • Vorstellung Studie in PWH
• Fortbildungen in PWH • Fortbildungsvideos • 1 Hygienefortbildung
(Mai und Herbst 2021) • Möglichkeit Fragen für alle MA (laufend; Pux
zu mailen & Uhlmann)
an Geko & • Leitlinie
InfektiologieZiel der Studie
Diagnose umsichtig stellen
Harnkultur sinnvoll einsetzen
Antibiotika
verantwortungsvoll
verwenden Resistenzen vermeidenDiagnostik und Therapie von Harnwegsinfektionen
Leitfaden Harnwegsinfektionen
Auf Basis von nationalen und internationalen LeitlinienDiagnostik
Indikationen für eine Harnkultur:
Anzeichen eines HWI bei disponierenden Faktoren
(z.B. Abflusshindernisse)
Anzeicheneines rezidivierenden HWI (≥2 Episoden
in 6 Monaten, ≥3 Episoden in 12 Monaten)
Fortbestehen der Symptome unter bzw. nach
Antibiotikatherapie
Fieber unklarer Genese
http://www.oeginfekt.at/download/cs-akuter_hwi.pdfPräanalytik Nativharn in einem Transportgefäß ohne Stabilisator -> innerhalb von 2 Stunden ins Labor Max. 24 - (48) h im Kühlschrank Stabilisatorenkönnen die Keimzahl 24- (48) h bei Raumtemperatur konstant halten Hygiene Institut, Med Uni Graz: Probenannahme Montag-Sonntag
Interpretation von Harnbefunden
E. coli behandeln
auch bei niedriger
KeimzahlGram negative behandeln, Entercoccus ignorieren
Staphylokokken = Hautkeim Kontamination Ausnahme: Staph. saprophyticus besonders bei jungen Frauen
> 2 Keime Kontamination sehr wahrscheinlich Katheter wechseln, frischen Harn zur Kultur einschicken
Harnkulturbefund unklar…. Für Rückfragen in Bezug auf Kulturergebnisse, Therapieoptionen, etc. wenden Sie sich bitte an: Geriatrischer Konsiliardienst 0316/7060- 6060 oder Klin.Abt. für Infektiologie, Med Uni Graz 0316/385-81937 oder 31416
Therapie unkomplizierter HWI
GFR < 45E. coli aus Harn Resistenzbericht 2020 Institut f. Hygiene Med Uni Graz
Therapie unkomplizierter HWI
GFR < 45E. coli aus Harn Resistenzbericht 2020 Institut f. Hygiene Med Uni Graz
Fluorchinolone - „Rote Hand Briefe“ November 2018: April 2019:
Seltene schwerwiegende
Nebenwirkungen
Bewegungsapparat
Tendinitis, Sehnenruptur, Myalgie, Muskelschwäche,
Arthralgie, Gelenksschwellungen, Gangstörung.
peripheres/ zentrales Nervensystem
periphere Neuropathie, Schlaflosigkeit, Depressionen,
Ermüdung (Fatigue), eingeschränktes Erinnerungsvermögen
sowie Seh-, Hör-, Geruchs- und GeschmacksstörungenNebenwirkungen aus klinischen
Alltag
ZNS (vor allem ältere Patient*innen!)
Unruhe, Agitiertheit, Krampfanfälle,
Schlaflosigkeit, Suizidalität...
GI Trakt
Leberfermenterhöhungen, Bilirubin-Anstieg,
Übelkeit, Erbrechen, Diarrhoe, C. difficile Infektion
Andere
Gelenks und Muskelbeschwerden
Kreislauf
QTc VerlängerungenChinolone nicht verordnen https://www.bfarm.de/SharedDocs/Risikoinformationen/Pharmakovigilanz /DE/RHB/2019/rhb-fluorchinolone.html
Keine Änderung bei https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2019/20190311143277/anx_143277_de.pdf
Leitfaden Harnwegsinfektionen
Auf Basis von nationalen und internationalen LeitlinienDiagnostik
Indikationen für eine Harnkultur bei HDK:
Anzeichen eines Harnwegsinfekts (auch bei
erstmaligem Auftreten)
Anzeichen eines rezidivierenden HWI (≥2 Episoden
in 6 Monaten, ≥3 in 12 Monaten)
Fortbestehen der Symptome unter bzw. nach
Antibiotikatherapie
Fieber unklarer Genese.
Routineharnkulturen bei asymptomatischen
Patienten werden NICHT empfohlen.
http://www.oeginfekt.at/download/cs-akuter_hwi.pdfVorgehen bei V.a. HWI bei HDK Abnahme von Harn für eine Harnkultur VOR Einleitung der Antibiotikatherapie Harnkatheter immer wechseln, auf jeden Fall wenn länger als 7 Tage liegend, Harn aus dem frischen Katheter für Kultur verschicken Wenn Harnkatheter vor Ort nicht gewechselt werden kann, aseptische Abnahme von Harn aus dem Entnahmeschenkel des Harnkatheters. European Association of Urology https://uroweb.org/guideline/urological-infections/#3 https://www.nice.org.uk/guidance/ng113
Therapie
Empirische Therapie abh. von Vorbefunden mit
Ciprofloxacin (z.B. Ciproxin) 2x 500mg po
Amoxicillin/Clavulansäure (z.B. Augmentin, Xiclav) 2-
3x 1000mg po
Anpassen der Antibiotikatherapie an das
Kulturergebnis
Bei Hypotonie oder deutlicher Verschlechterung
des Allgemeinzustandes Krankenhauseinweisung
zur i.v. Therapie erwägen.
Therapiedauer: 7 Tage bei gutem AnsprechenZusammenfassung
Diagnose umsichtig stellen
Harnkultur sinnvoll einsetzen
Antibiotikatherapie unkomplizierter HWI
Fosfomycin, Pivmecillinam, Nitrofurantoin bevorzugen
Vorgehen komplizierter HWI
Harnkultur anfordern
Empirische Therapie mit Ciprofloxacin und Amox/Clav
starten anpassen
Rückfragen an GEKO oder InfektiologieDanke für Ihre Unterstützung!
Richtiger Umgang mit Antibiotika
Von entscheidender Bedeutung im Umgang mit Antibiotika (AB)
ist das der Patient/ Patientin vom medizinischen Personal über
den richtigen Umgang mit AB aufgeklärt wird. Folgende Inhalte
müssen vermittelt werden.
Allgemeine Informationen
Einhaltung der Einnahmevorgaben
Zu Beachten bei Antibiotika
72Richtiger Umgang mit Antibiotika
Allgemeine Informationen:
Antibiotika wirken ausschließlich gegen Bakterien - niemals gegen Viren.
Ganz oder gar nicht: Antibiotika sind so lange wie verordnet in der vollen Dosis
einzunehmen und bei Besserung der Symptome nicht vorzeitig zu beenden.
Treten Auffälligkeiten bzw. unerwünschte Wirkungen ein ist der Arzt/Ärztin
unverzüglich zu informieren. Das Medikament nicht selbständig ohne Rücksprache
mit Ärztin oder Arzt absetzen.
73Richtiger Umgang mit Antibiotika
Einhaltung der Einnahmevorgaben:
Bitte erklären Sie ihren KlientInnen was bei der Einnahme von Antibiotika beachtet werden
muss (z. B. Wechselwirkungen mit Lebensmitteln) Vor und nach der Einnahme mindestens zwei Stunden auf
Milch verzichten – auch auf kalziumreiches Mineralwasser, Milchprodukte wie Käse, Topfen oder Joghurt und zudem auf
einige Präparate, die gegen Osteoporose zum Einsatz kommen.
Beachten der vorgeschriebenen Einnahmezeiten:
Dreimal täglich bedeutet alle acht, zweimal täglich alle zwölf und einmal täglich alle 24
Stunden (weil nur dann eine ausreichend hohe Konzentration des Arzneistoffs im Körper vorhanden ist, um die Bakterien
gut abtöten zu können).
Beachten des richtigen Einnahmezeitpunktes – s. Beipackzettel:
„Vor dem Essen" heißt, das Antibiotikum eine 1/2 - 1 Stunde davor einzunehmen
„Zum Essen" steht für, das Antibiotikum direkt zur Mahlzeit einnehmen.
74Richtiger Umgang mit Antibiotika
Einhaltung der Einnahmevorgaben:
Kaffee in Kombination mit einem Antibiotikum kann Herzrasen auslösen.
Bei Antibiotikaeinnahme sollten koffeinhaltige Getränke wie Kaffee, Cola, schwarzer oder grüner Tee während der
gesamten Einnahmezeit vermieden werden, denn durch das Antibiotikum kann der Körper Koffein schlechter
abbauen. Als Folge können Herzrasen und Schlafstörungen auftreten.
Magnesium, Eisen, Aluminium und Zink können mit Antibiotika wechselwirken.
Nimmt man mineralstoffhaltigen Substanzen zeitnah zusammen mit Chinolon- oder Tetracyclin-Antibiotika ein,
können diese nicht mehr optimal gegen krankmachende Bakterien wirken.
Alkohol und Antibiotika könnten theoretisch kombiniert werden.
Der Alkohol schwächt jedoch das durch die Infektion stark beanspruchte Immunsystem zusätzlich, was die Genesung
deutlich behindert.
Grundsätzlich sollten Antibiotika – egal welche – am besten mit einem Glas Leitungswasser
eingenommen werden.
75Richtiger Umgang mit Antibiotika
Zu beachten bei Antibiotika:
Niemals Antibiotika einnehmen, die anderen Personen verordnet wurden.
Die richtige Aufbewahrung des Antibiotikums bitte beachten (z.B. lichtgeschützte
Lagerung).
Übrig gebliebene Antibiotika sollten nicht aufbewahrt werden, um sie zu einem
späteren Zeitpunkt einzunehmen. Generell bitte Medikamente fachgerecht in der
Apotheke entsorgen, nicht im Hausmüll.
Literatur:
ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e.V
Bundesärztekammer und Kassenärztlicher Bundesvereinigung (2020)
76Univ. Prof. PD Dr. Uwe Langsenlehner
Herzlichen Dank
Geriatrische Gesundheitszentren der Stadt
Leiter des Geriatrischen Konsiliardienstes
Assoz. Prof. PD. Dr. Ines Zollner-Schwetz
Sektion für Infektiologie
Universitätsklinik für Innere Medizin
Medizinische Universität Graz
Christian Pux
akademischer Experte in der Krankenhaushygiene
Hygienefachkraft GGZ
Michael Uhlmann
akademischer Experte in der Krankenhaushygiene
Hygienefachkraft GGZSie können auch lesen